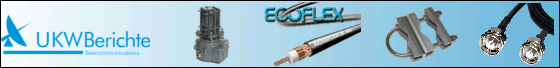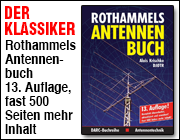Editorial FUNKAMATEUR 5/2024
Heraus aus der Komfortzone
In der Region Berlin/Brandenburg, in der ich seit Jahrzehnten arbeite, wohne und einen großen Teil meiner Freizeit verbringe, kenne ich mich gut aus. Das dachte ich zumindest, bis ich vor einigen Jahren ein für mich reizvolles Diplomprogramm entdeckte.
IOTA (Islands On The Air) und SOTA (Summits On The Air) werden viele bereits kennen. Da Inseln und ausreichend hohe Berge in meiner eher flachen, von Seen und Flüssen geprägten Gegend aber nicht vorhanden sind, konzentriere ich mich auf das DLFF-Programm. DLFF ist die Bezeichnung für ein Flora- und Fauna-Gebiet in Deutschland.
Unter dem Dach der WWFF (World Wide Flora and Fauna in Amateur Radio) haben sich Enthusiasten aus vielen Teilen der Welt zusammengeschlossen. Die Ziele beider Programme sind identisch: Man bezweckt mit der Herausgabe von Diplomen, Funkamateure zum Betrieb aus Naturschutzgebieten, Flora-Fauna-Habitaten und Natura-2000-Gebieten zu bewegen. Da zu jeder Funkverbindung stets zwei Partner gehören, werden die globalen und nationalen Diplome sowie die Trophäen jeweils für Aktivierer und sogenannte Jäger herausgegeben.
So gibt es in den bei den eingangs genannten Bundesländern bereits 166 für das DLFF-Programm zählende Gebiete, darunter elf Naturparks, drei Biosphärenreservate und sogar einen Nationalpark. Die höchste, vor ein paar Tagen in Deutschland vergebene Referenznummer ist die 1170. Ein lohnendes Ziel dürfte somit quasi immer in der Nähe erreichbar sein, egal wo man sich befindet und in welche Richtung es geht.
Obwohl ich kein ausgesprochener Diplomsammler bin, begeistert mich das DLFF-Programm. Mein Hauptgrund für die Teilnahme ist, unbekannte Gegenden kennenzulernen. Wie bei jeder Funkaktivität habe ich mir auch bei DLFF-Aktivierungen zu eigen gemacht, diese gewissenhaft vorzubereiten, denn das erspart Enttäuschungen vor Ort. Um die Grenzen der in der zweimal im Jahr erweiterten DLFF-Referenzliste aufgeführten Gebiete mit guten topografischen Karten in Einklang zu bringen, war bisher relativ viel Arbeit erforderlich. Seit Kurzem gibt es mit dem ab S. 356 beschriebenen Overlay für Google Earth eine effektivere Möglichkeit der Vorbereitung und Orientierung vor Ort.
Zu einer Aktivierung gehört für mich, bereits im Vorfeld Informationen über das anvisierte Gebiet einzuholen. Außerdem sehe ich mir die Gegend, in der ich aktiv bin, vor oder nach dem Funken stets näher an. Dadurch ist jede getätigte Funkverbindung mehr als nur eine Zeile im Logbuch. Und obwohl man in Naturschutzgebieten weder die Wege verlassen noch irgendwelche Baumaßnahmen durchführen darf, habe ich bisher immer ein Plätzchen am Wegesrand gefunden, das sich zum Aufbau der Funkstation eignet. Der dabei eher improvisierte Antennenaufbau zählt für mich ebenso zum Experimentalfunk wie die Auswahl eines passenden Funkgeräts und dessen Stromversorgung.
Ganz nebenbei ergibt sich die Möglichkeit, dem in der Regel innerhalb von Städten immer vorhandenen Störnebel zu entgehen. Das Verlassen des zumeist bequem und komfortabel eingerichteten heimischen Shacks hat somit auch Vorteile, selbst wenn man sich Gedanken über die Größe der Funkstation sowie deren Transport und Stromversorgung machen muss.
73/44 de Ingo Meyer, DK3RED/P