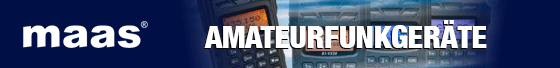Editorials
Die Bereitstellung der Materialien erfolgt ausschließlich zur privaten Nutzung. Jegliche gewerbliche Verwertung bedarf der Zustimmung des jeweiligen Autors und des Verlages.
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
Vom Detektorempfänger zur Passion
Ich war sechs Jahre alt, als mir mein Vater eines Tages ein kleines unscheinbares Kästchen schenkte. Auf meinen fragenden Blick hin erklärte er mir, dass dies ein von ihm gebauter Detektorempfänger sei und wie er funktioniere. Doch erst als ich damit unseren RIAS Berlin hörte, begriff ich, was es mit diesem winzigen Wunderwerk auf sich hatte. Radios kannte ich schon in vielen Variationen, denn mein Opa hatte ein Radio- und Fernsehgeschäft, in dem ich mich nach der Schule und an Samstagen oft aufhielt. Dieses Gerät jedoch war mir neu und lange Zeit begab ich mich damit auf abendliche „Wellenjagd“.
Die Jahre gingen ins Land und eines Tages stand mein bester Freund Holger – heute DD6WM – mit zwei CB-Handfunkgeräten stabo Multifon 7 vor der Tür. Von nun an war nicht nur passives Radiohören, sondern aktiver Funkbetrieb die favorisierte Freizeitbeschäftigung! Schon nach kurzer Zeit kamen leistungsfähigere Handfunkgeräte dazu und eines Tages dann die erste heiß ersehnte „KF“, wie eine Feststation im CB-Funkerjargon bezeichnet wurde. Das HF-Virus hatte mich erwischt! Irgendwann brachte mein Vater einen Empfänger Kenwood R-300 heim – das war der Einstieg in den Amateurfunk. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tage und Nächte wir vor diesem Gerät verbrachten und fernen Radiosendern und den Funkamateuren lauschten. Auch heute noch steht der R-300 betriebsbereit in meinem Shack und manches Mal gehe ich nur mit ihm „über die Wellen“, um mich wieder an die damals doch so neuen und aufregenden Eindrücke zu erinnern.
In meiner Ausbildungszeit zum Elektroinstallateur hatte ich keine Berührungspunkte mit der drahtlosen Kommunikation, dafür aber auf See, denn unsere Segelyacht war mit Sprechfunk, Grenzwellenempfänger für die nautischen Warn- und Wetternachrichten sowie einem Funkpeilempfänger zur Standortbestimmung ausgerüstet. Später hatte ich auch beruflich bei der Bundeswehr und als freiwilliger Seenotretter bei der DGzRS mit Funk zu tun. Außerdem betrieb ich eines der damaligen Relays des INTERMAR-Maritim- und Mobil-Amateurfunknetzes. All dies liegt nun schon einige Jahre zurück und heute bin ich „nur“ noch als Funkamateur „on air“. Hierbei gilt mein überwiegendes Interesse dem Zusammenbau und dem Betreiben von QRP-Bausatztransceivern sowie von Antennen und ihrer praktischen Erprobung. Und da mich bis heute fasziniert, welche Entfernungen sich mit geringen Sendeleistungen überbrücken lassen, beträgt mein selbst gestecktes Limit maximal fünf Watt.
Beruflich war ich bis zuletzt als IT-Dienstleister und technischer Redakteur im Sektor Elektrotechnik und Maschinenbau tätig. Dem FUNKAMATEUR bin ich seit langem verbunden und als ich erfuhr, dass die Stelle eines Redakteurs zu besetzen war, bewarb ich mich kurzerhand.
So freue ich mich jetzt auf interessante Aufgaben in der Redaktion, zu denen neben der Bearbeitung eingegangener Manuskripte auch das Recherchieren sowie das Schreiben eigener Beiträge gehört. Ich werde Ihnen, liebe Leser, neue Technik und nützliches Zubehör fürs Shack und den Funkbetrieb außerhalb der eigenen vier Wände vorstellen. In enger Zusammenarbeit mit meinen Kollegen möchte ich dafür sorgen, dass der FUNKAMATEUR auch in Zukunft abwechslungsreich und lesenswert bleibt. Zu meinen Aufgaben gehören darüber hinaus die Betreuung und der Ausbau des Web- und Social-Media-Auftritts des Verlags sowie die Erstellung von Podcasts und Videos.
Als künftiger Redakteur freue ich mich aber ebenso auf die
Kommunikation mit Ihnen, auf Ihre Ideen, Vorschläge und Manuskripte. Wir
haben es gemeinsam in der Hand, den FUNKAMATEUR inhaltlich zu gestalten
und können damit einen Beitrag zum Erhalt unseres spannenden Hobbys
leisten.
Frank G. Sommer, DC8FG
Sonnenaktivität im Fokus
Der Amateurfunk hat viele Betätigungsfelder, bei denen wir unser
Wissen, unsere Fähigkeiten und unsere sozialen Kompetenzen einbringen
und erweitern können. Aktivitäten in der Gemeinschaft von uns
Funkamateuren stehen für mich im Vordergrund, sei es bei der Ausbildung
oder bei Selbstbauprojekten, bei der DX-Jagd, beim Bergfunken oder bei
Contesten.
Die Beschäftigung mit der Sonnenaktivität und deren
Einfluss auf die Ionosphäre und die permanente Beobachtung der
Ausbreitungsbedingungen gehören dazu. Mein wöchentlicher
Funkwetterbericht im DARC-Rundspruch enthält neben den im Internet
veröffentlichten Daten immer tägliche Notizen zu tatsächlichen
Ausbreitungsbedingungen.
Als ich vor 30 Jahren damit begann,
befanden wir uns im ausklingenden Zyklus 22. Es folgte ein starker
Zyklus 23, danach der schwache 24-er und jetzt der etwas stärkere Zyklus
25. Mit der Zeit haben sich unsere Kenntnisse durch die Raumfahrt, die
Computertechnik und die Wissenschaft allgemein erweitert. Und
dennoch verstehen wir bis heute noch nicht alle elementaren
Zusammenhänge. Neuere Forschungsarbeiten, wie die von Dr. Frank
Stefani vom Helmholtz-Zentrum Dresden, erhärten die These, dass der
Sonnenfleckenzyklus getaktet ist. Alle 11,4 Jahre stehen die Planeten
Erde, Venus und Jupiter auf einer Achse mit der Sonne und
synchronisieren als äußere Uhr das solare Magnetfeld. Gegenstand
intensiver Forschung sind beispielsweise der Einfluss der
Klimaveränderungen in der unteren Atmosphäre auf die D- und E-Schichten
der Ionosphäre und die Erforschung der sporadischen E-Schicht.
Im
Moment befinden wir uns knapp zwei Jahre vor dem Maximum des 25.
Sonnenfleckenzyklus. Die Erinnerungen an die Jahre der aktiven Sonne
gehen bei älteren OPs zurück an das im Maximum des 19.
Sonnenfleckenzyklus durchgeführte Internationale Geophysikalische
Jahr IGJ (1.7.1957 bis 31.12.1958). Damals konnte man auf dem 10-m-Band
weltweite QSOs mit QRP und Drahtantennen fahren.
Mittlerweile
stehen uns Funkamateuren sehr komfortable Instrumente zur
Funkwetterbeobachtung zur Verfügung. Viele davon, wie die Aurorabake
DK0WCY, das IBP der NCDXF, das Reverse Beacon Network, Skimmer,
DX-Cluster, das WSPRnet oder öffentlich zugängliche SDR-Empfänger sind
durch Funkamateure realisiert worden. Das große Interesse am Thema
Funkwetter widerspiegelt sich in sehr informativen Webseiten vieler OPs.
Wer sich vor DXpeditionen, vor Contesten oder bei der Urlaubsplanung
für die Ausbreitungsbedingungen interessiert, findet beispielsweise bei
VOACAP (OH6BG) Unterstützung. Ausbreitungsvorhersagen, wie die von
František Janda, OK1HH, im Funkamateur oder die in der CQ DL nutzen
Mittelwerte der für die Sonnenaktivität stehenden Proxies
Sonnenfleckenzahl R und Solarer Fluxindex SF. Die Vorhersagen sollen für
50 % der Tage eines Monats zutreffen. Wenn man zusätzlich spontane,
also nicht vorhersagbare Ereignisse auf der Sonne (www.solarham.net) in
die eigene Beurteilung einbezieht, liegt man meist richtig. Auf
https://dr2w.de/dx-propagation werden die Daten alle sechs Stunden
aktualisiert. Und Tom, DF5JL, analysiert die Funkwetterdaten täglich
auf der DARC-Webseite.
Bleibt also aktiv und kreativ, ganz so wie
es der schlesische Dichter, Arzt und Theologe Johannes Scheffler (1624
bis 1677) über unseren Mutterstern schrieb:
Die Sonn erreget alles,
macht alle Sterne tanzen.
Wirst du nicht auch bewegt,
so g’hörst du nicht zum Ganzen.
Dr.-Ing. Hartmut Büttig, DL1VDL
Reparieren statt wegwerfen!
Zunächst war es nur ein Gerücht, inzwischen aber kam die offizielle
Meldung: Die Reparatur defekter Produkte soll in Zukunft deutlich
einfacher und billiger werden als bisher. In Brüssel haben sich die
Unterhändler von Parlament, Kommission und Rat darauf geeinigt, dass es
ein EU-weites Recht auf Reparatur geben soll. Infolgedessen können
Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Kühlschränke, Staubsauger,
Mobiltelefone und andere Produkte bis zu drei Jahre nach dem Kauf auf
Wunsch vom Hersteller reparieren lassen.
Aber auch nach dieser
Frist soll ein Rechtsanspruch auf Reparatur bestehen. Die Hersteller
werden dazu verpflichtet, Ersatzteile und benötigte Spezialwerkzeuge
zu einem angemessenen Preis zur Verfügung zu stellen. Es ist dann
folgerichtig verboten, die Reparatur durch Vertragsklauseln oder Tricks
bei Hard- und Software zu erschweren oder gar unmöglich zu machen.
Damit
möglichst viele Menschen ein defektes Gerät instand setzen lassen,
sollen die EU-Mitgliedsstaaten die Reparatur fördern. Dies könnte etwa
durch die Ausgabe von Reparaturgutscheinen geschehen, wie derzeit in
Sachsen und Thüringen, durch Reparaturkurse oder sogar mittels
Reduzierung der Umsatzsteuer auf Reparaturleistungen.
Ich finde
diese Nachricht aus Brüssel sehr bemerkenswert, könnte die neue
Gesetzgebung doch endlich im großen Rahmen den langfristigen Umstieg von
der Wegwerf- zur Reparaturgesellschaft einläuten. Große Mengen an Müll
ließen sich jährlich vermeiden. Die unsägliche Ressourcenverschwendung
der heutigen Ökonomie nach dem Motto „Hauptsache viel und billig“ ginge
damit zumindest in Europa ihrem Ende entgegen. Letztere ist eine
wesentliche Ursache dafür, dass die Reparatur derzeit meist teurer als
der Neukauf ist – dies nicht selten sogar bei banalen Defekten, wie
einem defekten Anschlusskabel, Stecker oder Schalter.
Es versteht
sich von selbst, dass dieser Wandel nicht von heute auf morgen
geschehen wird. Hier sind ökonomische Prozesse umzugestalten, die leider
zunehmend außerhalb Europas stattfinden, was die Sache nicht gerade
einfacher macht. Es ist jedoch nicht nur ein grundlegender
Sinneswandel bei den Herstellern, sondern auch bei uns Konsumenten
erforderlich. Ich vermute, dass reparaturfreundliche Geräte künftig
teurer sein werden, als gleichartige Erzeugnisse aus dem heutigen
Sortiment. Schon bei der Entwicklung müssten Hersteller neu denken und
so manche Billiglösung wäre dann nicht mehr möglich. Am Ende würden aber
nicht nur die Ressourcen unseres Planeten und die Umwelt geschont. Auch
Verbraucherinnen und Verbraucher würden dies langfristig im Geldbeutel
spüren, wenn sie ein Gerät durch preisgünstige Reparatur länger nutzen
können. Nicht von ungefähr gibt es den Spruch „Wer billig kauft, kauft
doppelt.“
Im Kleinen ist der Anfang schon längst gemacht. Für
Haushaltsgeräte aller Art gibt es bereits eine kostengünstige
Reparaturmöglichkeit in sogenannten Repair-Cafés. Dies sind
ehrenamtliche Initiativen, bei denen fachkundige Spezialisten defekte
Geräte für wenig Geld oder sogar kostenlos reparieren. Nicht selten
gehören Funkamateure und Hobbyelektroniker zu diesen selbstlosen
Helfern.
Bestimmt gibt es eine solche Einrichtung auch in Ihrer
Nähe, lieber Leser. Schauen Sie doch einfach einmal auf
www.repaircafe.org/de nach. Wenn Sie überdies noch gern schrauben oder
basteln und daheim sowieso schon für alle Reparaturen zuständig sind,
haben Sie schon eine ganze Menge Erfahrung auf diesem Gebiet. Arbeiten
Sie beim nächstgelegenen Repair-Café ehrenamtlich mit und tragen Sie so
dazu bei, dass die Welt ein klein wenig besser wird. Die gute Erfahrung,
andere Menschen glücklich zu sehen, deren liebgewonnenes altes
Bügeleisen oder Radio wieder funktioniert, ist diesen Einsatz allemal
wert. Und Spaß macht das Ganze sowieso.
Peter Schmücking, DL7JSP
Müssen wir Funkamateure vor KI Angst haben?
Künstliche Intelligenz (KI) ist laut Wikipedia ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Das klingt erst einmal nicht per se bedrohlich. PCs und Software werden von Menschen entwickelt und gebaut bzw. programmiert. Gegenüber den 1970er-Jahren, als ich im Studium das Programmieren mit ALGOL 60 erlernte, hat sich auf diesem Gebiet eine Menge getan.
Computertechnik hat heute eine völlig andere Qualität. Die früher scherzhaft Blechkameraden genannten Maschinen können inzwischen sogar selbst lernen. Da ist das Attribut künstliche Intelligenz schon annähernd zutreffend, wenngleich Rechner meines Erachtens noch nicht wirklich selbst denken können.
Eine Tendenz zum selbständigen Denken zeichnet sich jedoch unzweifelhaft ab, und da ist es bitter nötig, aufzupassen und Richtschnüre zu spannen! Deswegen hat das Europäische Parlament am 13. März 2024 nach dreijähriger Beratung mit dem Ai Act die weltweit erste staatliche Regulierung künstlicher Intelligenz beschlossen, ein 258 Druckseiten umfassendes Gesetz für Künstliche Intelligenz. Dabei gilt der Grundsatz: je höher das Risiko, desto strenger die Regeln. Details sollen nationale Gesetze regeln.
Allerdings treten die schärferen KI-Regeln erst in zwei Jahren in Kraft und müssen mit weiteren Entwicklungen flexibel Schritt halten. Diese Verzögerung ist schwer nachzuvollziehen, denn aufgrund des schnell zunehmenden Gefahrenpotenzials wäre zügigeres Handeln ein Gebot der Stunde. Den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, wovon manche Politiker träumen, dürfte KI allerdings kaum leisten können.
Uns Funkamateure tangiert KI nicht nur als aufmerksame und mitdenkende Staatsbürger, sondern auch in der Amateurfunkpraxis.
FT8 hatte ich selbst in FA 3 und 4/2018 wohlwollend vorgestellt – unter dem Gesichtspunkt des DX-Verkehrs. Ich konnte freilich nicht absehen, wo die Entwicklung hinläuft, dass PCs mittlerweile mehr und mehr allein miteinander funken. Angesichts des archaischen Informationsgehalts bedarf es dazu nicht einmal KI. Daneben gibt es andere digitale Sendearten, bei denen dies nicht anders aussieht; weitere werden sicher folgen. Manch einem mag das gefallen, Amateurfunk ist ja schließlich ein Hobby und soll den Ausübenden Freude bereiten.
KI dürfte dennoch im Amateurfunk zunehmend Fuß fassen, sie kann inzwischen die menschliche Sprache nicht nur bestens verstehen, sondern obendrein täuschend echt nachahmen. Also, wer garantiert mir denn eigentlich heute noch, ob mein Fonie-QSO-Partner tatsächlich noch die YL oder der OM ist, als sie oder er sich ausgibt und dessen Daten ich etwa bei QRZ.com nachlesen kann?
Deshalb sei unbedingt an unseren Ehrenkodex erinnert, der uns
verbietet, das Gegenüber derart auf die Schippe zu nehmen. Wer KI beim
Funken trotzdem ausprobieren möchte, sollte dies im QSO
unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Vorschriften dürften da wenig
helfen, da deren Einhaltung kaum überprüfbar wäre. Gleichwohl täte die
IARU gut daran, ihren Mitgliedsverbänden entsprechende Empfehlungen mit
auf den Weg zu geben.
In diesem Sinne awdh auf den Bändern – und dies wie gewohnt von Mensch zu Mensch!
Ihr Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Heraus aus der Komfortzone
In der Region Berlin/Brandenburg, in der ich seit Jahrzehnten arbeite, wohne und einen großen Teil meiner Freizeit verbringe, kenne ich mich gut aus. Das dachte ich zumindest, bis ich vor einigen Jahren ein für mich reizvolles Diplomprogramm entdeckte.
IOTA (Islands On The Air) und SOTA (Summits On The Air) werden viele bereits kennen. Da Inseln und ausreichend hohe Berge in meiner eher flachen, von Seen und Flüssen geprägten Gegend aber nicht vorhanden sind, konzentriere ich mich auf das DLFF-Programm. DLFF ist die Bezeichnung für ein Flora- und Fauna-Gebiet in Deutschland.
Unter dem Dach der WWFF (World Wide Flora and Fauna in Amateur Radio) haben sich Enthusiasten aus vielen Teilen der Welt zusammengeschlossen. Die Ziele beider Programme sind identisch: Man bezweckt mit der Herausgabe von Diplomen, Funkamateure zum Betrieb aus Naturschutzgebieten, Flora-Fauna-Habitaten und Natura-2000-Gebieten zu bewegen. Da zu jeder Funkverbindung stets zwei Partner gehören, werden die globalen und nationalen Diplome sowie die Trophäen jeweils für Aktivierer und sogenannte Jäger herausgegeben.
So gibt es in den bei den eingangs genannten Bundesländern bereits 166 für das DLFF-Programm zählende Gebiete, darunter elf Naturparks, drei Biosphärenreservate und sogar einen Nationalpark. Die höchste, vor ein paar Tagen in Deutschland vergebene Referenznummer ist die 1170. Ein lohnendes Ziel dürfte somit quasi immer in der Nähe erreichbar sein, egal wo man sich befindet und in welche Richtung es geht.
Obwohl ich kein ausgesprochener Diplomsammler bin, begeistert mich das DLFF-Programm. Mein Hauptgrund für die Teilnahme ist, unbekannte Gegenden kennenzulernen. Wie bei jeder Funkaktivität habe ich mir auch bei DLFF-Aktivierungen zu eigen gemacht, diese gewissenhaft vorzubereiten, denn das erspart Enttäuschungen vor Ort. Um die Grenzen der in der zweimal im Jahr erweiterten DLFF-Referenzliste aufgeführten Gebiete mit guten topografischen Karten in Einklang zu bringen, war bisher relativ viel Arbeit erforderlich. Seit Kurzem gibt es mit dem ab S. 356 beschriebenen Overlay für Google Earth eine effektivere Möglichkeit der Vorbereitung und Orientierung vor Ort.
Zu einer Aktivierung gehört für mich, bereits im Vorfeld Informationen über das anvisierte Gebiet einzuholen. Außerdem sehe ich mir die Gegend, in der ich aktiv bin, vor oder nach dem Funken stets näher an. Dadurch ist jede getätigte Funkverbindung mehr als nur eine Zeile im Logbuch. Und obwohl man in Naturschutzgebieten weder die Wege verlassen noch irgendwelche Baumaßnahmen durchführen darf, habe ich bisher immer ein Plätzchen am Wegesrand gefunden, das sich zum Aufbau der Funkstation eignet. Der dabei eher improvisierte Antennenaufbau zählt für mich ebenso zum Experimentalfunk wie die Auswahl eines passenden Funkgeräts und dessen Stromversorgung.
Ganz nebenbei ergibt sich die Möglichkeit, dem in der Regel innerhalb von Städten immer vorhandenen Störnebel zu entgehen. Das Verlassen des zumeist bequem und komfortabel eingerichteten heimischen Shacks hat somit auch Vorteile, selbst wenn man sich Gedanken über die Größe der Funkstation sowie deren Transport und Stromversorgung machen muss.
73/44 de Ingo Meyer, DK3RED/P
Alarmstufe Rot
„Erneut Zero-Day-Lücke in Browser gefunden, Exploit bereits verfügbar“, „Unternehmen gehackt, Kundendaten entwendet“, „Spionagesoftware in Produkt gefunden“, „Datenleck größer als bisher zugegeben, medizinische Daten ebenfalls betroffen“, „Vertrauliche Dokumente im Darknet zum Verkauf angeboten“ … so oder ähnlich lauten fast täglich Schlagzeilen zum Thema Datensicherheit in den einschlägigen IT-Fachpublikationen.
Im Sichtbereich der normaler Internet-Nutzer tauchen derartige Meldungen nur in den seltensten Fällen auf. Zumeist erst dann, wenn es ein großes Unternehmen erwischt hat und in den tagesaktuellen Medien darüber berichtet wird oder man unmittelbar selbst betroffen ist. Sei es, weil die Stadtverwaltung oder ein kommunaler Dienstleister gehackt wurde und es über einen längeren Zeitraum zu Beeinträchtigungen der Versorgung kommt. Oder weil eines der vielen modernen Gadgets, die unseren Alltag bestimmen, wie Smartphones, Streaming-Boxen, Spielekonsolen, Kühlschränke mit Internetanbindung oder die angeblich intelligenten Haustürkameras, nicht mehr wie vorgesehen funktioniert.
Auch das just vor Drucklegung dieser FA-Ausgabe vom Bundeskriminalamt veröffentlichte „Bundeslagebild Cybercrime 2023“ zeichnet ein düsteres Bild. Dessen zentrale Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die Anzahl der Straftaten im Bereich Cyberkriminalität liegt weiterhin auf einem hohen Niveau. Insbesondere bei solchen, die zu Schäden in Deutschland führen, aber aus dem Ausland oder von einem unbekannten Ort aus verübt werden. Diese sogenannten Auslandstaten steigen seit ihrer erstmaligen separaten Erfassung im Jahr 2020 kontinuierlich an – 2023 um 28 % gegenüber dem Vorjahr – und übertreffen somit erneut die Inlandstaten, die auf einem hohen Niveau stagnieren – 134407 Fälle im Jahr 2023, –1,8 % gegenüber dem Jahr 2022. Der dabei entstehende wirtschaftliche Schaden ist immens. Laut einer Erhebung des Branchenverbandes Bitkom e. V. bezifferten sich die durch Cyberattacken verursachten gesamtwirtschaftlichen Schäden allein in Deutschland auf 148 Milliarden Euro. Da tröstet es dann kaum, dass die Aufklärungsquote bei derartigen Delikten gegenüber dem Vorjahr um drei Prozentpunkte gestiegen ist und nun bei 32,2 % liegt.
Dabei ist es jedoch wichtig anzumerken, dass der genannte Lagebericht nur Cyberkriminalität im engeren Sinne betrachtet, also lediglich Taten, die gegen das Internet, andere Datennetze, informationstechnische Infrastruktur und Systeme oder deren Daten gerichtet sind. Cyberstraftaten im erweiterten Sinne, bei denen Informationstechnologie eingesetzt wird, wie Onlinebetrug, Cyberstalking sowie die Verbreitung von Kinderpornografie, bleiben im „Bundeslagebild Cybercrime 2023“ unberücksichtigt.
Gegen Cyberangriffe von zumeist staatlichen oder zumindest staatsnahen Akteuren, insbesondere in einer Zeit der vielfältigen geopolitischen Krisen und Konflikte in Europa und weltweit, können wir als Privatpersonen, die von diesen Attacken in Mitleidenschaft gezogen werden, nur sehr wenig bis gar nichts tun. Anders sieht es bei der Gefahr durch gewöhnliche Cyberkriminelle und allzu neugierige Anbieter von IT-Dienstleitungen aus, die unsere persönlichen Daten ausspähen wollen. Hier kann jeder aktiv werden und das Notwendige für die eigene Sicherheit unternehmen.
Deshalb sieht es die Redaktion als wichtig an, ein Bewusstsein für diese allgegenwärtigen Gefahren und Bedrohungen zu schaffen und aufzuzeigen, wie jeder einzelne einen Beitrag zur Sicherheit seiner Daten und der eigenen Systeme leisten kann. Wir werden uns deshalb in den nächsten FA-Ausgaben mit einigen dieser Themen weitergehend befassen.
Ronny Kunitz
Systemadministrator
IOTA begeistert seit 60 Jahren
Ein Diplomprogramm, das im 60. Jahr seiner Existenz noch immer Hunderte Funkamateure weltweit dazu animiert, Punkte zu sammeln und zu verteilen, hat zweifellos bewiesen, dass es beliebt und aktuell ist. Ich spreche von Islands On The Air, kurz IOTA.
Das Inseldiplom blickt auf eine interessante und wechselvolle Geschichte zurück. Am Anfang stand die Idee des KW-Hörers Geoff Watts, dann übernommen vom britischen Amateurfunkverband RSGB, zeichnet jetzt die IOTA Ltd. dafür verantwortlich. Seit den RSGB-Tagen ist IOTA bis heute eng mit dem Namen Roger Balister, G3KMA, verbunden.
Ein Blick in die eigene QSL-Kartensammlung zeigt, dass spätestens Anfang der 1990er-Jahre die aufgedruckte Referenznummer sowie das IOTA-Logo mit der Palme und der RSGB-Raute immer präsenter wurden. Von Großbritannien ausgehend fand IOTA in aller Welt Freunde und mancherorts eine engagierte Fangemeinde. So auch bei uns in Deutschland.
Dabei ist das Regelwerk, ähnlich wie beim Platzhirsch DXCC, nicht gerade einfach. Aber vielleicht macht gerade dies einen Teil des Reizes aus. Ein weiterer Aspekt ist die Möglichkeit für Insel-DXpeditionäre, Abenteuer und Außergewöhnliches erleben zu können. Um eine Insel „in die Luft zu bringen“, muss man oft gar nicht weit reisen.
Die ganz seltenen und schwer zu aktivierenden Riffe oder Felsen der „Rockall-Klasse“ verlangen mitunter mehr Kraft und Einsatz als seltene DXCC-Gebiete.
Letztere zählen gelegentlich auch für IOTA und die beiden großen Diplomprogramme treffen sich dann zu beiderseitigem Nutzen. Längst erhalten IOTA-DXpeditionen finanzielle Unterstützung, ohne die man einsame und mitunter lebensfeindliche Inseln als Funkamateur niemals betreten hätte. Auf der anderen Seite haben wir die großen Inseln mit dort permanent ansässigen Funkamateuren, die wohl in jedem Log eines Inselsammlers auftauchen.
Dazwischen befindet sich das eigentliche IOTA-Kapital. Es sind Hunderte Inseln und Inselgruppen, die es zu aktivieren gilt. Sie sind das, was wir als „semi-rare“ bezeichnen: nicht so richtig selten, von DX-Stiftungen nicht gefördert und trotzdem bei vielen IOTA-Teilnehmern noch nicht bestätigt. Solche Inseln werden durch zahlreiche kleine DXpeditionen mit oft erheblichem Aufwand und Engagement oder einfach quasi nebenbei im Urlaub aktiviert. Das ist es, was dieses Diplomprogramm am Leben hält und ihm neue Interessenten zuführt. Dabei werden die meisten Punkte für das IOTA-Diplom generiert. Der 60. Geburtstag ist eine gute Gelegenheit, all jenen zu danken, die sich auf den Weg machen und von solchen weniger seltenen Inseln funken.
Zweifellos hat uns die noch nicht lange zurückliegende Corona-Pandemie einen gewaltigen Dämpfer in Bezug auf DXpeditionen beschert. Wir haben uns gerade davon erholt und dank der guten Ausbreitungsbedingungen des 25. Sonnenfleckenzyklus sind auf den Bändern wieder allerhand DX- und IOTA-Stationen zu erreichen.
Dennoch sind die IOTA-Aktivitäten hinsichtlich ihrer Anzahl noch nicht wieder an jenem Punkt, an dem sie sich vor der Pandemie befanden. 60 Jahre IOTA stehen 2024 im Mittelpunkt der Amateurfunkmesse Ham Radio und auch vieler kleiner Funkaktivitäten. Ich hoffe sehr, dass daraus ein Impuls entsteht, der zusätzliches Interesse bei IOTA-Sammlern und -Aktivierern weckt.
Enrico Stumpf-Siering, DL2VFR
„N“ bestanden – doch wie gehts weiter?
Jahrelang haben wir neidvoll auf Länder geschaut, die es dem Nachwuchs mit dem Einstieg in den Amateurfunk besonders einfach machen. Seit dem Inkrafttreten der novellierten Amateurfunkverordnung Ende Juni sind die Bedingungen dafür in Deutschland ähnlich günstig. Das beharrliche Ringen des Runden Tischs Amateurfunk (RTA) um eine neue Einsteigerklasse hat letztlich zum Erfolg geführt. So haben wir neben etlichen positiven Änderungen für die bereits bestehenden Klassen A und E nun endlich die ersehnte N-Klasse. Nicht nur der DARC e.V. hat große Hoffnungen, mit jungen Leuten der Überalterung seiner Mitglieder entgegenzuwirken.
Entsprechend groß ist das Engagement zur Erreichung dieses Ziels. Ein Team um Dr. Matthias Jung, DL9MJ, hat einen zeitgemäßen Fragenkatalog für die Prüfung zur Klasse N zusammengestellt, der in erweiterter Form beim DARC-Verlag als Lehrbuch erschienen ist. Michael Reichardt, DL2YMR, hat eine Serie von Videos zu den einzelnen Lektionen produziert und als Kurs auf Youtube veröffentlicht.
Die Lernplattform www.50ohm.de und die gratis nutzbare App 50Ohm-pocket bieten nicht nur einen Online-Lehrgang, sondern neben anderem auch eine Liste erfahrener Funkamateure, die Funkinteressierten und Neueinsteigern Hilfestellung geben. Der Fragenkatalog, ohne erläuternde Worte, steht auf der Website der BNetzA kostenlos zum Herunterladen bereit.
Beste Bedingungen, zumindest was die Prüfungsvorbereitung betrifft. Das eigentliche Problem, nämlich dass unser Hobby nicht mehr die Anziehungskraft wie früher besitzt, ist damit aber nicht gelöst. Der Amateurfunk hat im Laufe der Zeit immens an Attraktivität verloren: Weltweit kommunizieren, Bilder, Videos oder andere Daten übertragen, das kann heute jeder – ohne Prüfung, ohne besonderen Aufwand und in höchster Qualität.
Die Erkenntnis, dass der Amateurfunk eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist, müssen wir dem potenziellen Nachwuchs vermitteln und dazu alle sich bietenden Gelegenheiten nutzen. Das ist in schulischen Arbeitsgemeinschaften, bei den Pfadfindern, bei THW-Vorführungen oder vielen anderen Gelegenheiten möglich.
Wenn das Rufzeichen erteilt ist, kann es dann endlich losgehen. Die Beschränkungen in Bezug auf nutzbare Bänder und zulässige Sendeleistung können aber sehr schnell zu Frustration führen. Mit einem 5-W-VHF/UHF-Handfunkgerät erreicht man wahrscheinlich aus der Wohnung noch den nächstgelegenen Repeater. Aber was, wenn man über diesen CQ ruft und niemand antwortet? Oder wenn zwei Nutzer dort schier endlos plauschen und selbst auf einen Zwischenruf nicht reagieren?
Hier sehe ich unsere gemeinsame Verantwortung. Wir müssen es schaffen, dass die Neuen positive Erfahrungen machen und den Spaß an ihrem neuen Hobby nicht verlieren. Nur dann nämlich kann ein junger Funkamateur anderen von seinen Erfolgen erzählen und zum Multiplikator werden.
Die Weichen sind gestellt, die Rahmenbedingungen günstig wie nie. Es liegt jetzt an uns Middle- und Oldtimern, ob die Neuen zu aktiven Funkamateuren werden, die ihr Leben lang für den Amateurfunk brennen. Besonders am Anfang dieses Wegs benötigen sie vielfältige Unterstützung. Es kann sein, dass der eine einen Tipp braucht, wie er eine unauffällige Antenne am Balkon anbaut, oder dass dem anderen schlichtweg ein passendes Koaxialkabel fehlt. Und schaut doch einmal im Shack nach, ob dort nicht noch ein ungenutzter Transceiver herumsteht, den man einem Newcomer ausleihen oder sogar schenken könnte.
Auch wenn die Neuen nicht alles gleich so machen, wie wir Alten es uns vorstellen – seid freundlich zu ihnen und helft, wo immer Ihr könnt.
Ingo Meyer, DK3RED
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Das letzte Heft
Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich der FUNKAMATEUR aus dem Angebot des Zeitschriftenhandels. Dies geschieht nicht – wie man vielleicht vermuten könnte – aus wirtschaftlichen Erwägungen, denn der Verkauf über etwa 1700 Verkaufsstellen in acht Ländern – von der großen Bahnhofsbuchhandlung bis zum kleinen Lottoladen – ist nach wie vor profitabel.
Was den Verlag dazu bewogen hat, ist die Notwendigkeit, Schluss zu machen mit der Verschwendung von Ressourcen. Tonnen von Papier zu produzieren, das farbig bedruckt über hunderte Kilometer transportiert wird, um letztlich zu zwei Dritteln im Altpapier zu enden, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Jetzt, wo Pandemie und Krieg die Inflation antreiben und die energiehungrigen Papierfabriken sowie die Speditionen ihre Preise immer weiter erhöhen, ist der Zeitpunkt gekommen, eine lange aufgeschobene Entscheidung umzusetzen: Wir drucken keine Hefte mehr, die vier Wochen später zu Tausenden recycelt werden müssen. Der Verkauf über den Einzelhandel ist passé.
Während sich für unsere Abonnenten nichts ändert, sollten Hin-und-wieder-Käufer jetzt handeln. Sie können beispielsweise ein Flex-Abonnement bestellen, bei dem ihr Heft pünktlich und portofrei im Briefkasten landet. Dieses kostet den aufgedruckten Heftpreis von 5,70 €, der erst nach der Zustellung monatlich bequem per Bankeinzug zu bezahlen ist. Und damit der Flex-Abonnent wirklich flexibel ist, kann diese Abovariante jederzeit gekündigt oder zeitweilig ausgesetzt werden.
Für diejenigen, die schon immer mit einem Abonnement liebäugeln, haben wir bis Ende Januar einen "roten Teppich" ausgerollt, der von kleinen Prämien gesäumt ist, die die Entscheidung, endlich Abonnent zu werden, befördern sollen. Neben unserem PLUS-Abo, bei dem Sie außer den gedruckten Ausgaben auch eine Jahrgangs-CD und einen Download-Key für das Herunter-laden des PDFs bekommen, bieten wir auch ein günstigeres "Nur-Print-Abo" an, das Sie auf www.funkamateur.de bestellen können.
Und dann wäre da noch eine gute Nachricht: In den nächsten Tagen wird die neue FUNKAMATEUR-App bei Google Play und im Apple-App-Store zur Verfügung stehen. Unsere PLUS-Abonnenten haben über diese Zugriff auf das ePaper, das sie online oder offline auf dem Tablet oder Smartphone lesen können. Gleichzeitig veröffentlichen wir eine Browser-Version für PCs. Gelegenheitsleser können in der App einzelne Ausgaben – das Angebot reicht bis ins Jahr 2002 zurück – als ePaper kaufen oder ein ePaper-Abo für sechs oder zwölf Monate abschließen.
Unsere Idee aus dem Jahr 2021, anstelle der Jahrgangs-CD einen Download-Key für das Jahrgangs-PDF zu liefern, hat sich übrigens nicht als tragfähig erwiesen, da der Download von den Lesern nicht wie erwartet akzeptiert wurde. Die gleiche Erfahrung hat auch der VTH machen müssen, der in den vergangenen beiden Jahren zu den Heften "Software für den Funkamateur" keine DVD mehr mitgeliefert hatte, sondern lediglich einen Download anbot. Weil darunter der Verkauf stark litt, ist bei der aktuellen 2023er-Ausgabe wieder ein Datenträger dabei.
Für unsere PLUS-Abonnenten werden wir also auch in Zukunft eine Silberscheibe herstellen und jeweils mit der Januar-Ausgabe des Folgejahrgangs ausliefern. Daneben versenden wir an sie einen Download-Key, mit dem auch jene PLUS-Abonnenten an ihr PDF kommen, deren PC oder Notebook kein optisches Laufwerk mehr hat. Auf der DVD 2022 befindet sich der Jahrgang 2021 als Zugabe. Schließlich wollen wir niemandem etwas schuldig bleiben.
In diesem Sinne alles Gute für 2023.
Knut Theurich, DG0ZB
Unser aller Projekt
Die nahe der Antarktis gelegene unbewohnte Insel Bouvet, Präfix 3Y, ist einer der einsamsten und unzugänglichsten Orte der Welt. Wenn diese Ausgabe des FUNKAMATEUR erscheint, befindet sich das Team einer großen internationalen DXpedition per Schiff auf dem Weg dorthin; Rufzeichen 3Y0J. Mehrere Vorhaben, die fast vollständig von Eis überzogene Insel auf den Amateurfunkbändern zu aktivieren, waren in den vergangenen Jahren im letzten Moment gescheitert – teils bereits in Sichtweite zum Ziel.
Bouvet gehört hierzulande zu den Top 3 auf der Liste der von den DXern meistgesuchten DXCC-Gebiete. Vorausgesetzt, dem Team gelingt die schwierige Landung auf Bouvet, werden daher die zu erwartenden immensen Pile-ups die Kurzwellenbänder für die Dauer der DXpedition regelrecht zum Kochen bringen. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass die Bouvet-Fahrer, allesamt sehr erfahrene DXer und DXpeditionäre, jederzeit Herr der Lage sein werden – zumindest auf den Bändern. Die Hoffnung besteht, dass auch die Landung auf der Insel sowie der knapp dreiwöchige Aufenthalt dort weitgehend wie geplant verlaufen und die jahrelangen gründlichen Vorbereitungen die erhofften Resultate bringen.
Ein Projekt wie dieses ist auch ein finanzielles Abenteuer. Jeder Teilnehmer der DXpedition hat zur Finanzierung des Gesamtbudgets in Höhe von 715000 US-$ aus eigenen Mitteln den Gegenwert eines Kleinwagens beigetragen. Hinzu kommen finanzielle Zuwendungen durch DX-Stiftungen, darunter die German DX Foundation. Aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder werden nach sorgfältig festgelegten Richtlinien ausgewählte DXpeditionen unterstützt. Neben individuellen Spenden direkt an die DXpedition beteiligen sich auf dem Weg über die DX-Stiftungen also zahlreiche weitere Funkamateure und ermöglichen dadurch erst deren Durchführung.
3Y0J ist auch dadurch weitaus mehr als die DXpedition eines internationalen Teams wagemutiger Funkamateure, es ist unser aller Projekt. Bleibt zu hoffen, dass sich die große Mehrheit der DXer in den Pile-ups daran erinnert und sich entsprechend fair verhält; es gilt der DX Code of Conduct. Mit guter Betriebstechnik, wozu ein sorgfältiges Beobachten der Pile-ups gehört, werden es auch viele 100-W-Stationen ins Log von 3Y0J schaffen. Die zu erwartenden guten Ausbreitungsbedingungen insbesondere auf den hohen Bändern der Kurzwelle helfen uns dabei. Mithilfe von Pilotstationen in den wichtigsten Zielgebieten werden die Signale von 3Y0J voraussichtlich weltweit gut aufzunehmen sein.
Während ich diese Zeilen am Vormittag des 12.1. schreibe, befindet sich das Team der Bouvet-DXpedition an Bord eines Flugzeugs der Royal Air Force von Großbritannien zu den Falklandinseln. Nach einem Tankstopp auf den Kapverden ist die Ankunft des Fluges RR2300 auf dem Flughafen Mount Pleasant nahe der Inselhauptstadt Stanley gegen 1700 UTC des Tages geplant. Im dortigen Hafen geht das Team nach dem Verladen der Ausrüstung an Bord der polartauglichen Segelyacht "Marama", bevor die Überfahrt nach Bouvet beginnt. Möglicherweise ist man während dieser Zeit bereits maritim mobil aktiv.
Die Ankunft auf der Insel ist um den 26.1. geplant, abhängig von den Wetterbedingungen. Nach der Landung und dem Aufbau der Stationen folgt mindestens drei Wochen lang rund um die Uhr Funkbetrieb unter 3Y0J.
Die Redaktion FUNKAMATEUR wünscht dem Team 3Y0J eine erfolgreiche DXpedition und eine gesunde Heimkehr.
Harald Kuhl, DL1AX
Funkverbindung im Notfall
Als 2016 der damalige Bundesinnenminister Pläne für den Katastrophenschutz vorstellte und jedem Haushalt riet, einen Notvorrat anzulegen, nahm dies kaum jemand ernst. Sogar von grundloser Panikmache war die Rede. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2023 und die Spötter von damals sind verstummt. Naturkatastrophen, Sabotageakte und ein Krieg in Europa haben die real existierenden Gefahren für unsere Infrastruktur und unser friedliches Leben nach und nach zurück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt.
Über das Thema Krisenvorsorge wird inzwischen mit aller Ernsthaftigkeit gesprochen und in den Medien berichtet. Landkreise, Städte und Kommunen überarbeiten Notfallpläne und schaffen entsprechende Organisationsstrukturen. Dabei wird deutlich, dass die Ressourcen der Behörden und staatlichen Institutionen sehr begrenzt sind. Sie werden für die Aufrechterhaltung der eigenen Arbeitsfähigkeit verwendet und dienen in erster Linie dazu, den Schwächsten der Gesellschaft zu helfen, also z.B. den Alten und Kranken in Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Alle anderen Bürgerinnen und Bürger sollten davon ausgehen, für längere Zeit auf sich gestellt zu sein.
Als eines der bedrohlichsten Szenarien gilt derzeit ein flächendeckender, langanhaltender Stromausfall. In einer solchen Situation wird jeder zunächst selbst dafür sorgen müssen, sich und seine Familie mit Lebensmitteln und Wasser zu versorgen sowie ggf. die Heizung am Laufen zu halten. Dies setzt ausreichende Vorräte und Notfallutensilien in jedem Haushalt voraus. Das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz (BBK) hat dazu auf seiner Website www.bbk.bund.de entsprechende Empfehlungen veröffentlicht.
Ohne Strom fallen Telefon und Internet als Kommunikationsmittel schnell aus. Erneut ist mit behördlicher Hilfe kaum zu rechnen, weshalb es vereinzelt vorbildliche Initiativen gibt, einen "Bürgernotfunk" für solche Fälle zu organisieren (siehe FA 1/23, S.69).
Funkamateure wissen jedoch, wie man netzstromunabhängig Funkverbindungen herstellt und betreibt. Die meisten besitzen auch die dafür erforderliche Technik. Aus vielerlei Gründen lässt sich damit aber kein Not- und Katastrophenfunk für Behörden und Hilfsorganisationen sicherstellen, von punktueller Unterstützung abgesehen. Als Selbstverständlichkeit sollte aber die Nachbarschaftshilfe gelten, etwa bei der Nutzung von Jedermann-Funkgeräten durch Nicht-Funkamateure und generell in Fragen der Kommunikation.
Eine behelfsmäßige Nachrichtenübermittlung vor Ort dürfte in den meisten Fällen möglich sein. Hier ist es von Vorteil, dass es in jeder Region Deutschlands Funkamateure gibt. Dort, wo in vorausschauender Weise die nahe gelegene Relaisfunkstelle mit einer stabilen Notstromversorgung ausgerüstet ist, wäre der Betrieb eines lokalen VHF/UHF-Notfunknetzes möglich. Damit ließe sich auch über größere Entfernung mittels Hand- und Mobilfunkgeräten Kontakt zu anderen Funkamateuren halten, um Informationen auszutauschen und Hilfe zu organisieren.
Zur Unterstützung des Aufbaus solcher örtlichen Notfunknetze plant der FA-Leserservice, den in der vorliegenden Ausgabe vorgestellten FM-Crossband-Repeater als Bausatz anzubieten. Dieser ist als gemeinschaftliches Selbstbauprojekt gut geeignet. Der Repeater enthält einen 2-m-Empfänger und einen 10-W-Sender für das 70-cm-Band. Als Stromversorgung dient ein solar-gepufferter 12-V-Akkumulator.
Auch hier gilt: Gute Vorbereitung und Organisation können im Ernstfall Leben schützen und zur Schadensbegrenzung beitragen.
Peter Schmücking, DL7JSP
Kein Contest – nur Bandrauschen?
Noch vor einer Dekade war er das ewige Thema derjenigen, die sich beschwerten über "jedes Wochenende, an denen die Bänder mit Contests überzogen wurden", an denen man nicht mehr "in Ruhe normale QSOs fahren konnte" – der Niedergang des Amateurfunks durch die Verrohung der Sitten wegen des ungezügelten Contestens. Er wurde herbeigeschrieben oder herbeidiskutiert.
Ein Blick in den Rückspiegel des Amateurfunks zeigt uns aber, dass die Idee der Contests einen anderen Ursprung hatte als ausschließlich den, die vielbesungenen Klön-QSOs unmöglich zu machen. Die Lektüre von entsprechenden Ausschreibungen aus den 70er-, 80er- und sogar noch 90er-Jahren zeigt, dass dort die Formulierung "zur Erhöhung der Bandaktivität veranstaltet die XYZ-Interessengemeinschaft den ZYX-Contest" stets wiederkehrend zu finden ist. Aha, merkt der Chronist an, das Contesten hatte die Idee der Bandbelebung! Soso.
Im UKW-QTC dieser Ausgabe des FUNKAMATEUR lesen Sie Gedanken von Stefan, LA0BY, zu den Themen FT8, Tropo-Überreichweiten, Aktivität und NAC, die zeigen, dass sich die Funkaktivitäten unserer Gemeinde auch auf UKW häufig auf das Beobachten und das Benutzen von zwei oder drei "Kanälen" pro Band reduzieren, auf denen sich der Digitalfunk etabliert hat. Der ursprüngliche Gedanke der Weak-Signal-Modes, Funkverbindungen mit kleiner Leistung und/oder beschränkten Antennen zu ermöglichen, ist der dem Menschen in die Wiege gelegten Bequemlichkeit gewichen, schnell irgendein QSO zu machen. Ein Mausklick auf eine Linie im Wasserfall ist eben einfacher als das Drehen an einem VFO bei gleichzeitigem Einschalten der eigenen Ohren.
Auf diese Weise haben sich viele QSOs vom SSB- oder CW-Bereich auf die oben genannten paar Kanäle verlagert. Bei durchschnittlichen Bedingungen hört man sogar auf den unteren Bändern wie 80 m und 40 m zwischen den allgegenwärtigen Runden richtiges Bandrauschen. Ob diese Entwicklung nun positiv ist, ob sie das vielzitierte Ende des Amateurfunks bedeutet oder ob wir wegen der weniger benötigten Bandbreite Bänder oder Teile des bislang von uns genutzten Frequenzspektrums verlieren, wird die Zukunft zeigen. Belebung bringen da in jedem Falle die Contests oder Aktivitätswettbewerbe.
Um jedoch hin und wieder einmal das gute alte Mikrofon zu benutzen oder die Morsetaste zu schwingen, bieten Wettbewerbe eine gute Abwechslung vom Klicken. Es müssen ja nicht gleich 36 Stunden Dauerbetrieb in einer der CQWW-Meisterschaften oder einem WAE sein. Die große Zahl an Regionalausscheiden, z.B. in der IARU-Region 1, eröffnet ein weites Betätigungsfeld. Und dann begann ja im März die UKW-Contest-Saison, bei der man jetzt schon auf die neuen Auswertungen in einer 100-W- bzw. einer 6-h-Sektion gespannt sein darf. Auch unter der Woche erfährt die Bandbelebung durch zahlreiche Kurzwettbewerbe einen Schub. Bestes Beispiel ist der OK1WC-Memorial-Ausscheid in CW, jeden Montagabend auf den Bändern 40 m und 80 m. Der FUNKAMATEUR bietet auf seiner Website in der Rubrik Aktuelles eine Liste mit anstehenden Funkwettbewerben, QSO-Partys usw. Die meisten Logprogramme verfügen außerdem über einen Contestmodus, mit dem sich die vom Auswerter geforderten Logformate einfach erzeugen lassen.
Liebe Leser, die früher viel geschmähten Contests bieten eine willkommene Abwechslung, sich nicht nur der Bildschirmlektüre oder dem Bandrauschen hinzugeben. Und auch wenn Sie nicht aktiv teilnehmen, hören Sie mal rein und verteilen Sie an die hochmotivierten Aktivisten wenigstens ein paar Punkte – egal in welchem Wettbewerb.
73 es awdh im nächsten Contest.
Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS
Ein halbes Jahrhundert mit dem "Handy"
Vor über 50 Jahren, am 3. April 1973, rief Motorola-Ingenieur Martin Cooper seinen Konkurrenten, den AT&T-Technikchef Joel Engel, mit dem soeben von ihm entwickelten ersten tragbaren Mobiltelefon an: dem DynaTAC 8000X, 1 kg schwer, 25 min Akkumulatorlaufzeit. Schon dieser erste "Handy"-Anruf löste beim Angerufenen keine Freude aus – AT&T hätte zu gerne selbst das erste Hand-Funktelefon entwickelt. Es dauerte noch ein halbes Jahr bis zum Patent und gut zwanzig Jahre, bis der legendäre "Knochen" mit halber Masse und dreifacher Laufzeit für das deutsche D-Netz als Motorola 3200 auf den Markt kam.
Es folgten das MicroTAC mit patentierter "Klappe" und nur noch 245 g schwer, bei dessen Benutzung in der Öffentlichkeit anfangs jeder nach der Kamera für den vermeintlichen Filmdreh Ausschau hielt. Es lehnte sich im Design an den Communicator aus der Fernsehserie "Star Treck" an; das StarTAC tat dies noch mehr, auch namentlich, und war leichter als 100 g.
Inzwischen stieg Nokia auf, ein ehemaliger finnischer Papierhersteller. Auch hier gab es 1996 in Anlehnung an Star Trek einen Communicator. Er war das erste Smartphone, mit dem man nun auch mobil faxen und online gehen konnte. So richtig setzten sich die Smartphones aber erst durch, als Apple beim ersten iPhone 2007 die Tastatur durch einen Touchscreen ersetzte und die Gestensteuerung einführte. Mit dem Aufklappen des Communicators war es nun vorbei – seitdem wird "gewischt".
Wer heute in der Bahn noch ein Buch liest, wird verwundert angeschaut und es gibt mittlerweile mehr Mobiltelefone als Menschen. Da manche Nutzer nicht nur beim Mittagessen, sondern auch beim Überqueren der Straße oder beim Autofahren den Blick nicht vom Smartphone lassen können, reduziert sich ihre Anzahl zum Leidwesen von Martin Cooper infolge seiner Erfindung mitunter.
Und die Telefongespräche? Die sind bei jüngeren Nutzern ohne vorherige Anmeldung inzwischen unerwünscht. Es wird nur noch getippt, leider ohne echte Tastatur. Zugegeben, Anrufe waren für Redakteure mitunter eine Plage, wenn sie im unpassenden Moment kamen, und schon Anfang der 1990er-Jahre zog ich beim Heimkommen – damals noch verbotenerweise – als erstes das Telefon aus seiner Dose, weil ich längst "leergequasselt" war. Eine Rufweiterleitung auf mein Mobiltelefon entfernte ich nach wenigen Tagen angesichts der Masse an mir bislang gar nicht bewusst gewordenen Werbeanrufen wieder und auf gewisse Orte nahm ich auch nie ein Telefon mit.
Ein "Handy" aus der Hand zu legen oder gar abzuschalten, war noch nie verboten. Deshalb halten Sie es ruhig mit Peter Lustig, der am Ende seiner Fernsehsendung ohne Rücksicht auf die Quote den Kindern riet: "Und jetzt? Richtig – abschalten!".
Übrigens: Bei uns in der Redaktion dürfen Sie noch ohne Vorankündigung anrufen.
Wolf-Dieter Roth, DL2MCD
FUNK.TAG: Endlich wieder von Angesicht zu Angesicht!
Rekorde sind besonders dann schön, wenn man nicht unbedingt nach
ihnen gegiert hat. Nach drei Jahren Corona-Zwangspause waren wir beim
DARC e.V. schon froh darüber, endlich wieder einen FUNK.TAG in Kassel
veranstalten zu dürfen. An der großen Zahl der Anmeldungen für den
Wohnmobilstellplatz konnten wir bereits ablesen, dass unsere Messe gut
besucht werden würde. Dass wir aber mit 2600 Besucherinnen und Besuchern
mit der fünften Ausgabe einen Rekord aufstellen würden, damit hatten
wir nicht gerechnet, und darüber habe nicht nur ich mich überaus
gefreut.
Was mich noch mehr begeistert hat als die nackte Zahl,
das war die Stimmung beim FUNK.TAG. Überall war zu spüren – und oft auch
direkt zu hören, wie groß bei Besuchern und Ausstellern die Vorfreude
auf den Tag war, und wie groß dann die Freude über den Tag war. Wer
geglaubt hatte, dass die Möglichkeiten der Kommunikation über
Onlinekonferenzen etc. mehr als nur ein notdürftiger Ersatz für den
realen Kontakt sind, der dürfte in den Kasseler Messehallen eines
Besseren belehrt worden sein. Wir Funkamateure sind es ja gewohnt,
unseren Gesprächspartnern nicht gegenüberzusitzen. Aber wie wichtig der
persönliche Austausch von Angesicht zu Angesicht ist, dass hat der
FUNK.TAG eindrücklich gezeigt.
Es gab aber auch so unendlich viel
zu entdecken: rund 50 ideelle, institutionelle und kommerzielle
Aussteller, etwa 100 Flohmarktstände, spannende Gäste wie den hessischen
Landtagsabgeordneten Florian Schneider. Neue Technik, neue Gesichter in
unserer Gemeinschaft. Dazu tolle Programmpunkte wie der Livekontakt
mit Neumayer III oder die Vorträge namhafter Fachleute. Besonders
gefreut hat mich die wunderbare Resonanz auf unser Shuttle-Angebot zur
DARC-Geschäftsstelle in Baunatal. So konnten sich viele Besucher davon
überzeugen, über welch ein gutes Konferenz- und Seminarzentrum wir
Funkamateure in Deutschland unter dem weißen Turm verfügen.
Nach
dem FUNK.TAG haben wir von vielen Seiten Rückmeldungen bekommen, von
Ausstellern, Flohmarktteilnehmern, von den Besuchern. Sie alle waren
sehr angetan. An dieser Stelle gilt es all denen herzlich zu danken, die
für einen solch gelungenen Tag, für ein solches Echo gesorgt haben: den
ehrenamtlich Tätigen, den Mitarbeitern in unserer Geschäftsstelle, den
Ausstellern und natürlich nicht zuletzt den Besuchern!
Nächstes
Jahr – genauer am 27. April 2024 – wird es wieder einen FUNK.TAG in
Kassel geben. Ich bin sicher, dass wir ihn wieder zu einem tollen
Erlebnis machen werden. Und wenn wir dann wieder den Besucherrekord
brechen …
Christian Entsfellner, DL3MBG
Vorsitzender des DARC e.V.
Ich habe mindestens drei Gründe, …
… um auch in diesem Jahr nach Friedrichshafen zur Ham Radio zu fahren. Eigentlich sind es noch einige mehr, denn von der Sache her gibt es ja jährlich für jeden Funkamateur „neue“ Gründe, an einem der größeren Amateurfunktreffen teilzunehmen. Aber die Ham Radio ist anders. Natürlich sind dort potente Händler und partiell sogar Hersteller der von uns verwendeten Geräte vor Ort, doch das allein ist ja nicht das Salz in der Suppe. Insbesondere dann nicht, wenn einige dieser Protagonisten durch Abwesenheit glänzen. Es gibt viele weitere Motive.
Zurück zu meinen drei Gründen. Die erste wesentliche Triebfeder für meine alljährliche Reise zum Bodensee ist das persönliche Treffen mit Gleichgesinnten. Dazu muss man sich weder verabreden noch besonders darauf vorbereiten. Es reicht, einfach da zu sein. Wer mit offenen Augen über die Messe schlendert, begegnet hier und da denjenigen Funkamateuren, die er tagtäglich auf den Bändern trifft, oder deren sinnhafte Technikbeiträge er im Internet, im FUNKAMATEUR oder in der CQ DL verfolgt. Wenn man Glück hat, ist der Vordermann in der Warteschlange der Cafeteria auf dem Messegelände vielleicht Martin, DK7ZB, und man kann, auf einen Becher Kaffee wartend, noch eine Fachfrage wegen einer speziellen Endfed-Antenne oder eines 1:49-Baluns stellen. Wo, außer in Friedrichshafen, bieten sich derlei Möglichkeiten?
Mein zweiter Grund für einen Besuch der Ham Radio ist das Funken. Das klingt erst einmal etwas seltsam, denn ist das nicht die ureigenste Idee unseres Hobbys? Ja, das ist so, und vielleicht ist das eigentliche Funken im herkömmlichen Sinn in den vergangenen Jahren etwas auf der Strecke geblieben. Nun gut, die einfache Verfügbarkeit funktionierender Contest-Software hat für OM Jedermann gerade im Bereich Contest einen Schub ermöglicht, der früher eher undenkbar war. Das Contestreferat des DARC e.V. wird deshalb in diesem Jahr wieder eine kostenfreie Contest University mit dem Hauptaugenmerk auf Einsteiger bzw. wenig erfahrene Teilnehmer ausrichten. Am Stand des Contestreferats des DARC e.V. werden Sie die Möglichkeit haben, sich mit Fragen und Anregungen im direkten Gespräch mit den jeweiligen Managern auszutauschen. Contest ist nicht alles, trägt aber mittlerweile wesentlich zur Bandbelebung und damit zur Bandverteidigung bei!
Und drittens: Bildung tut not! Das messebegleitende Vortragsprogramm
der Ham Radio in den diversen Hörsälen hat im Laufe der Zeit ein
herausragendes Niveau erreicht. Und das bedeutet nicht immer, dass es
Themen sein müssen, deren technische Inhalte dem vielzitierten OM
Waldheini nichts sagen oder die zu abgehoben sind – nein, auch Vorträge
über DXpeditionen und vergleichsweise einfache Antennen- oder
Gerätekonzepte können dem Publikum zu Gehör gebracht werden. Deswegen
mein gut gemeinter Rat: Nehmen Sie sich Zeit, auch einmal einen Vortrag
anzuhören, der Ihren Interessen entspricht. Man wird dadurch nicht
dümmer.
Darüber hinaus fasziniert mich die Urlaubsregion Bodensee und
ich freue mich schon jetzt wieder auf die zwei Wochen, die ich mit
meiner XYL in der Nähe von Lindau verbringen werde, um den Urlaub mit
der Ham Radio zu verbinden.
Auf Wiedersehen in Friedrichshafen!
Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS
Mein erstes Mal
Was für viele ein Traum ist, nämlich ihr Hobby zum Beruf zu machen, lief bei mir genau andersherum: Ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht. Nach fünf Jahren Arbeit als Mediengestalter in der Redaktion des FUNKAMATEUR hatte der Amateurfunkvirus auch mich erwischt. Ich beschloss, mein über diese Zeit angeeignetes Wissen zu testen und unterzog mich einem Online-Test auf www.afup.a36.de. Das Ergebnis war ausbaufähig, also besorgte ich mir die „Moltrechts“ und bestand im März 2022 die Prüfung zur E-Lizenz; im folgenden Oktober erhielt ich meine A-Lizenz.
Nun war ich also Teil der großen, internationalen Amateurfunkgemeinschaft und was lag nach ersten Gehversuchen im Funkbetrieb näher, als auch zum ersten Mal die Ham Radio – Europas größte Amateurfunkmesse – zu besuchen? Meine Erwartungen speisten sich aus den Messeberichten der vergangenen Jahre und den Erzählungen meiner Kolleginnen und Kollegen, und ich darf sagen: Sie wurden übertroffen. Für mich als Neueinsteiger übt es schon eine gewisse Faszination aus, wenn tausende Gleichgesinnte durch die Hallen strömen – bekannte Gesichter, bekannte Rufzeichen wohin man sieht. Trotz des Mottos „Wir machen MI(N)T“, das sich insbesondere der Ausbildung von Jugendlichen widmete, war der Altersdurchschnitt doch eher hoch. Dieser wurde durch die etwa 100 Teilnehmer der Ham Rallye und die YOTA-Preisträger etwas nach unten verschoben.
An den Ständen der kommerziellen Aussteller herrschte teilweise großes Gedränge. Da wurde neue Technik bestaunt, ausprobiert und gefachsimpelt. Und so mancher Funkamateur konnte eines der Messeschnäppchen nach Hause tragen. Auch die Flohmarkthallen schienen eine unendliche Fundgrube zu sein. Bei dem einen oder anderen Anbieter durfte man sich allerdings fragen, worin eigentlich der Bezug zum Amateurfunk bestand.
In den Gängen und an den Messeständen von Verbänden und Vereinen gab es viele herzliche Begegnungen. Endlich konnte ich einige unserer Autoren, Leser und Anzeigenkunden, mit denen ich bisher nur telefonisch oder per E-Mail Kontakt hatte, von Angesicht zu Angesicht kennenlernen.
Die geballte Fachkompetenz dieser Gemeinschaft zeigte sich auch in dem umfangreichen Rahmenprogramm. Hier war es wirklich gelungen, für jeden Geschmack etwas anzubieten. Leider fanden Veranstaltungen, die großes Interesse hervorriefen, wie etwa die Vorträge über endgespeiste Kurzwellen-Drahtantennen von Martin Steyer, DK7ZB, Blitzschutz von Wolfgang Hunger, DL5MM, und über die Rockall-DXpedition von Emil Bergmann, DL8JJ, gemessen am Andrang in viel zu kleinen Räumlichkeiten statt. Manche Zuhörer verbrachten die Zeit notgedrungen stehend oder sitzend auf Tischen bzw. dem Boden oder wurden schlichtweg nicht mehr eingelassen. Dagegen verloren sich die Interessenten einiger weniger gut besuchter Vorträge und Treffen in überdimensionierten Räumen. Ich musste mir übrigens tatsächlich einen Plan machen, um keine der für mich interessanten Vorträge oder Aktionen auf der Bühne im Foyer zu verpassen.
Die QSL-Kartenwand mag für viele ein alter Hut sein, aber mir hat sie gezeigt, mit welchem Stolz man sich hier präsentiert. Selbst an der Uferpromenade im abendlichen Friedrichshafen war der Ham Spirit noch zu spüren – die ganze Stadt schien in der Hand der Funkamateure zu sein.
Ich hoffe, dass mein vielleicht etwas euphorischer Blick und unser Messebericht ab Seite 600 langjährigen Besuchern wieder ins Bewusstsein rufen, was für eine großartige Veranstaltung jedes Jahr am Bodensee organisiert wird. Diese gilt es unbedingt zu erhalten.
In jedem Fall freue ich mich schon auf die nächste Ham Radio!
Heiko Benkenstein, DC2HB
P. S.: … und wenn alles nach Plan läuft, beherrsche ich bis dahin Telegrafie.
Gedanken eines alten weis(s)en Mannes
Die Welt dreht sich heute schneller. Fortschritt, insbesondere im
technischen Bereich, ist für Funkamateure immer reizvoll. Aber manchmal
frage ich mich, ob alles auf dieser Erde immer schneller und
automatischer vonstattengehen muss.
Für mein DXCC-Diplom habe ich
viele Jahre gesammelt. Rückblickend weiß ich: Der Weg war das Ziel. Zu
den ersten hundert Zählern in CW war er steinig, damals in den
1980er-Jahren. Als Mitbenutzer einer 100-W-Klubstation mit Dipol und
äußerst beschränkten Möglichkeiten, „QSL direkt“ zu erhalten, erwies
sich der Übergang in das folgende Jahrzehnt als ein Quantensprung. Nun
aktiv mit Richtantenne und Endstufe sowie mit der Freiheit, Post nach
überallhin senden und empfangen zu können. Da nahm das Bandpunktesammeln
Fahrt auf und erfuhr mit der Einrichtung des „Logbook of The World“
nochmals eine deutliche Beschleunigung.
Kurz nach der
Jahrtausendwende war die Honor Roll in Telegrafie endlich erreicht.
Erneut musste ich mich wieder mehr in Geduld üben, bis eines der sehr
seltenen und noch fehlenden DXCC-Gebiete eine Aktivität erfuhr. Auch
alternative Sammelgebiete wie die Inseln dieser Welt boten nicht mehr so
häufig etwas Neues. Inzwischen ist festzustellen, dass die Telegrafie
tendenziell zu einer bedrohten Sendeart geworden ist. Und um allem die
Krone aufzusetzen, versetzte eine weltweite Pandemie dem DX-Geschehen
kürzlich einen ordentlichen Dämpfer. Aber das haben wir hinter uns.
Neue
technische Möglichkeiten wie FT8 & Co verhelfen nun dem Vernehmen
nach mit viel weniger Aufwand auch deutlich leichter zu zahlreichen
Ländern im Logbuch. Mancher, der früher kaum Chancen auf DX hatte, soll
jetzt daran teilhaben können, sagt man. Das ist zweifellos gut.
Vermutlich wird man so auch viel schneller am Ziel sein. Was kommt
danach?
Dem digitalen Hype konnte ich bislang noch nichts
abgewinnen. Kommt vielleicht noch, wenn die Finger nicht mehr richtig
wollen. Aber im Moment liegt der Spaß noch beim Pile-Up und der
Schwierigkeit, es mittels Morsezeichen im Kopf zu übersetzen. Ganz
nebenbei hält das den alten weißen Mann auch fit. Doch ganz gleich, ob
man übers Band dreht oder ins DX-Cluster schaut: Abgesehen von den
Contest-Wochenenden ist es weit und breit oft verdächtig still auf
unseren Bändern geworden. Dabei bildet das Cluster nicht immer die
Realität ab, was die tatsächlichen Ausbreitungsbedingungen und
DX-Möglichkeiten angeht. Werden wir aktiven analogen Funker immer
weniger?
Deshalb mein Aufruf an alle, die noch da sind: Dreht mal
wieder übers Band, ruft mal selbst CQ oder macht Euch zu einem QTH auf,
das für andere von Wert ist! Das Angebot ist groß. Es muss nicht gleich
ein DXCC-Gebiet der Top 10 „Most Wanted“ sein. Ob Insel, Leuchtturm,
Flora-&-Fauna-Gebiet oder Schloss – die zugehörigen Kenner sind
hier und da noch unbestätigt oder wollen wieder einmal aktiviert werden.
Ob
dies wirklich so ist, wollte ich kürzlich während einer klassischen
handgemachten Expedition zu den IOTA-Objekten EU-043 und EU-061
herausfinden. Ergebnis: Zu meiner Überraschung trifft man immer noch auf
breites Interesse bei denen, die Taste oder Mikrofon benutzen können
und wollen. Und die bekommen zum Dank eine richtige QSL-Karte von mir.
Tun wir also selbst etwas dafür, dass uns der Spaß nicht abhandenkommt.
Das ist allemal besser, als guten alten Zeiten nachzutrauern und zu
klagen, eine neue Sendeart mache den Amateurfunk kaputt. Gerade jetzt,
wo doch die Sonne für uns so schön aktiv ist.
Awdh und best DX
Enrico Stumpf-Siering, DL2VFR
P.S.: Meldungen über DX- und IOTA-Aktivitäten nehme ich für das monatliche DX-QTC gerne entgegen.
Ein ganzes Arbeitsleben für den Amateurfunk
Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich unser Chefredakteur Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD, in den Ruhestand. Seit seinem Eintritt in den Verlag im Juli 1999 hat er an insgesamt 290 Ausgaben mitgewirkt, seit November 2005 mit voller Verantwortung für den Inhalt und die Einhaltung der Terminpläne.
Als FUNKAMATEUR-Autor trat Werner erstmals 1982 in Erscheinung und mit seinem Projekt „2-m-FM-Funksprechgerät mit 600-kHz-ZF“ zeigte er sich ein Jahr später als ambitionierter Selbstbauer. Nach Studium und Promotion an der TU Dresden gründete er 1990 einen Ingenieurbetrieb für Funk- und Kommunikationstechnik und machte sich nicht nur in Sachsen als Amateurfunkfachhändler einen Namen.
Insgesamt waren dies ideale Voraussetzungen, um später als Redakteur beim FUNKAMATEUR zu arbeiten. Mit Kompetenz und Erfahrung, einer strukturierten Arbeitsweise und seinem Bestreben, den Lesern jeden Monat ein interessantes Heft zu liefern, hat er fachliche Standards gesetzt. Zudem hat er ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass der FUNKAMATEUR heute eine international angesehene und wirtschaftlich erfolgreiche Zeitschrift ist.
Nach dem Ausscheiden von Bernd Petermann, DJ1TO, im Jahr 2001 hat Werner Hegewald den Posten des Chefredakteurs übernommen und die damit verbundenen Aufgaben mit großem persönlichem Einsatz gelöst. Er trug jeden Monat die Verantwortung für die pünktliche Fertigstellung, bestimmte von da an maßgeblich das inhaltliche Profil der Zeitschrift und nahm sich auch noch die Zeit, alle wichtigen Bücher des Verlages zu lektorieren und gelegentlich ein paar QSOs zu fahren. Auch unsere Website wäre ohne seine Ideen und sein Zutun weit weniger informativ.
Werner pflegte die Kontakte zu unseren rund 200 Autoren und kein Beitrag ging ohne seine kritische Endkontrolle in den Druck. Textliche Schwächen, fehlerhafte Schaltungen, Formeln und Diagramme oder schlechte Fotos hat er niemals durchgehen lassen.
Freilich war abzusehen, dass auch ein Chefredakteur einmal in Rente gehen würde. Daher bemühen wir uns schon seit Jahren, die Redaktion personell zu stärken, wie sich an gelegentlichen Stellenanzeigen unschwer erkennen lässt. Aber der Fachkräftemangel – ein Begriff mit dem Potenzial für das Unwort des Jahrzehnts – trifft auch uns, zumal wir bei der Auswahl der wenigen Bewerber die Messlatte sehr hoch legen. Positiv schlägt zu Buche, dass uns COVID-19 gelehrt hat, wie man auch aus dem Homeoffice eine gute Zeitschrift machen kann. Dadurch kommen jetzt auch Interessenten in Betracht, die ihren Wohnsitz nicht im Raum Berlin haben.
Unser gut eingespieltes Redaktionsteam muss nun bis auf Weiteres ohne Kapitän auskommen. Deshalb arbeiten wir intensiv daran, einen Nachfolger zu finden, der Werners große Fußstapfen füllen kann.
Ganz großen Dank, Werner!
Bleib gesund, genieße das Leben und tue jetzt all die Dinge, die Du Dir noch vorgenommen hast!
73, gd dx es awdh
Knut Theurich, DG0ZB,
im Namen des ganzen Teams
P.S. Selbstredend wird Werner als Konsultant weiterhin zur Verfügung stehen.
Lohnt sich Selbstbau noch?
Spontan würde ich diese Frage mit „Nein“ beantworten und denke dabei an das schier unüberschaubare Angebot an Elektronikprodukten aller Art und an die breite Palette kommerzieller Amateurfunktechnik. Es gibt praktisch alles fertig zu kaufen, und relativ billig ist das meiste davon obendrein. Die Herausforderung besteht eigentlich nur darin, den passenden Artikel auf den einschlägigen Handelsplattformen im Internet oder beim Fachhändler zu finden und das günstigste Angebot zu erwischen. Geld sparen lässt sich mit dem Selbstbau von Geräten kaum und wenn doch, dann wiegt der Einspareffekt zumeist nicht die investierte Zeit auf.
Bei näherer Betrachtung kommen mir aber Zweifel, ob ich mit dieser Einschätzung richtig liege. Diese erklärt nicht, warum sich immer noch viele Menschen für das Elektronikhobby begeistern und der Selbstbau unter Funkamateuren nach wie vor hoch im Kurs steht. Selbstbau wird übrigens auch für die kommende Einsteigerklasse erlaubt sein, was die Bedeutung unterstreicht, die diesem Aspekt des Amateurfunkdienstes auch von behördlicher Seite beigemessen wird.
Der finanzielle Aspekt, der beim Wort „lohnen“ anklingt, kann also nicht das Wichtigste sein. Wer das Umfeld betrachtet, wird feststellen, dass die Zeiten für Selbstbauer heutzutage nicht nur günstig, sondern geradezu paradiesisch sind. Große Distributoren mit ihrem umfangreichen Sortiment haben inzwischen auch Privatpersonen als Kunden entdeckt und füllen damit die Lücke, die der Wegfall so mancher namhafter Elektronik-Einzelhändler in den vergangenen Jahrzehnten gerissen hat. Auch das von kleineren Händlern auf Internetplattformen präsentierte Bauelementeangebot ist breit gefächert. Nicht nur sämtliche Standardbauteile sind problemlos zu haben, sondern ebenso hochmoderne ICs und Spezialteile. Mittels leistungsfähiger CAD-Software kann selbst der Hobbyelektroniker seine Platinen auf professionellem Niveau entwickeln und zu einem überschaubaren Preis kommerziell fertigen lassen. Dies eröffnet Möglichkeiten, von denen Bastler früher nur träumen konnten. Hinzu kommt im Hobbylabor verfügbare Messtechnik, die in ihrer Qualität noch vor wenigen Jahrzehnten nur den Entwicklungsabteilungen der Industrie und professionellen Laboren vorbehalten war.
Die entscheidende Frage ist letztlich: Was motiviert eigentlich zum Selbstbau? Ich denke, dass es hauptsächlich der Spaß an kreativer Tätigkeit und der Stolz auf das Geschaffene sind, sei es das passende Zubehör fürs Shack oder die maßgeschneiderte Bewässerungssteuerung für den Garten. Hierbei spielt es übrigens keine Rolle, ob das betreffende Gerät komplett selbst entwickelt wurde, fertige Module oder ein Bausatz zum Einsatz kommen.
Und ein weiterer Aspekt sollte nicht unterschätzt werden: Mit jedem neuen Projekt lernt man hinzu, sowohl Erfolge als auch Misserfolge erweitern den persönlichen Erfahrungsschatz. Die Beschäftigung mit interessanter Technik, der Zuwachs an Wissen und das Erlernen sowie die Vervollkommnung manueller Fertigkeiten – all dies ist mit dem Selbstbau von elektronischen und funktechnischen Geräten verbunden. Was zählen dagegen ein paar eingesparte Euro? Von älteren Funkamateuren höre ich des Öfteren, dass die Bastelei sie geistig fit hält und es einen tiefen Einschnitt in ihre Lebensqualität bedeuten würde, wenn sie damit aufhören müssten.
Ich korrigiere daher meine Antwort: Ja, Selbstbau lohnt sich, wenn auch nicht unbedingt unter finanziellem Aspekt. Er erweitert nicht nur den eigenen Wissenshorizont, sondern bietet Erfolgserlebnisse und damit Lebensfreude.
In diesem Sinne wünsche ich allen Hobbyelektronikern und Funkamateuren weiterhin viel Spaß und gutes Gelingen.
Peter Schmücking, DL7JSP
Über den Sinn des Funkens
Die Welt verändert sich. Man hört oft, die CW- und SSB-Bereiche der Amateurfunkbänder seien kaum genutzt. Nur im FT8-Abschnitt und während Contesten findet reger Funkbetrieb statt. Das stört mich persönlich nicht, weil mir Contest-QSOs jeder Art Spaß bereiten und ich FT8 eher unspannend finde und deshalb kaum betreibe. Zwar hat mein Computer einige tausend FT8-Verbindungen abgewickelt, doch so richtig tief bin ich in diesen Digimode nicht eingetaucht.
DXpeditionen bringen eine hohe Zahl von Funkverbindungen ins Log. Funkkontakte in FT8 gelten für das DXCC-Diplom und bringen viele Bandpunkte. Sie machen meist die Hälfte der QSOs der Funkaktivität aus. Dabei bedeutet der FT8-Betrieb für DXpeditionäre wohl wenig zusätzlichen Aufwand. In FT8 lässt sich, so ist zu lesen, nebenbei funken.
DXer können damit ebenfalls nebenbei die DX-Station anrufen. Man ist nicht mit gespitztem Ohr und geschärftem Verstand ans Funkgerät gebunden, um die richtige Frequenz und den richtigen Zeitpunkt zu finden. Nennt man eine gut ausgestattete Station sein Eigen, gelingen in FT8 Funkkontakte mit der DXpedition mit wenig Mühe. Man hat bewiesen, dass die eigene Amateurfunkanlage mit der DX-Station eine Verbindung herstellen kann. Das ist sicher ein möglicher Sinn des Funkens. Wenig Mühe bedeutet aber auch wenig Erlebnis. Für mich besteht der Sinn des Funkens wesentlich darin, einen DX-Kontakt zu erleben. Dazu gehören Misserfolge, die wieder Motivation sein können, sich selbst und die eigene Station weiterzuentwickeln.
Auf dem Band zu sein und Funkbetrieb oder DX-Signale mitzuerleben, ist eine schöne Erfahrung. Die ganze aufwendige Technik in Betrieb zu nehmen bzw. zu warten, gehört dazu. Das sind alles positive Dinge, die mir der Amateurfunk gibt.
Ich bin kein Sammler – obwohl ich im Contest immer wieder Multiplikatoren sammle. Außerhalb von Contesten steht in Sachen DX nur das Diplom WAZ 160 auf dem Plan, hier bin ich erst seit 2019 aktiv. Wegen Corona sind einige große DXpeditionen ausgefallen und mir fehlen noch neun Zonen. Bewusst mache ich keinen FT8-Betrieb, denn auf das Erlebnis einer echten CW-Verbindung möchte ich nicht verzichten. Den Anruf von KL7RA aus Alaska am Nachmittag des 28.11.2021 auf 160 m werde ich sicher niemals vergessen. Das WAZ 160 ist mein Projekt für die nächsten zehn bis 30 Jahre, auch mit der Erwartung, dass es vielleicht nichts wird. Das ist dann eben so.
Freilich gibt es viele Funkamateure, die gerne sammeln und Listen abhaken. Als soziale Wesen wollen sich Menschen vergleichen. Der persönliche Wert des Punktes hängt meiner Meinung nach von der Schwierigkeit ab, diesen zu erlangen. Einfacher ist eigentlich aus meiner Sicht nicht unbedingt gut. Ob ein Top-Platz auf einer Liste angestrebt wird, entscheidet jeder für sich. Andererseits gibt es ohne Ziele keine Entwicklung.
Ich denke, jeder sollte seine persönlichen Ziele finden. Sie sollten erreichbar, aber nicht zu leicht sein. Amateurfunk ist ein vielfältiges Hobby, bei dem ich auch nach 40 Jahren immer wieder etwas Neues entdecke. Kürzlich habe ich meine ersten Funkkontakte in Hell durchgeführt. Das war ein erfrischendes Erlebnis.
Letztendlich geht es darum, Freude und Sinn zu finden. Das gilt auch für die moderne Welt mit ihren zahlreichen Veränderungen. FT8 ermöglicht vielen Funkamateuren, die mit kleiner Station unterwegs oder anderweitig eingeschränkt sind, die Teilnahme am weltweiten Funkbetrieb. Früher schwierige DX-Punkte sind damit nun schneller zu erreichen. Mich stört es nicht, wenn jemand auf anderem Weg leichter an sein Ziel gelangt.
Michael Höding, DL6MHW
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Weltweite Zulieferkrise
Am 20. Oktober 2020 brach im japanischen Nobeoka in der Chipfabrik AKM
ein verheerender Brand aus, der erst nach Tagen gelöscht werden konnte.
Das Halbleiterwerk ist der weltweit wichtigste Produzent von ADCs, DACs
und anderen Komponenten für High-End-Audiogeräte, stellt aber auch
Schaltkreise für die Autoindustrie sowie Computer- und Kommunikationstechnik
her.
Und als wäre eine Katastrophe nicht genug, ging Mitte März vergangenen Jahres
auch noch ein Teil der 300-mm-Wafer-Fertigungsanlagen des Chipwerks von
Renesas in der japanischen Stadt Hitachin-Naka in Flammen auf, wodurch die
Lage am Halbleitermarkt zusätzlich verschärft wurde.
Fahrzeughersteller in aller Welt, die nicht nur mit der durch die Coronakrise
verursachten Absatzkrise zu kämpfen haben, sehen sich seitdem mit unlösbaren
Problemen konfrontiert. Die Versorgung mit Bauteilen stockt und das hat
Auswirkungen auch für Deutschland. Opel beispielsweise hat die Produktion
in Eisenach gestoppt, vorerst bis Ende 2021. In anderen Werken ist Kurzarbeit
an der Tagesordnung. Fahrzeuge, für die Elektronikkomponenten fehlen,
werden mit dem Versprechen einer späteren Nachrüstung an die Kunden
ausgeliefert oder stehen auf Abstellplätzen. Die Neuzulassungen gingen
hierzulande im vergangenen September im Vergleich zum Vorjahr um
26% zurück.
Der Mangel an Bauteilen führt zu massiven Preissteigerungen für lagernde
Bestände, teilweise bis zum Zwanzigfachen. Da verwundert es nicht, dass die
wenigen verfügbaren Komponenten in die teuersten Fahrzeuge der jeweiligen
Modellpalette eingebaut werden.
Die Hersteller von Amateurfunkgeräten sind ebenfalls massiv betroffen, da sie
vielfach Bauelemente einsetzen, die durch AKM gefertigt werden. So musste
etwa die Firma Icom im Dezember 2020 auf ihrer Website bekanntgeben,
dass sich der Produktionsbeginn des neuen D-STAR-Handfunkgeräts
ID-52A/E auf unbestimmte Zeit verzögert − jetzt endlich ist es da. Kenwood
kann einige Transceiver aktuell nicht liefern und Yaesu hat ebenfalls Probleme
mit der Beschaffung von Teilen für kommerzielle Funkgeräte. Man hofft auf
eine Normalisierung des Halbleitermarktes im Laufe des Jahres 2022.
Der Mangel führt so weit, dass selbst chinesische Funkgerätehersteller ihren
Großabnehmern derzeit weder Preise nennen noch verbindliche Lieferzusagen
machen.
Auch wir, das heißt unser Onlineshop und die Bausatzproduktion, sind von
dieser Krise betroffen. Auf etliche Teile, die sonst innerhalb von Tagen verfügbar
waren, müssen wir lange warten. Egal ob Anderson-Powerpole-Komponenten,
Relais von Omrom, Aluminiumprofile oder simple mechanische Teile:
Bei fast allen Produkten gibt es Preiserhöhungen und Lieferzeiten von bis zu
sechs Monaten.
Die aktuelle Krise trifft den Verlag zudem an einer sehr empfindlichen Stelle.
Unsere Druckerei hat vor einigen Wochen mitgeteilt, dass die Papierhersteller
für das Jahr 2022 Preiserhöhungen zwischen 60% und 80% angekündigt
haben. Dadurch erhöhen sich die Druckkosten für den FUNKAMATEUR in
einem nie dagewesenen Ausmaß. Weil wir diese enorme Belastung − neben
den ohnehin jährlich steigenden Postgebühren − nicht kompensieren können,
ist es leider unumgänglich, unsere Abonnementpreise moderat anzupassen.
Bitte beachten Sie aber, dass wir dabei im Rahmen der aktuellen Inflationsrate
bleiben. Ich danke für Ihr Verständnis.
Alles Gute für 2022. Bleiben Sie gesund.
Knut Theurich, DG0ZB
Eine Stimme aus Amerika
Internationaler Auslandsrundfunk ist mein Begleiter, seit ich zu Beginn der
1980er-Jahren erstmals den Kurzwellenbereich am Radiorecorder und damit
das Hobby Rundfunkfernempfang für mich entdeckte. Zusätzlich verstärkte
mein Interesse an fernen Radioklängen eine Folge der TV-Reihe „Hobbythek“,
die sich mit dem weltweiten Hörfunkempfang auf Kurzwelle befasste.
Die „Jagd auf kurze Wellen“, so der Titel der angeforderten Begleitbroschüre,
war nun endgültig eröffnet, bald mit einem echten Weltempfänger.
Allerdings war es nicht immer einfach, den gewünschten Sender aufzu-
nehmen. Zwar gab es noch kaum die heute fast überall präsenten hohen
Störpegel infolge minderwertiger Haushaltselektronik. Doch kam zur dichten
Belegung der Bänder mit einander überlagernden Signalen der teils massive
Einsatz von staatlichen Störsendern gegen unliebsame grenzüberschreitend
ausgestrahlte Radioprogramme hinzu. Dennoch: Der vielstimmige Chor
der internationalen Radiostimmen, ob aus Köln oder Berlin, Hilversum oder
Johannesburg, Paris oder Peking, Washington oder Moskau, brachte viele
verschiedene Blickwinkel frei Haus. Man musste inhaltlich mit dem Gehörten
nicht übereinstimmen, hatte aber per Weltempfänger die freie ungefilterte
Wahl.
Obwohl die Voice of America hinsichtlich ihrer Sendeaktivitäten auf
Kurz welle zu den bedeutendsten Auslandsdiensten zählte, wurden deren
Programme hierzulande vergleichsweise wenig wahrgenommen. Der Aus-
landsdienst der USA hatte zwar am 1. 2.1942 den Betrieb mit einer täglichen
Sendung in deutscher Sprache begonnen, diese jedoch im Jahr 1963 wieder
eingestellt. Bis dahin sendete man täglich zwei fünfzehnminütige Nachrichten-
programme auf Deutsch. Doch nun konzentrierte sich die VOA für Hörer
in Europa fortan auf Sendungen in osteuropäischen Sprachen.
Dies änderte sich zu Beginn der 1990er-Jahre, als die Voice of America
im Sommer 1991 überraschend wieder eine tägliche Sendung in deutscher
Sprache ins Programm nahm. Das auf Mittel- und Kurzwelle ausgestrahlte
Nachrichtenmagazin brachte journalistische Beiträge, die den Vergleich mit
denen des deutschen Programms des BBC World Service, der bis heute
einen Qualitätsstandard für Auslandsrundfunk setzt, mühelos standhielten.
Der Leiter des deutschen VOA-Dienstes bemühte sich um die Erweiterung
seiner Hörerschaft und nahm alle zwei Wochen eine kurze DX-Sendung
mit Hörtipps ins Programm. Als der Anruf aus Washington kam, ob ich die
inhaltliche Gestaltung dieses Beitrags übernehmen wolle, sagte ich gerne
zu. Im September 1993 war es leider schon wieder vorbei mit den deutsch-
sprachigen Sendungen aus Washington, doch konnte ich in der kurzen Zeit
einen guten Eindruck von der professionellen Arbeitsweise eines der bis
heute bedeutendsten Auslandssender gewinnen.
Im Gegensatz zu vielen anderen internationalen Auslandsdiensten sendet
die Voice of America heute immer noch. Zwar haben sich auch bei der VOA
die Verbreitungswege der Programme zugunsten von Satellit und Internet
verschoben, doch behält man in Washington die Kurzwelle für Hörer in
einigen Zielgebieten bei. Vieles davon ist schon mit einem tragbaren Welt-
empfänger auch hierzulande zu hören. Ganz unabhängig von Internet und
Satellit.
Harald Kuhl, DL1AX
Schätze für die QSL-Sammlung
QSL-Karten gelten selbst im Zeitalter von LoTW, DCL und Club Log bei
vielen Funkamateuren immer noch als Visitenkarte, die man nach einer
Funkverbindung gerne an den Funkpartner schickt bzw. von diesem erhält–
auch wenn es mittlerweile möglich ist, viele Diplome online zu beantragen
und dabei auf die genannten Log-Datenbanken zu verweisen.
Ich bin selbst ein notorischer Papiersammler. Teils dienen mir die Karten
als Bestätigung, um ein Diplom zu erwerben. Zudem ist es einfach schön,
wenn man sich beim Durchblättern der in Kartons sortierten Karten auch
nach Jahren noch an den einen oder anderen Funkkontakt erinnern kann.
Genauso umgekehrt: Trifft man einen Gesprächspartner auf dem Band
wieder, hat man vielleicht mit einem Griff dessen Karte zur Hand.
Dabei habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, die eigene Karte zeitnah
nach dem QSO über das Büro zu versenden, ohne auf das Eintreffen einer
QSL zu warten. Die Zahl erhaltener Karten schwankt über die Jahre hinweg,
bleibt aber bei etwa der Hälfte gegenüber den verschickten. Das ist nach-
vollziehbar, da nicht alle Funkamateure im jeweiligen nationalen Verband
organisiert sind und lediglich der DARC e.V. sowie einige andere europäische
Vereine QSL-Karten von Nichtmitgliedern mit einem entsprechenden
Vermerk zurücksenden. Ich halte es für durchaus sinnvoll, eine nicht zustell-
bare Karte dann besser zu entsorgen, als diese nochmals um die halbe Welt
zurück zum Absender zu schicken.
In der Regel sehe ich zum Jahresende einmal nach, für welche Funkver-
bindungen früherer Jahre noch QSL-Karten ausstehen und welche davon
ich unbedingt haben möchte. Deren Zahl ist meist überschaubar. Ein Blick
in die seit einigen Jahren auch online auf qslroutes.funkamateur.de verfüg-
baren QSL-Routen bringt in der Regel schnell Klarheit, ob der Operator
selbst den Versand abwickelt oder er einen Manager überzeugen konnte,
diese Arbeit für ihn zu übernehmen.
Auf QRZ.com und HamCall.net gelangt man dann schnell zu Informationen,
wie der Postversand erfolgen sollte. Das ist von Land zu Land unterschied-
lich und Änderungen unterworfen. Da die immer noch im Online-Shop
der Post erhältlichen Internationalen Antwortgutscheine, IRC, nicht mehr
in allen Ländern akzeptiert werden, bleibt meist nur der Weg über eine
kleine „Beilage“. Diese kann unterschiedlich hoch ausfallen. Der an sich
selbst adressierte Rückumschlag, SAE, gehört selbstredend neben der
eigenen QSL-Karte mit in den ausreichend frankierten Brief, der dann den
Postweg antritt.
Meist halte ich einige Wochen später die von mir begehrten Karten in den
Händen. Der logistische und finanzielle Aufwand ist vergleichsweise gering,
die erhaltenen QSL-Schätze wiegen diesen für mich bei weitem auf.
Wenn ich die QSL-Karte eines Funkpartners für meine Sammlung benötige,
kann ich ruhig einen kleinen Beitrag entrichten und mich damit an den in
vielen Ländern gestiegenen Kosten beteiligen. Und jeder, der sich über
das angebliche „Bezahlenlassen“ der Karten beklagt, sollte bedenken,
dass es nicht überall so einfach wie bei uns möglich ist, QSL-Karten via
Büro zu versenden oder von dort zu erhalten, weil ein solches dort schlicht-
weg fehlt.
Ingo Meyer, DK3RED
Software selbst schreiben
Von langjährigen Funkamateuren und Elektronikbastlern hört man zuweilen,
dass früher alles besser gewesen sei, weil man die Schaltpläne noch verste-
hen konnte. Heute müsse man studiert haben, um die Funktion elektronischer
Baugruppen zu erfassen und alles sei um einen schwarzen Kasten, genannt
Mikrocontroller, gruppiert. Teilweise mag dies auf den ersten Blick stimmen.
Für Vieles, was noch vor wenigen Jahrzehnten aufwendig in Hardware realisiert
werden musste, genügt heute ein programmierter Mikrocontroller. Die zur
Projekt- und Schaltungsentwicklung erforderliche Kreativität verlagert sich zu
einem nicht unerheblichen Teil von der Hard- zur Software. Wer sich damit
auskennt, hat relativ leichtes Spiel. Sie oder er kann die Software gegebenen-
falls sogar an eigene Vorstellungen anpassen und ein Gerät mit neuen Funk-
tionen ausstatten. Ein einfaches und anschauliches Beispiel dafür ist der von
Reiner Ryll, DF2RI, im FA 2/22 beschriebene Eigenbau-Sequenzer.
Die Möglichkeiten, die sich auch im Hobbybereich aus dieser Technologie
ergeben, gehen weit über das hinaus, was in reiner Hardware mit vertretbarem
Aufwand realisierbar wäre. Wahrscheinlich würde jeder Elektronikbastler,
ob alt oder jung, seine Digitalprojekte heute nur noch mit Mikrocontrollern
realisieren. Bestünde da nicht eine Einstiegshürde: Man muss sich zunächst
mit einem hochkomplexen Schaltkreis befassen und zusätzlich mit einer
Programmiersprache.
Ersteres zumindest nehmen etwa die Boards der Arduino-Familie dem
Anwender weitgehend ab, siehe www.arduino.cc. Die Konfiguration des
Mikrocontrollers geschieht hier weitgehend unbemerkt vom Programmierer
im Hintergrund oder ist bereits vordefiniert. Man kann sich gleich ans Schreiben
des Programms machen. Dies wiederum ist gar nicht so schwierig, wie es
Außenstehenden erscheinen mag. Wer sich zunächst an die englischen
Begriffe gewöhnen muss, dem bieten deutschsprachige Fachbücher und
Internet-Tutorials für Einsteiger gute Hilfestellungen. Mithilfe einfacher
Beispiel programme gelingt eine schnelle Einarbeitung und erste Erfolgs-
erlebnisse lassen nicht lange auf sich warten.
Bald wird dann deutlich, dass die Herausforderung weniger in der Syntax
der Programmiersprache besteht, sondern vielmehr im richtigen Programm-
ablaufplan. Was soll in welcher Reihenfolge abgearbeitet werden und welche
Abhängigkeiten sind zu beachten? Es stellen sich Fragen nach möglichen
zeitlichen Engpässen, den richtigen Gleichungen für durchzuführende
Berechnungen usw. Wer genaue Vorstellungen von seinem Vorhaben hat,
kennt bereits die Antworten. Gleiche oder ähnliche Fragestellungen hätten
sich wahrscheinlich ebenso bei der Realisierung des Projekts in Hardware
ergeben.
Es gibt daher keinen Grund, das Programmieren nicht einmal selbst zu
ver suchen. Dies möglicherweise im Zusammenhang mit einer Projektidee,
die schon auf ihre Umsetzung wartet. Vielleicht entsteht daraus sogar ein
Manuskript für einen FA-Beitrag.
Peter Schmücking, DL7JSP
Die ES-Saison beginnt
Die übliche Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im KW-Bereich
läuft über die Bodenwelle oder die Ionosphäre ab, wobei die F-Schicht
eine Rolle spielt. In den wärmeren Monaten, etwa von Mai bis August
kommt zusätzlich die sich tagsüber sporadisch ausbildende E-Schicht ins
Spiel. Sie erlaubt dann praktisch auf dem 6-m-Band und etwas seltener
auf dem 4-m-Band, mit viel Glück sogar auf dem 2-m-Band, das Erreichen
weiter entfernter Ziele. Konkret sind Entfernungen von etwa 1000 km bis
2200 km an der Tagesordnung und das mit teilweise beachtlichen Signal-
stärken − siehe genauer in FA 4/2022 S. 302 f.
Dank der Ende 2020 erschienenen Verfügung Nr. 110/2021 der Bundes-
netzagentur können auch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am
Amateurfunkdienst der Klasse E das 6-m-Band nutzen, nicht jedoch das
4-m-Band. Im wichtigeren Frequenzsegment von 50 MHz bis 50,4 MHz
sind diesen sogar 100 W PEP erlaubt bzw. 750 W PEP für Klasse A, ober-
halb für beide Klassen allerdings nur 25 W PEP. Es versteht sich wohl von
selbst, die Leistungsgrenzen nicht zu überschreiten, um die Toleranz der
Mitarbeiter der BNetzA nicht herauszufordern. Auf 70 MHz bitte außerdem
beachten, dass die Leistungsangabe 25 W die effektive Strahlungsleistung
ERP meint, also nicht PEP wie auf 50 MHz.
Die sporadische E-Schicht beeinflusst freilich auch die Ausbreitung auf den
oberen KW-Bändern, insbesondere auf 15 m, 12 m und 10 m. Die starken
Signale aus dem für KW-Verhältnisse eher nahen Umfeld mögen bei den
ausschließlich am DX-Verkehr interessierten Funkamateuren durchaus für
Unmut sorgen. QRP-Fans werden sich über die dadurch möglich werden-
den Verbindungen eher freuen. Und DXCC-Gebietsjäger wissen es sicher
zu schätzen, auf diese Weise Regionen erreichen zu können, die sonst in
der Toten Zone zwischen den Einflussbereichen der Boden- und der
Raumwelle liegen.
Zudem frohlocken nun Funkamateure mit eingeschränkten Antennen-
möglichkeiten, denn bei den kräftigen Signalen genügen selbst einfache
Antennen wie Dipol oder 1-Element-Quad, etwa in Form einer an der
Balkon brüstung befestigten Mobilantenne. Obendrein ist ja Portabelbetrieb
ausdrücklich erlaubt, denn der BNetzA geht es lediglich darum, dass die
Funkstelle während des Funkbetriebs nicht bewegt wird. Das schließt also
nur den Mobilbetrieb während der Fahrt des Kfz aus. Genaueres hierzu in
der Postbox auf S. 342.
Der zufällige und mitunter sehr kurzzeitige Charakter von ES-Öffnungen
gebietet es allerdings, auf jegliche Art von Klönschnack zu verzichten.
„Fasse Dich kurz“ ist oberstes Gebot! Ein nur wenige Buchstaben umfassen-
der Funkname ist dabei hilfreich und statt eines mühsam zu buchstabieren-
den Ortsnamens genügt der Locator, am besten auf die ersten vier Zeichen
beschränkt. Digimodes wie FT8 sind hier übrigens eher kontraproduktiv,
denn die Signale sind wie erwähnt meist kräftig und ein QSO in SSB ist viel
schneller getätigt, sodass andere auch noch eine Chance bekommen.
Abschließend bleibt mir nur noch, Ihnen buchstäblich viel Glück zu
wünschen – vielleicht kommt ja der eine oder andere durch ES zum
„QSO seines Lebens“!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Dauerkrise zwingt zum Umdenken
Corona, gestörte Lieferketten, Chip-Mangel und jetzt noch der Ukraine-Krieg −
unsere Welt ist aus den Fugen. Wenn Energie und Rohstoffe knapp und des-
halb teurer werden, tun wir gut daran, uns auf die neue Situation einzustellen.
Und weil wir die Preisentwicklung nicht beeinflussen können, ist der spar-
samste Umgang mit dem Verfügbaren die einzige Option.
Insofern war es schon im vergangenen Jahr eine gute Entscheidung, den Plus-
Abonnenten für 2021 keine CD mehr zu liefern, sondern den Download des
Jahrgangs-PDFs zu ermöglichen. Rund 95 % der Leser kamen mit dieser
Lösung zurecht. Denen, die keinen oder nur einen langsamen Internetzugang
haben und deshalb eine „echte“ CD bevorzugen, wurde ein Exemplar geliefert.
Durch diese Umstellung konnten wir etwa eine Tonne Plastik einsparen.
Eigentlich wollten wir damit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, jetzt aber
können wir zugleich auf mindestens eine Tonne Erdöl verzichten.
Ein weiteres Problem ist der anhaltende Mangel an Papier für den Druck von
Zeitschriften, der zu dramatischen Preiserhöhungen geführt hat. Fast alle
Verlage haben ihre Magazine teurer gemacht und auch wir mussten die Mehr-
kosten zum Teil an unsere Leser weitergeben.
Sparsamkeit ist nicht gleichzusetzen mit Geiz, sondern heißt vor allem, kreativ
nach Lösungen zu suchen, mit denen jedwede Art von Vergeudung beendet
wird. Schon lange halte ich es für nicht mehr zeitgemäß, dass wir für jedes im
Einzelhandel verkaufte Heft durchschnittlich 2,6 Exemplare drucken müssen.
Im Abonnement beträgt das Verhältnis 1:1. Was bislang für den Verkauf in
Supermärkten, Lottoannahmestellen und Bahnhofskiosken sprach, war, dass
der Amateurfunk in der Öffentlichkeit sichtbar blieb und wir auf diesem Wege
viele neue Abonnenten gewinnen konnten.
Bisher lassen wir jeden Monat für die Kioske und Supermärkte tausende Hefte
drucken, die der Vertrieb innerhalb Deutschlands und in sieben Nachbarländern
verteilt. Und weil nur knapp die Hälfte der ausgelieferten Exemplare Abnehmer
findet, müssen die unverkauften wieder eingesammelt werden, um letztendlich
im Altpapier zu landen. Dies bedeutet jährlich eine Verschwendung von mehr
als 15 Tonnen Papier sowie jede Menge an verbrauchtem Treibstoff für den
Hin- und Hertransport. Das können wir uns – als Gesellschaft – einfach nicht
mehr leisten, weshalb der Verkauf über den Zeitschriftenhandel zum Jahres-
ende eingestellt wird. Ein früheres Ende ist leider ausgeschlossen, da wir
vertraglich gebunden sind.
Für die Abonnenten, die etwa neun Zehntel der Leserschaft ausmachen, ist die
Einstellung des Einzelvertriebs ohne Belang. Für die Kioskkäufer, denen es zu
umständlich oder ab 2023 unmöglich ist, sich jeden Monat ein Heft zu kaufen,
bieten wir neben dem regulären Abonnement schon seit längerem das soge-
nannte Flex-Abo an. Bei diesem kommt das Heft pünktlich und portofrei ins
Haus, ohne dass man einen Abonnementvertrag mit langer Kündigungsfrist
abschließen muss. Vorauszahlungen sind nicht erforderlich, da der Heftpreis
monatlich und erst nach erfolgter Zustellung bequem per SEPA-Lastschrift
eingezogen wird. Und falls gewünscht, lässt sich der Bezug jeweils zum
nächsten Monat beenden. Zudem sind einzelne Ausgaben stets im Online-
Shop erhältlich.
Für Abonnenten, die sich zusätzlich zum gedruckten Heft eine digitale Version
wünschen, soll es ab nächstem Jahr ein entsprechendes Angebot geben. Und
auch eine rein digitalen Lösung ist geplant.
Bleiben Sie optimistisch!
Knut Theurich, DG0ZB
Der QSL-SHOP wird 30
Es war 1992 vor der Ham Radio in Friedrichshafen, als sich der Theuberger
Verlag entschloss, das neue von DL9WVM und DL5KZA zusammengestellte
QSL-Manager-Jahrbuch „QSL-Routes“ mit QSL-Karten zu bewerben.
Wir druckten einfache QSL-Karten – Schwarz, Rot und Blau genügten uns
sowie den meisten Kunden damals noch. Etwas später versuchten wir es
dann mit den ersten Foto-QSLs, bald schon mit Hochglanzoberfläche.
Unsere Qualität setzte fortan Maßstäbe.
Inzwischen sind 30 Jahre vergangen und wir haben in dieser Zeit über
100 Millionen QSL-Karten gedruckt. Damit könnte man bequem zehn
30-Tonner beladen oder die Strecke zwischen Berlin und dem Südpol
auslegen. Viele namhafte DXpeditionen versendeten Karten „Printed by
QSL-SHOP“ wie VK0IR, 3B7RF, 3W6C, ZL8X oder VP6DX. Letztere ließen
sogar einen Minibildband bei uns drucken. Sehen Sie doch einmal Ihre
Sammlung durch. Sie werden feststellen, dass sich unsere Karten durch
ihre Qualität von der Masse unterscheiden.
Die Position als Marktführer in Sachen QSL-Karten in Deutschland haben
wir uns hart erkämpfen müssen. Diesen Status konnten wir durch höchste
Qualität, kompetente und freundliche Beratung sowie stabile Preise erreichen.
Unsere Kunden in aller Welt schätzen aber nicht nur die freundliche Unter-
stützung beim Design ihrer QSL-Karten, sondern auch die unkomplizierte
Auftragsabwicklung bei Nachbestellungen sowie die kulante Behandlung
im Falle seltener Reklamationen.
Obwohl es heute im digitalen Zeitalter mit LoTW, DCL oder Club Log neue
Möglichkeiten zum elektronischen Austausch von QSO-Bestätigungen gibt,
lieben viele Funkamateure immer noch traditionelle QSL-Karten, die über das
Büro oder direkt verschickt werden. Da hat man eben „etwas in der Hand“ −
als Beleg für funkerisches Können, zum Sammeln, für die Wand im Shack,
zum Herumzeigen beim OV-Abend…
Seit 1997 zeichne ich als Grafikerin allein für den QSL-SHOP verantwortlich.
Aufgewachsen in einem Amateurfunkhaushalt kenne ich mich mit der Funkerei
und QSL-Karten bestens aus und konnte die Entwicklung auch im familiären
Umfeld verfolgen. So lag es nahe, meine künstlerischen Ambitionen zum
Beruf zu machen.
Es hat mich dabei immer gereizt, für jeden meiner Kunden eine ganz indivi-
duelle Karte zu entwickeln, die auf die jeweilige Person zugeschnitten ist.
Denn sie ist ja schließlich ein persönliches Aushängeschild, frei nach dem
Motto: „Zeige mir Deine QSL-Karte und ich sage Dir, wer Du bist.“ Dabei
konnte ich nicht nur einen festen Kreis von Stammkunden aufbauen, sondern
auch selbst eine Menge über ferne Länder, abgelegene Inseln, berühmte
Persönlichkeiten und historische Ereignisse lernen.
Es erfüllt mich auch heute noch mit Stolz und besonderer Genugtuung,
wenn Kunden nach etlichen Jahren wieder mit einem Nachdruckauftrag
zu mir kommen oder ich „meine“ QSL-Karten an der Wand im Shack eines
anderen OMs entdecke.
In diesem Sinne freue ich mich auf Ihre QSL-Kartenbestellung und auf die
noch zahlreichen kommenden Jahre beim QSL-SHOP.
Sabine Zschäckel, DL3KWS
Ham Radio 2022 – richtig und wichtig
Nach zweijähriger coronabedingter Pause fand zum „gewohnten“ Termin
am letzten Juniwochenende erneut eine Ham Radio statt. Endlich war es
wieder soweit, und das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die von
über 10 000 anderen Funkamateuren aus aller Welt.
Und wie verlief die Ham Radio 2022? Ich meine, die Veranstaltung war ein
Erfolg. Ja, es gab in diesem Jahr augenscheinlich mehr Besucher, die nur
einen Tag auf der Messe verbrachten, aber sie waren da! Ja, der Flohmarkt
– in zwei jeweils zu einem Viertel abgehängten Hallen – war sichtlich kleiner
und manch einen vertrauten Anbieter vermisste man vielleicht, aber schlecht
war der Flohmarkt in keinem Fall. Ja, das Vortragsprogramm war, verglichen
mit anderen Jahren, vielleicht etwas „dünner“ und weniger technik lastig,
was dem einen oder anderen Messebesucher sauer aufstieß. Und es fehlten
in der Halle A1 leider etliche namhafte Händler. Die Gründe für ihr Fernbleiben
erschlossen sich den Besuchern kaum, aber es war wirklich schade. Ebenso
fiel die Contest-University der kurzen Vorbereitungszeit zum Opfer. Aber sind
dies alles K.-o.-Kriterien für eine solche Veranstaltung? Ich finde, sie sind
es nicht.
Die Messeorganisation in diesem Jahr bedeutete für alle Beteiligten eine
Herausforderung. Während sonst das Motto gilt „Nach der Messe ist vor der
Messe“, stand erst im späten Frühjahr fest, dass es wieder eine Ham Radio
geben würde. Was das Organisationsteam in der zur Verfügung stehenden
Kürze der Zeit noch auf die Beine gestellt hat, konnte sich sehen lassen.
Das schreibe ich nicht, weil ich ein − wenn auch kleiner − Funktionsträger
im DARC e.V. bin. Es war einfach richtig und wichtig, die Messe, so wie sie
möglich war, auf die Beine zu stellen.
Gab es Highlights im Jahr 2022? Ja, reichlich. Auf der Aktionsbühne im Foyer
waren dies neben zahlreichen Ehrungen der Contester und Clubmeister auch
die Verleihung des Shears-Awards für den OV im DARC e.V. mit dem größten
Mitgliederzuwachs. Zudem gab es einzelne Vorträge, bei denen der jeweilige
Vortragsraum aus allen Nähten zu platzen drohte.
Seit einiger Zeit bin ich zu der Erkenntnis gelangt, dass die Zukunft unseres
Hobbys auch dadurch maßgeblich bestimmt wird, wie man uns in der Öffent-
lichkeit wahrnimmt. Denn eine Zunft, die es u.a. fertigbringt, einmal im Jahr
eine internationale Messe zu veranstalten, die bis zu 15 000 oder fast 20 000
Besucher an den Bodensee zieht, nehmen unsere Gesprächspartner in den
Ministerien, bei der BNetzA oder der Industrie anders wahr, als eine Gruppe
von Bastlern, von denen man eher wenig hört oder sieht. Deswegen wünsche
ich mir, dass auch 2023 eine Ham Radio stattfindet, dass dort die Spitzen-
techniker aus unseren Reihen fundierte technische Präsentationen anbieten,
dass es zwei volle Flohmarkthallen geben wird, und dass die potenten
Amateurfunk handels häuser sowie Hersteller wieder in gewohnter Präsenz
das Bild der Messe abrunden.
Was braucht es noch für eine erfolgreiche Ham Radio 2023? Ein engagiertes
Team beim Veranstalter! Ich denke, das ist vorhanden. Es braucht die potenten
Händler und Gerätehersteller, die in gewohnter „Mannschaftsstärke“ präsent
sein müssen. Und dann braucht es Besucher. Das sind auch Sie, liebe Leser!
Sehen Sie das Positive einer solchen Veranstaltung und honorieren sie das
Engagement der Veranstalter, Verkäufer und Vortragenden durch Ihren
Besuch. Denn dann wird auch die Messegesellschaft Friedrichshafen der
Ham Radio eine Zukunft geben.
Auf Wiedersehen in Friedrichshafen 2023
Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS
Lebensfreude und Leidenschaft
Wie der Soziologe Max Weber formulierte, ist Politik „ein starkes langsames
Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich“.
Was aber hat Politik mit Amateurfunk zu tun? Seit geraumer Zeit bemühen
sich einige Funkamateure darum, die Morsetelegrafie von der UNESCO als
Weltkulturerbe anerkennen zu lassen. Die Konkurrenz um eine solche Würdi-
gung ist stark und besonders in Deutschland stehen einige Volksfeste, die
Teekultur sowie nicht zuletzt viele Handwerksberufe hoch im Kurs. Wer den
Zuschlag bekommt, ist am Ende eine politische Entscheidung. Unsere Lobby
ist derzeit leider begrenzt und daher genug „Holz zum Bohren“ vorhanden.
Wie geht es nun weiter?
In der IARU-Region 1 hat sich vor einiger Zeit eine Gruppe nationaler Interessen-
verbände mit dem Ziel zusammengeschlossen, durch einen multilateralen
Antrag eine „kritische Masse“ zu erreichen. Die Chance auf Erfolg ist in einem
Land mit vielleicht nur fünf Konkurrenzanträgen deutlich höher als in der
Bundesrepublik, aus der der UNESCO-Kommission rund 70 Anträge vorliegen.
Einige der hiesigen Konkurrenten sind wie erwähnt nicht zu unterschätzen.
Doch kann man jedem Amateurfunkverband abverlangen, dass dieser mit vollem
Elan an einer Antragstellung mitwirkt? Angesichts der COVID-19-Pandemie
bestehen in einigen Regionen der Welt andere „Baustellen“. Der Zusammen-
schluss macht dennoch Hoffnung. Denn wenn wir zeigen, dass die Liebe zur
Telegrafie von Südafrika bis nach Schweden reicht und eine internationale
Bewegung ist, haben wir gute Chancen, eines Tages erhört zu werden. Dies
war der realistische Teil − oder wie eingangs geschrieben: Augenmaß.
Ein weiterer Aspekt ist noch wichtiger: Leidenschaft. Funken macht Spaß und
spornt an, ganz besonders, wenn es mittels kurzer und langer Töne erfolgt.
Beim Portabelfunk spannen wir weitab der nächsten Steckdose einen einfachen
Antennendraht, der uns mit der Welt verbindet. Telegrafie ist dabei oft die erste
Wahl. Ein QRP-Sender aus Bauteilen aus der Bastelkiste, mit dem man in CW
Hobbyfreunde auf anderen Kontinenten erreicht, bringt zusätzliche Freude.
Die mitunter spektakulären Erfolge der Digimodes wirken auf Morsetelegrafisten
dagegen verhältnismäßig trist. Hier kommt die Leidenschaft ins Spiel.
Auf der Amateurfunkmesse Ham Radio stand in diesem Jahr an fast jedem
zweiten Stand eine Morsetaste zum Ausprobieren bereit. Doch muss es darum
gehen, dieses vorhandene Interesse auch mit Funkverbindungen auf den
Bändern zu zeigen und die Telegrafieklubs zu unterstützen. Probiert Neues
aus, denn in der Telegrafie auf KW gibt es vieles zu entdecken: ganz schnelle,
ganz langsame Tempi, ob zum gemütlichen Plausch in die Nachbargemeinde
oder im Pile-up für das 300. DXCC-Gebiet.
Die vorliegende FA-Ausgabe erinnert uns zudem mit ihrem Titelbild: Morsen
kann jeder lernen, der dafür genügend Fleiß und Ausdauer mitbringt. Einfach
ist dies nicht, sonst wäre es schließlich keine Kunst. Umso mehr Freude und
Stolz belohnen am Ende für die Mühe. Der eine oder andere von uns hatte
Telegrafie zur Vorbereitung auf die Amateurfunkprüfung oder während der
Militärzeit gelernt, dann aber die Morsetaste in der Schublade verschwinden
lassen. Warum aber die verschütteten Kenntnisse und Fertigkeiten nicht wieder
auffrischen und dann hin und wieder vom Telefonie- in das Telegrafiesegment
der Bänder wechseln? Heutzutage gibt es eine Fülle von komfortablen Lern-
und Übungsprogrammen, die viel Spaß bereiten und das Telegrafietraining
dadurch leichter von der Hand gehen lassen. Einige davon werden im Beitrag
auf S. 712 vorgestellt.
Ein bekannter Funkamateur sagte vor einiger Zeit, Telegrafie sei gesteigerte
Lebensfreude − vergessen wir dies nicht. Jetzt müssen wir hoffen, dass
unsere Leidenschaft auch die UNESCO überzeugt.
Martin Gloger, DM4CW
Auf Wiedersehen in Friedrichshafen 2023
Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS
Hausmitteilung
Beim runden Geburtstag des FUNKAMATEUR fehlt diesmal irgendwie die
richtige Feierlaune. Eigentlich hätten wir allen Grund, uns zu freuen, haben wir
die Corona-Dauerkrise bisher doch gut überstanden.
Die Arbeit im Homeoffice funktioniert sehr gut und es hat zu keinem Zeitpunkt
Probleme mit der pünktlichen Lieferung der Daten an die Druckerei gegeben.
Niemand ist durch COVID-19 länger ausgefallen oder hat mit Long COVID zu
kämpfen.
Sorgen aber bereitet mir die aktuelle Preisentwicklung. Papier ist zu einem
raren Gut geworden, dessen Preis durch steigende Energiekosten, heruntergefahrene
Produktionskapazitäten und Rohstoffknappheit weiter in die Höhe
getrieben wird. Bezüglich des Aufwandes für Strom und Heizung gibt es
− zumindest für uns − noch keine verlässlichen Informationen. Sicher ist nur,
dass mit einer baldigen Normalisierung nicht zu rechnen ist. Auf 172 Grad
unter Null gekühltes Flüssiggas ist nun einmal deutlich teurer, als das billige
russische Gas, das wir Europäer jahrzehntelang bezogen haben. Wir werden
uns wohl oder übel mit den neuen Gegebenheiten arrangieren müssen.
Für den Verlag höchst unerfreulich sind zudem die steigenden Preise für
jegliche Art von Waren, die der Leserservice für Sie einkauft. Das fängt an
bei elektronischen Bauteilen mit teilweise absurden Lieferzeiten, geht über
Gehäuse und reicht bis hin zu Einfuhren aus Fernost. Hinzu kommen der
schwächelnde Euro und Unsicherheiten wegen der spürbar nachlassenden
Kauflust unserer Kunden.
Das alles sind dennoch lösbare Probleme, wenngleich unsere finanziellen
Spielräume für neue Projekte dadurch kleiner werden und wir gezwungen
sind, Einsparpotenziale auszumachen und zu nutzen. Bei diesem Bemühen
kann man freilich auch über das Ziel hinausschießen, wie sich an der
Umstellung von echten CDs auf den Download des Jahrgangs-PDFs für
unsere Plus-Abonnenten gezeigt hat.
Die Auswertung der Server-Logs ergab nämlich, dass ein paar Tausend
Plus-Abonnenten ihre Dateien bis heute nicht heruntergeladen haben. Um
dem Eindruck zu begegnen, wir möchten jemandem etwas vorenthalten,
werden wir mit der Dezember-Ausgabe den Plus-Abonnenten für ihr Jahrgangs-
PDF wieder individuelle Download-Codes mitteilen und einen Monat
später, also etwa zu Weihnachten mit dem Heft 1/2023, entgegen unserem
ursprünglichen Vorhaben doch wieder eine CD versenden, die neben dem
Jahrgang 2022 zusätzlich den 2021er enthält.
Den Sammlern unserer Archiv-CDs sei an dieser Stelle schon einmal mitgeteilt,
dass die lang erwartete DVD mit den Jahrgängen 1952 bis 1959 in
der Produktion ist. Wer sein persönliches Archiv komplettieren will, kann die
DVD in Kürze für 15 € auf www.box73.de bestellen.
Und dann gibt es da ja noch einen Lichtblick: Die soeben angekündigte neue
Amateurfunk-Einsteigerklasse könnte dazu beitragen, den Rückgang der Anzahl
von Funkamateuren in Deutschland zu stoppen oder sogar umzukehren.
Davon würde nicht nur der DARC e. V, sondern auch der FUNKAMATEUR
profitieren. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich in Zukunft ausreichend
Interessenten für ein DN-Rufzeichen finden und diese auf den von ihnen
nutzbaren Bändern genügend Möglichkeiten haben, erbaulichen Funkverkehr
zu praktizieren. Ob Letzteres funktioniert, liegt an uns allen.
Bleiben Sie trotz aller Widrigkeiten optimistisch!
Knut Theurich, DG0ZB
Neustart unter dem Funkturm
Zwei Jahre verhinderte die Pandemie Messeveranstaltungen, und das traf
natürlich auch die IFA. Deren Neustart war nicht leicht: deutlich weniger
Aussteller, Personalquerelen im Vorfeld der Veranstaltung, die dem Image
dieser Messe abträglich waren, Streit zwischen der Messe Berlin und der
veranstaltenden gfu − Consumer & Home Electronics GmbH über Verbleib und
künftige Ausrichtung der Messe. Trotz aller Schwierigkeiten ist der Neuanfang
gelungen, er lässt hoffen, dass die IFA im nächsten oder übernächsten Jahr
zu altem Glanz zurückfindet.
Der Schwerpunkt der Ausstellung verschob sich, wie schon 2019 und davor,
weiter in Richtung der Hausgerätetechnik, die Unterhaltungselektronik spielte
eine recht untergeordnete Rolle. Das liegt auch daran, dass dank der Globa -
lisierung weniger Unternehmen auf diesem Sektor tätig sind, folglich auch
Geräte und ihre Technik gleichförmiger werden. Worin unterscheiden sich
schon die riesigen Flachbildschirme von Branchenriesen wie LG oder TCL?
Alle verwenden ähnliche Architekturen, benötigen die gleichen Bauelemente
sowie Displays und bieten vergleichbare Funktionen.
Interessante Neuheiten kleinerer und innovativer Hersteller ließen sich kaum
bewundern, da diese nicht auf der Messe vertreten waren: Philips (TP Vision),
Loewe, Technisat, Bang & Olufsen, Beyerdynamic, um nur einige zu nennen.
Viel geredet wurde über De-Globalisierung und Nachhaltigkeit, eine Studie
fand sogar heraus, dass diese von der Mehrheit der Kunden gewünscht
würden. Wunderbar, nun sollte – endlich – einmal den Kundenwünschen
entsprochen werden: Einsparung von Ressourcen und Energie, Produktion
im eigenen Land statt auf der anderen Seite des Erdballs. Doch scheint dies
noch in weiter Ferne zu sein. Die Kopplung von Haushaltsgeräten mit Sprach −
assistenten, um eine Kühlschranktür oder Herdklappe zu öffnen, ist das genaue
Gegenteil von Nachhaltigkeit. Hier wird nicht nur ein drastisch erhöhter
Hardware-Aufwand betrieben, sondern auch eine weltweite, höchst energieintensive
Infrastruktur genutzt, um einen einfachen Handgriff zu ersetzen.
Aspekte des Datenschutzes sind noch unberücksichtigt, denn die Internetkonzerne,
die diese „komfortablen“ Funktionen ermöglichen, sind auch die
neuen Herren der Kundendaten.
Es ist sehr zweifelhaft, ob es wirklich im Sinne des Menschen ist, ihm eigene
Aktivitäten abzunehmen und diese durch Algorithmen zu ersetzen, die von
Internetanbietern in die tägliche Praxis umzusetzen sind. Freilich, so hat
der Kunde endlich genug Zeit, sein schönes neues OLED- oder Micro-LEDFernsehgerät
und dessen 8K-Programme ausgiebig zu „genießen“.
Bemerkenswert ist die verstärkte Wiedergeburt altvertrauter, fast vergessener
Marken. Namen wie Aiwa, Nokia und Toshiba wollen das Vertrauen in marktfähige
Produkte wiedergewinnen, obwohl sie mit den einstigen Unternehmen
nichts mehr zu tun haben. Die neuen Lizenznehmer lassen irgendwo auf der
Welt produzieren, im günstigsten Fall sind es Geräte aus eigener Entwicklung.
Das kann in Asien sein, bei der Fabrikation von Fernsehgeräten mit wohlklingenden
Namen spielt das türkische Unternehmen Vestel heute eine wichtige
Rolle auf dem europäischen Markt.
Mit all ihren spürbaren Lücken zeigte diese Messe vor allem, dass es sie
immer noch gibt. Über 160 000 Besucher kamen auf das Messegelände unter
dem Berliner Funkturm, um zu erfahren, was die rund 1200 Aussteller zu
bieten hatten. Darüber lesen Sie mehr in unserem Bericht ab Seite 852 in
dieser Ausgabe.
Wolfgang E. Schlegel
Dezember 2022
In diesem Monat ist es wieder soweit: Am 8.Dezember um 11 Uhr startet ein
bundesweiter Warntag, dies ist nach 2020 der zweite. Die in Deutschland
für den Katastrophenschutz zuständigen Behörden und Einrichtungen des
Bundes, der Länder und der Kommunen testen dabei die verfügbaren techni-
schen Mittel, um die Bürgerinnen und Bürger im Katastrophenfall oder bei
Großschadenereignissen zu warnen und Verhaltenshinweise zu geben. Zum
einen geht es dabei darum, das Zusammenspiel der beteiligten Stellen zu
überprüfen, eventuelle Schwachstellen zu erkennen und diese im Anschluss
zu korrigieren. Zum anderen haben wir alle die Gelegenheit, die an unseren
Wohnorten verfügbaren sogenannten Warnmittel kennenzulernen.
Ursprünglich sollte der bundesweite Warntag jährlich am zweiten Donnerstag
im Monat September stattfinden. Doch waren die technischen Mängel, die
sich beim ersten Versuch vor zwei Jahren offenbart hatten, 2021 noch nicht
ausreichend behoben. Man vertagte sich also auf dieses Jahr. Dann wurde
beschlossen, den Warntag ausnahmsweise von September auf Dezember zu
verlegen, um mit Cell Broadcast einen für Deutschland neuen Warnkanal fürs
Mobiltelefon erstmals bundesweit erproben zu können.
In einigen benachbarten Ländern längst eingeführt, hatten sich für den
Katastrophenschutz hierzulande verantwortliche Stellen lange Zeit gegen
Cell Broadcast entschieden und lieber auf Warn-Apps fürs Smartphone
gesetzt. Doch nach der Unwetterkatastrophe im Aartal vom Juli vergangenen
Jahres, als sich erneut Schwachstellen bei der Warnung der Bevölkerung
gezeigt hatten, überdachte man die bislang ablehnende Haltung. Da zunächst
die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen waren und die Mobilfunkanbieter
darauf basierend den neuen Sendedienst einrichten sowie intern erproben
mussten, findet der diesjährige bundesweite Warntag nun erst am 8.12. statt.
Worum es bei Cell Broadcast geht und welche weiteren Warnmittel hierzulande
verfügbar sind, ist Gegenstand eines Beitrags ab Seite 942.
Der bundesweite Warntag ist zudem eine gute Gelegenheit, das Thema
Notfunk nochmals in das Bewusstsein zu rufen. Einerseits bei den an unseren
Wohnorten für Katastrophenschutz zuständigen Stellen, vielleicht unter Hinweis
auf die im Amateurfunkgesetz festgelegte Möglichkeit zur Unterstützung der
Kommunikation bei Notfällen. Andererseits bei uns selbst: Was können wir
leisten und was ist sinnvoll, wenn etwa die Stromversorgung und dann bald
auch die öffentlichen Kommunikationsnetze über einen längeren Zeitraum
hinweg ausfallen?
Die Praxis hat gezeigt, dass die Konzentration unserer Bemühungen auf die
Unterstützung der mit dem Katastrophenschutz betrauten Organisationen
allein nicht reicht. Diese sind vielleicht selbst genug damit beschäftigt, ihren
eigenen digitalen Behördenfunk am Laufen zu halten und haben keine Kapa-
zitäten, freiwillige Notfunker ernsthaft in ihre Überlegungen einzubeziehen.
Daher geht das überarbeitete Notfunkkonzept des DARC e. V., verstärkt Hilfe
bei der Kommunikation für die von einer Katastrophe direkt betroffenen
Menschen anzubieten, in die richtige Richtung. Sei es durch den Aufbau
lokaler WLAN-Netze, sei es durch die Unterstützung bei der Verwendung
von Jedermann-Funkgeräten für einen „Nachbarschaftsfunk“.
Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung sind wir dann nicht nur potenzieller
Ansprechpartner für den örtlichen Katastrophenschutz, sondern ebenso für
unsere Nachbarn.
Harald Kuhl, DL1AX
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Zu neuen Herausforderungen
Die vor knapp zwei Jahren in Betrieb gegangenen Amateurfunk-Transponder
von Qatar OSCAR-100 ermöglichen es Funkamateuren in Europa, Afrika,
Teilen Asiens und sogar der Antarktis, Stichwort „Neumayer III“, im UHF/SHF-
Bereich planbare, verlässliche DX-Verbindungen herzustellen. Das hat zu
einem ungeahnten Aktivitätsschub und entsprechenden Selbstbauaktivitäten
geführt.
Dabei dürfte kaum jemand die hochkomplexe Sende- und Empfangstechnik
komplett selbst gebaut haben. Vielmehr werden industriell hergestellte Kom-
ponenten, die eigentlich für andere Zwecke gedacht sind, unverändert oder
modifiziert genutzt. Das „Zum-Spielen-Bringen“, einschließlich des Baus not-
wendiger Zusatzbaugruppen und insbesondere der Messtechnik, lässt allemal
genügend Freiraum für Kreativität und bietet Anregungen für FA-Beiträge.
Es ist wird ohnehin für einzelne Privatpersonen immer schwieriger, für
umfangreiche Schaltungen die notwendigen Bauelemente aufzutreiben;
geschweige denn, die modernsten fachgerecht aufzulöten. Hier ist Bausatz-
unterstützung gefragt, wie etwa bei den Transvertern SEU28-50 und SEU28-70
in FA 11 + 12/20 durch QRPproject. Für das SINAD-Messgerät aus FA 9 + 10/20
ist nun ebenfalls ein Bausatz beim FA-Leserservice im Entstehen. Gleiches
gilt für den weniger aufwendigen, aber häufig nachgefragten S9-Normpegel-
Generator aus FA 6/18.
Für das Jahr 2021 haben wir einige Beiträge in Vorbereitung, die sich mit dem
Einsatz von SMA-Modulen beschäftigen. Sie finden diese im FA-Online-Shop
www.box73.de durch Eingabe von „hfm“ in das Suchfeld − das daraufhin
Erscheinende ist erst ein kleiner Teil des vorgesehenen Sortiments. Vom
einfachen Empfangskonverter über Sende- und Empfangs-Einrichtungen
für QO-100 bis hin zur Amateur-Relaisfunkstelle lässt sich damit sicher nicht
alles, aber doch vieles „zusammenstecken“.
Begleiten wird uns darüber hinaus Icoms neuer, von 160 m bis 70 cm nutzbarer
QRP-Transceiver IC-705. Dabei soll es vor allem um spannende Anwendungen
sowie nützliche Zusatzbaugruppen gehen.
Doch was nützt die schönste Funktechnik, wenn lokale Störungen den Empfang
beeinträchtigen? Walter Schellenberg, HB9AJG, hat meine Anregung aus
dem Editorial FA 12/19 aufgegriffen und präsentiert in dieser Ausgabe ab
S. 28 einen tragbaren Peilempfänger zur Störungssuche in Verbindung mit
einem Smartphone oder Tablet. Es sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen,
dass wir SDR-Screenshots sowie Ton-Dateien sammeln und katalogisieren
möchten, um allen Leser n das Identifizieren von Störquellen anhand deren
charakteristischen „Fingerabdrucks“ zu ermöglichen. Dazu bedarf es der Mit-
hilfe von Erfahrungsträgern: Schicken Sie uns bitte entsprechendes Material!
Abschließend bedankt sich die Redaktion ganz besonders bei denjenigen
unter Ihnen, die hin und wieder selbst „zur Feder“ gegriffen haben oder greifen
werden − angefangen von der zweizeiligen Kritik per E-Mail bis hin zu mehr-
seitigen Fachbeiträgen zu den oben angesprochenen oder gänzlich anderen
Themen, wie etwa Elektronik und Smart Home.
Apropos: Auf Amateurfunktreffen und Flohmärkten sowie in unseren Orts-
verbänden sind nicht wenige junge Funkamateure anzutreffen. Im FA leider
eher selten. Melden Sie sich doch einmal zu Wort, und wenn es nur eine Frage
für die Postbox ist oder ein kleiner Beitrag zu moderner Technik, der anderen
Leser vielleicht wertvolle Hinweise gibt …
Zu guter Letzt ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Leser, für Ihre Treue
sowie ein glückliches und vor allem gesundes Neues Jahr!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Knut Theurich, DG0ZB
Sonnige Zeiten
Für den Funkbetrieb auf den KW- und teilweise auch den UKW-Bändern
erwarten uns im wahrsten Sinne des Wortes „sonnige“ Zeiten, marschiert
doch unser Zentralgestirn, wenngleich zunächst gemächlich, in Richtung
Maximum des 25. Zyklus. František K. Janda, OK1HH, wird Ihnen weiterhin
Ausgabe für Ausgabe die physikalischen Vorgänge erläutern − wie schon seit
FA 4/1981! Gleichwohl sind KW-DXer gut beraten, sich darüber hinaus kurz-
fristig zu informieren. So etwa auf solarham.net, bei Frau Dr. Tamitha Skov,
WX6SWW, via Youtube, oder im wöchentlichen Bericht von Dr. Hartmut Büttig,
DL1VDL, innerhalb des DL-Rundspruchs. Zahlreiche Links zum aktuellen
Funkwetter, inklusive aller eben genannten Quellen, finden Sie auf
www.funkamateur.de → Amateurfunkpraxis/DX. Dies alles als Ergänzung
zu regelmäßigen eigenen Beobachtungen der Bänder, die, und sei es nur
für kurze Zeit, immer wieder überraschende Verbindungen ermöglichen.
Der Boom digitaler Sendearten wie FT8, wo noch Verbindungen mit Signal-
stärken von −20 dB unter der Rauschschwelle laufen können, ermöglicht
es überdies, Bandöffnungen zu nutzen, bei denen in CW oder SSB noch
nichts wahrzunehmen und im Spektrogramm nichts zu sehen ist. Durch die
Konzentration auf einen schmalen Kanal, in dem sich die aktiven Stationen
ausschließlich tummeln, entgeht dem am PC sitzenden Funker praktisch
nichts. Dies gilt ähnlich im UKW-Bereich: Ein Großteil der 2020er Super-DX-
QSOs wäre ohne FT8 mit seinem Empfindlichkeitsgewinn gegenüber SSB
und selbst CW nicht möglich gewesen. Die Signalstärken lagen da kaum
höher als 15 dB unter dem Rauschen in 2,5 kHz Bandbreite.
Dabei bleibt die Entwicklung keinesfalls stehen, es sind bereits erste Details
einer kommenden WSJT-X-Version 2.4.0 mit einem neuen und noch empfind-
licheren Digimode durchgesickert. Darüber berichten wir, wenn es wirklich
spruchreif ist.
Es geht jedoch auch lauter. Zunächst noch eher selten, dürften uns bald neben
den saisonalen Short-Skip-Öffnungen wieder mehr und mehr F2-Öffnungen
auf den oberen KW-Bänder n begegnen. OK1HH konstatierte unlängst, dass
der 24. Zyklus der schwächste der vergangenen 100 Jahre war. Andererseits
wird in jüngster Zeit in vielen anderen einschlägigen Medien eine Studie
US-amerikanischer und britischer Wissenschaftler vom Juni 2020 hochgelobt,
wonach der laufende 25. Sonnenfleckenzyklus einer der stärksten jemals
beobachteten werden könnte. Nun sind − frei nach Mark Twain − Prognosen
bekanntlich schwierig, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Deswegen
erwähnte OK1HH diese Studie sachlich nüchtern in FA 9/20, ohne sich ihr
jedoch ausdrücklich anzuschließen. Ein solcher Verlauf könnte regelmäßige
F2-Öffnungen sogar bis hinauf zu 50 MHz bringen. Doch bis dahin dürfte so
oder so noch etwas Zeit vergehen.
Erfreuen wir uns also in diesem Jahr an den sich dank steigender Sonnen-
aktivität bietenden Möglichkeiten in Verbindung mit moderner Hochtechnologie
des Amateurfunks – ohne jedoch die konventionellen Sendearten wie CW
und SSB aus den Augen zu verlieren. Ein QSO auf 20 m mit Madeira oder
auf 80 m mit Norwegen in FT8 zu tätigen, muss doch nun wirklich nicht sein,
außer vielleicht mit QRPP-Sendeleistung oder um einen Punkt fürs Digital-
DXCC zu erlangen! Bei alledem kann man sogar der Corona-Pandemie
etwas „Positives“ abgewinnen, wie Ric, DL2VFR, im DX-QTC 1/21 feststellte:
„Andererseits haben wir in der Pandemie wohl gerade mehr Zeit als sonst zur
Verfügung und nutzen diese sinnvoll.“ Eben für Funkbetrieb und Experimente
mit altbewährten oder neuen Sendearten.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
DX is … locked down
Vor gut einem Jahr begann sich unser Leben zu ändern. Verhalten zunächst,
doch dann immer häufiger wurden DXpeditionen erst verschoben und
schließlich abgesagt. Erst einmal bis zum Herbst 2020. Inzwischen wissen wir,
dass auch der Herbst in diesem Jahr noch viele Fragezeichen birgt. Wir wurden
in eine Amateurfunkwelt zurückversetzt, in der es noch keine wöchentlich
wechselnden DXpeditionen gab. Damals waren DX-Stationen in seltenen
Ländern ansässig, mit Auswanderern oder mit zeitweilig beruflich verpflich-
teten Funkern besetzt. Dies erleben wir der zeit erneut.
Ein paar sehr ambitionierte DXer haben sich trotz der Pandemie für uns auf
den Weg gemacht. Wo es irgendwie möglich war, wurden DXpeditionen unter
kleinen bis großen Schwierigkeiten in die Luft gebracht. Solche Reisen waren
dann nicht selten um die eine oder andere Überraschung angereichert, wie
Quarantäne oder wiederholte COVID-19-Tests. Für solche DX-Verbindungen
waren wir zu Hause doppelt dankbar.
Doch im Wesentlichen sind wir entschleunigt und in „Lockdown und Home-
office“ gefangen. Das hat nicht nur schlechte Seiten. So kann man zwischen
zwei Videokonferenzen schon einmal das eine oder andere QSO fahren.
Trotzdem geht uns dies alles langsam auf die Ner ven. Und was soll man am
Wochenende anderes tun, als vielleicht an einem Contest teilzunehmen?
Urlaub oder Ausflüge kommen ja eher nicht in Betracht. Also müssen wir
damit leben, dass man eigentlich nur von zu Hause aus mitmachen kann und
das Erlebnis Mehrmannbetrieb außen vor bleibt. Was uns außerdem fehlt,
sind die Multiplikatoren in Form von DX. Selbstredend gibt es Wichtigeres
und Lebensnotwendigeres als Amateurfunk. Ein Leben ohne DX ist möglich.
Aber nicht uneingeschränkt sinnvoll, möchte ich einwerfen!
Was zeichnet den Menschen eigentlich aus? „Survival of the fittest”?
Sinn gemäß übersetzt bedeutet dies wohl, dass derjenige, der sich am besten
anpassen kann, überlebt und sich weiterentwickelt. Also passen wir uns doch
an: Nutzen wir Funkamateure die Möglichkeiten, die sonst keiner hat, um in
Kontakt zu bleiben. Drehen wir mal wieder übers Band und suchen nach DX,
anstatt wie so oft nur dem Cluster zu vertrauen. Sammeln wir Bandpunkte,
die wir sonst etwas geringschätzig übersehen haben. Nutzen wir die gewonnene
Zeit für das Hobby, um einmal wieder das zu tun, was sonst dem Alltag und
der Hektik zum Opfer fällt. Es muss ja nicht gleich ein 48-Stunden-Wettbewerb
sein. Tatsächlich steigt die Zahl der Contest-Teilnehmer gegenwärtig im zwei-
stelligen Prozentbereich. Schließen Sie sich diesem Trend für ein paar Stunden
an. Sie helfen damit auch anderen Hobbykollegen dabei, aufkommende
Lethargie zu bekämpfen.
Und wer jetzt seine Antennen baut, der hat im Herbst wieder das Rüstzeug
fürs DXen. Denn irgendwann kommen sie wieder, die DXpeditionen. Sogar die
Sonne wird nach großer Enthaltsamkeit wieder aktiver und verspricht uns bald
DX auf allen Bändern.
Ich kann es ebenfalls kaum erwarten, mich wieder auf den DXpeditionsweg
zu machen, sobald die Welt wieder in Ordnung kommt. Obendrein habe
ich dann erneut mit Vergnügen die „Qual der Wahl“, das DX-QTC hier im
FUNKAMATEUR mit spannenden Ankündigungen und Berichten zu füllen.
Denn momentan sind solche Meldungen noch Mangelware. Vielleicht gelingt
es uns auch, die eine oder andere neu entdeckte Aktivität oder Erfahrung
mit hinüberzuretten, in die Zeit nach der Pandemie. Mit dieser Perspektive
vor Augen:
Bleiben Sie gesund und awdh im Pile-up! DX is … coming back!
Enrico Stumpf-Siering, DL2VFR
20 Jahre WSJT
Zwei Jahrzehnte ist es nun her, seit WSJT erstmals zum Download bereitstand.
Seitdem haben WSJT, WSPR und WSJT-X ohne Frage den Amateurfunk auf
ein neues Niveau gehoben. Entwickler Prof. Dr. Joe Taylor, K1JT, fokussierte
sich mit den ersten Programmversionen noch hauptsächlich auf die Meteor-
scatter-Ausbreitung: Mit dem Modul FSK441 wurden gegenüber der bis
dahin gebräuchlichen High-Speed-Telegrafie mit ihren etwa 1500 BpM bis zu
achtfach höhere Übertragungsraten erzielt. Damit waren nun selbst kürzeste
Reflexionen für Funkübertragungen nutzbar. Auch die Demodulation per
Software machte das Scattern über ionisierte Meteoritenspuren sehr viel
einfacher. Viele Funkverbindungen am Rande des Möglichen wären ohne
FSK441 nicht machbar gewesen.
Im Laufe der Zeit kamen weitere Module zum WSJT-Paket hinzu, für EME-
Funk und KW. Mit WSPR steht seit 2008 ein Bakenmodus zur Verfügung,
der auch schwächste Signale noch decodiert. Eine weitere große Innovation
war 2017 die Einführung des FT8-Digimodes. Damit lassen sich bei leisesten
Signalen noch Funkverbindungen durchführen, was zuvor − wenn überhaupt
− nur in Morsetelegrafie möglich war. Im Unterschied zum empfindlicheren
JT65 braucht man aber nur 15-s- statt 60-s-Sequenzen. FT8 ist also ein
Kompromiss zwischen notwendiger Übertragungszeit und Empfindlichkeit.
Damit einher ging leider eine gewisse Zweckentfr emdung seitens der Anwen-
der: Obwohl FT8 als DX-Modus für niedrige Feldstärken gedacht ist, werden
überwiegend Verbindungen getätigt, bei denen die Signale problemlos auch
für SSB-Kontakte reichen würden. Es kam zu einer gewissen Fokussierung
des Funkbetriebs auf ein, zwei Frequenzen. Der Rest des jeweiligen Bandes
bleibt meist wenig genutzt.
Selbst, wenn es sich nicht um eine DXpedition handelt, reduziert sich der
Informationsaustausch nun auf das minimal Erforderliche: Rufzeichen,
Rapporte und Mittelfeld. Ob dieses contestmäßige Abarbeiten von Stationen
auf die Dauer wirklich Freude bereitet, muss jeder selbst entscheiden.
Zweifelsohne wären ohne FT8 manche für unmöglich gehaltenen Erfolge
vor allem auf 144 MHz nicht zustande gekommen: Tropo-Verbindungen über
mehr als 3000 km von Deutschland bis zu den Azoren oder Funkkontakte
über eine Kombination Tropo/Sporadic E von Deutschland bis zu den Kap-
verden, also über fast 5000 km. Darüber hinaus helfen das Reverse-Netzwerk
und PSK-Reporter − wo wurde mein Signal von wem wann gehört? − beim
Aufspüren von Bandöffnungen auf KW und UKW.
Die WSJT-Entwicklung geht auch im 20. Jahr weiter: In dieser Ausgabe
stellen wir die neue WSJT-X-Version 2.4 vor, die mit Q65 einen neuen Weak-
Signal-Modus implementiert hat. Dieser arbeitet mit modernsten Algorithmen
der Codierung sowie der digitalen Signalverarbeitung und erreicht damit
hinsichtlich der Empfindlichkeit die Möglichkeiten des bisherigen JT65, ja
übertrifft es in gewissen Bereichen sogar. Laut K1JT liegt man nun gar nicht
mehr so weit entfernt von dem Niveau, das die NASA für die Kommunikation
mit ihren Sonden erreicht. Etwa 2 dB bis 3 dB Differenz dürften es noch sein −
bei einem allerdings erheblich höheren technischen Aufwand.
Unter dem Strich hat WSJT aus meiner Sicht dem Amateurfunkdienst eine
Menge gebracht, quer über alle Bänder von LF bis SHF. Es bleibt jedoch eine
Softwareanwendung und Digimodes erzeugen bei mir selten die gleichen
Emotionen, wie eine Verbindung in SSB oder Telegrafie mit der gesuchten
DX-Station. Gleichwohl möchte ich diese auf keinen Fall mehr missen.
Ich wünsche Ihnen viel DX und viel Spaß beim Funken − auf allen Bändern
und in allen Modes.
Bernd Mischlewski, DF2ZC
Eigene Fähigkeiten trainieren
Kürzlich wanderte eine Meldung durch das Internet: „FT8 ist weiterhin die
dominierende Betriebsart“.
Deren Ursprung ist ein Blog des Betreibers von Club Log, Michael Wells,
G7VJR. Grundsätzlich sei Michael zunächst einmal unser allerhöchster Dank
ausgesprochen für die Bereitstellung des überaus nützlichen Portals Club Log.
https://clublog.org nimmt dabei, anders als etwa das DARC Community Logbook – dessen Name bereits einen Widerspruch in sich darstellt, da er Deutsch und Englisch vermischt – durchaus eine weltweit ziemlich dominierende Stellung ein. Insoweit darf man dessen Datenbestand erst einmal Glauben schenken.
Auch ich lade meine Logs dort hoch, aber tun das wirklich alle Funkamateure?
Wohl eher, wenn überhaupt, hauptsächlich die Computerliebhaber, die ihr in
FT8 geführtes QSO auch gleich dorthin verfrachten. Daher ist die o. g. Aussage
mit Vorbehalt zu interpretieren. Dass FT8 & Co. zur Intensivierung von Sende-
aktivitäten führen, ist anzuerkennen, aber Amateurfunk ist doch mehr als das
Abspulen von Minimal-QSOs − egal, in welcher Sendeart!
Freilich ist FT8 ein hilfreiches Instrument, gerade bei kurzzeitigen Öffnungen
der oberen Bänder. Nicht nur auf 6 m, sondern ebenso etwa von 15 m bis 2 m,
lassen sich durch die Anwesenheit von Stationen in diesem eng begrenzten
Digimode-Bandsegment Bandöffnungen auf einen Blick erkennen. So manch
einer mag da durchaus zum „QSO seines Lebens“ gekommen sein. Das hindert
uns doch aber nicht, auch die anderen Bandbereiche und Sendearten zu
beachten und vielleicht einmal, wenn es von den in FT8 zu erkennenden
Ausbreitungsbedingungen her lohnend erscheint, woanders CQ zu rufen!
Mein „QSO des Lebens“ − so eines, das einem wohl nie wieder glückt −
hatte ich als leidenschaftlicher Tastfunker jedenfalls auf 144,300 MHz mit
einer Station in Marseille, etwa 1200 km entfernt, was eben nur bei einer
Sporadic-E-Öffnung glücken konnte. Sie sehen es an der Frequenz: es war in
SSB, und die Freude auf beiden Seiten unfassbar groß. Was man ja in Fonie
auch äußern kann … Ebenso in CW, wo man doch wenigstens selbst im kür-
zesten DX-QSO im Pile-up noch ein „tu“ oder „dit-dit“ anhängt. In FT8 ist eine
solche persönliche Geste schwer möglich, und die von meinem Kollegen Willi
Paßmann, DJ6JZ, in FA 1/2019 beschriebene „Rückbesinnung auf persönliche
QSOs“ mittels JS8 hat sich bislang eher nicht durchsetzen können.
Wollen wir also wirklich, dass anscheinend „FT8 ... weiterhin die dominierende
Betriebsart“ ist? Unser Hobby zeichnet sich doch gerade dadurch aus, dass
es außerordentlich vielfältig ist. Ganz klar hatte FT8 anfangs den Reiz des
Neuen, den wir doch aber inzwischen alle ausgelebt haben sollten. Mit einer
mittelfristig zu erwartenden Verbesserung der Ausbreitungsbedingungen relati-
vieren sich die Vorteile der Weak Signal Modes, sodass es angeraten ist, sich
wieder der Vorteile der klassischen Modi bewusst zu werden. Denn die größere
Herausforderung für die eigenen „funkhandwerklichen“ Fähigkeiten findet man
in anderen Sendearten, ob im Pile-up oder beim DX-QSO an der Hörbarkeits-
grenze. Solche persönlichen Fertigkeiten zu trainieren und auf den Bändern
erfolgr eich einzusetzen, macht für mich einen erheblichen Teil der Faszination
des Amateurfunks aus. Zusätzlich zum persönlichen Kontakt.
Machen wir also das Beste aus FT8, nutzen wir es, wo es gegenüber anderen
Sendearten einen Nutzen bringt, aber vergessen wir die anderen Sendearten
nicht! Gerade die glücklicherweise wieder steigende Sonnenaktivität gestattet
es doch mitunter bereits jetzt wieder und bald regelmäßig, mit Australien oder
Südafrika zu im eigentlichen Wortsinn zu „telefonieren“! Darauf freue ich mich
riesig …
Ihr
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Bauelemente, ein knappes Gut
Im Mai vergangenen Jahres benötigte ich eine neue Festplatte für meine
Rechnertechnik, die jedoch erst wieder im September lieferbar war. Die im
Juni bestellten Spezialschaltkreise trafen im Dezember ein. Bei ander en
Schaltkreisen und passiven Bauelementen dauerte es noch länger. Für die im
September georderten Drehgeber lautete das Lieferdatum plötzlich 1. April
des Folgejahres. Ich fragte mich, ob dies ein verfrühter Aprilscher z war.
Viele Hersteller von Halbleiter-ICs aus Europa, Japan und den USA haben
bereits vor etlichen Jahren begonnen, die den Schaltkreisen zugrundeliegen-
den Chips bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
produzieren zu lassen. Dort sind ebenso sogenannte Fabless-Unternehmen,
also Hersteller ohne eigene Produktion, Kunde. Diese Konzentration auf einen
Standort ist nur deshalb möglich, weil TSMC besonders umfangreiche Anlagen
zur Produktion einsetzt. Dies hat zur Folge, dass jeder Typ eines Chips nur in
sehr großen Mengen rentabel produzierbar ist. Die Fertigung erfolgt nicht
kontinuierlich, sondern im Abstand mehrerer Monate, sobald wieder genügend
Anfragen eingegangen sind. In der Zwischenzeit laufen andere Typen vom
Band. Doch TSMC ist keine Ausnahme: Sinkt der Bedarf an einem bestimmten
Schaltkreis, wird dieser zwar nicht gleich aus dem Sortiment genommen,
doch seine Lieferzeit verlängert sich.
Aufgrund der Pandemie wurde seit 2020 weltweit die Produktion reduziert, da
die Nachfrage gesunken ist. Viele Gerätehersteller und die Autoindustrie sind
davon betroffen. Außerdem durften nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig produ-
zieren − vielerorts wurde auf Teilzeit umgestellt. Am Ende mussten auch eher
kleine Gerätehersteller ihre Produktion reduzieren oder zeitweise einstellen.
Für die Schaltkreishersteller stellte es sich so dar, dass viele elektronische
Bauteile nicht mehr im gewohnten Umfang benötigt wurden. Sie drosselten
daraufhin ihre Produktion. Gleichzeitig halten Distributoren keine großen
Lagermengen mehr vor, was letztlich auch solche Gerätehersteller betrifft,
die nur vergleichsweise wenige Bauelemente benötigen.
Zu allem Unglück brannte am 20. Oktober 2020 eine Fabrik des japanischen
Herstellers Asahi Kasei Microdevices (AKM) ab. Dort wurden spezielle Schalt-
kreise, etwa für Audio- und Videoanwendungen, Navigationstechnik sowie
mobile Kommunikation hergestellt, für die es keine Alternativen gibt. Andere
Werke des Herstellers verfügen nicht über die erforderlichen speziellen
Produktionsanlagen. So war AKM mit über 80 % Anteil der weltweit größte
Hersteller von temperaturkompensierten Quarzoszillatoren (TCXO). Andere
Hersteller hatten dort ebenfalls „ihre“ TCXOs bezogen und mit eigener
Bezeichnung weiter verkauft. Das Ergebnis: Die Verfügbarkeit der TCXOs
brach ein.
Eine andere Entwicklung betrifft Spezialbauteile: Kleine Hersteller werden von
größeren Unternehmen übernommen. Deren Führungsetagen entscheiden
dann oft, dass man die Produktion solcher Spezial-ICs aufgrund der zu geringen
Absatzmengen einstellt. Dies verhindert letztlich Innovationen.
Hobbyelektroniker und Funkamateure spüren seit einigen Jahren ebenfalls
die Auswirkungen solcher Lieferprobleme. Durch die fortschreitende Digitali-
sierung und die neuen Kommunikationsverfahren werden viele analoge
Schaltkreise für den HF-Bereich nicht mehr hergestellt. Es ist schon fast zur
Glückssache geworden, wenn manche Händler solche Schaltkreise noch
anbieten.
Trotz alledem sollten wir uns von unseren Projekten nicht abhalten lassen
und so wünsche ich viel Erfolg bei der Beschaffung von Bauelementen.
Dr.-Ing. Klaus Sander
Man nennt es Vereinfachung
Dieser Tage, zum 1. Juli, schließt die Europäische Kommission wieder einmal
ein Steuerschlupfloch. Nicht für Unternehmen, sondern für Privatpersonen.
Vorbei ist dann die Zeit, als bei Lieferungen aus den USA oder China die Ein-
fuhrumsatzsteuer nicht erhoben wurde, wenn der Wert der Sendung unter 22 €
lag. Auf bis zu 3,51 €, entsprechend 19% von maximal 21,99 €, verzichtete
der Fiskus bei jedem Privatimport − und das für Millionen von Bestellungen.
Durch die schiere Menge der Sendungen war es dem Zoll nur stichprobenartig
möglich, zu überprüfen, ob der auf dem Adressetikett deklarierte Wert der
Ware stimmte. Nur in Ausnahmefällen mussten Käufer ihre Bestellung beim
Zoll abholen und den tatsächlich gezahlten Preis nachweisen. Diese Praxis
und die 22-€-Grenze waren auch den nicht in der EU ansässigen Onlinehändlern
bekannt und wurden systematisch missbraucht. Der so verursachte
Steuerschaden zwang die Europäische Kommission nunmehr zum Handeln.
Mit Beginn des zweiten Halbjahrs wird die Post bei der Übergabe der
Sendung die Einfuhrabgaben für den Zoll – und zwar ab dem ersten Cent −
zuzüglich einer Bearbeitungspauschale vom Besteller kassieren. Dies, sofern
der ausländische Versender mit Sitz außerhalb der EU diese nicht bereits
bezahlt hat. Dazu haben sich übrigens Tausende chinesische Unternehmen
in den vergangenen Monaten bei den Finanzämtern registrieren lassen.
Ebay-Käufe und private Billigimporte werden also in der Regel um 19% teurer,
sofern nicht noch zusätzlich die 6-Euro-Pauschale an die Post fällig wird. Und
da die Postzusteller nicht mit Bargeld unterwegs sein sollen, wird man sich
daran gewöhnen müssen, seine Sendungen in der Filiale abzuholen.
Ab 1. Juli greift eine weitere gravierende Änderung im EU-Mehrwertsteuer-
system. Dann nämlich müssen bei sogenannten Fernverkäufen die Mehrwert-
steuersätze des Landes angewendet werden, in dem der Besteller seinen
Wohnsitz hat. Die bisherige Praxis, Waren etwa aus Deutschland an
Privatkunden in anderen EU-Ländern mit einer Rechnung mit deutscher
Mehrwertsteuer zu versenden, ist nicht mehr zulässig. Stattdessen muss die
für das jeweilige Land gültige Mehrwertsteuer berechnet und an die deutsche
Finanzbehörde abgeführt werden, die das vereinnahmte Geld dann an die
anderen EU-Länder weiterleitet.
Unser Problem – und das wahrscheinlich aller Onlinehändler − dabei ist,
dass weder die Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungssoftware noch die
Onlineshop-Systeme für diese neuen bürokratischen Hürden geeignet sind.
Wir müssen also abwarten, bis die entsprechenden Updates und Schnittstellen
verfügbar sind. Solange werden wir leider keine Privatkunden in den EU-Ländern
beliefern dürfen. Einzig Besteller aus Norwegen und von den Kanaren sind
davon nicht betroffen. Mehrwertsteuerfreie Lieferungen in Länder, die nicht
zur EU gehören, können wir wie bisher abwickeln.
Warum die Europäische Kommission in Zusammenhang mit diesen neuen
Regelungen von Vereinfachung spricht, erschließt sich mir nicht. Vor allem,
wenn man bedenkt, dass der freie Warenverkehr innerhalb der EU zu deren
wichtigsten Errungenschaften zählen soll.
In der Hoffnung auf eine Verschiebung
Knut Theurich, DG0ZB
Nachsatz: Seit einiger Zeit ist es nicht mehr gestattet, irgendwelche Waren in
Briefen ins Ausland zu versenden. Dafür bietet die Post jetzt das Produkt „Waren-
post international“ an. Leider sind derartige Sendungen aber nur unzureichend
versichert, sodass man selbst leichte für den Briefversand geeignete Waren
regelmäßig als Paket versenden muss. Weggefallen ist mit „Buch international“
zudem eine Versandart, mit der sich Bücher noch einigermaßen günstig ins
Ausland schicken ließen. Auch hier wird jeweils das Porto für ein Paket fällig.
Neues versuchen
Der Termin war im Kalender eingetragen, ich hatte mir das letzte Juniwochen-
ende für den Besuch der Amateurfunkmesse Ham Radio freigehalten. Dann
kam die Pandemie und alle größeren Versammlungen mussten ausfallen.
Das war 2020 und als der Termin für die Ham Radio 2021 veröffentlicht
wurde, trug ich mir diesen nicht in den Kalender ein. Die Skepsis war leider
berechtigt.
Weil sich die Messe Friedrichshafen aber frühzeitig zur erneuten Absage
der Ham Radio entschlossen hatte, blieb diesmal mehr Zeit zur Entwicklung
einer Alternative. Schon 2020 war es einem engagierten Team gelungen,
den angestammten Termin von Europas größtem Amateurfunktreffen trotz
Absage nicht ungenutzt verstreichen zu lassen: Das Wochenende wurde als
„Ham Radio Online“ im Internet gestaltet und war mit einem umfassenden
Programm interessanter Videovorträge über Amateurfunkthemen gefüllt.
Diese sind mit ihren zahlreichen hilfreichen Anregungen weiterhin online zur
Wiedergabe abrufbar.
In diesem Jahr hatte die Alternative zur Präsenzveranstaltung einen anderen
Namen: Die „Ham Radio World“ sollte mehr sein als eine Sammlung vorpro-
duzierter Videovorträge, sondern sich dem Charakter einer konventionellen
Messe annähern. Dafür fand sich ein Team von IT-Spezialisten zusammen,
die eine virtuelle Welt schufen und das Gelände der Messe Friedrichshafen
maßstabsgerecht „nachbauten“. Das Ergebnis beeindruckte: Wer als Besucher
früherer Amateurfunkmessen das Gelände in Friedrichshafen kannte und sich
mit den Bedienoptionen vertraut gemacht hatte, fand sich schnell in der virtu-
ellen Umgebung zurecht. Doch war dies nur der Rahmen, um ein wesentliches
Merkmal einer jeden Ham Radio zu ermöglichen: die Begegnung mit Gleich-
gesinnten und der Austausch mit Freunden, die man vielleicht nur einmal
jährlich trifft. Für solche Begegnungen und direkte Gespräche waren spontane
Videokonferenzen vorgesehen.
Ich fand es mutig von der Messe Friedrichshafen und dem DARC e.V., dieses
Experiment zu wagen. Und möglicherweise waren nicht alle virtuellen Besucher
mit dem Ergebnis zufrieden, denen vielleicht die Vorträge gereicht hätten,
die es selbstredend ebenfalls wieder zahlreich gab und die Thema des Messe-
berichts ab Seite 600 sind. Doch war das Projekt „Ham Radio World“ auch
Ausdruck dessen, was während der drei virtuellen Messetage mehr als einmal
zur Sprache kam: eine verstärkte Annäherung und Zusammenarbeit zwischen
Funkamateuren und anderen technisch interessierten Gruppen. In diesem
Zusammenhang ist es wissenswert, dass einige der beteiligten Programmierer
der virtuellen Ham Radio anfangs dem Amateurfunk nicht verbunden waren
und dann Klubmitglied wurden. Dies, weil für sie zunächst das Projekt an sich
reizvoll war und dann die dabei erfahrenen umfassenden Möglichkeiten des
heutigen Amateurfunkdienstes überzeugten.
Vieles davon ist auch mir als leidenschaftlichem Kurzwellenfunker mit einer
Vorliebe für Portabelfunk und Telegrafie bislang erst in der Theorie bekannt,
etwa Funkverfahren zur Datenübertragung weit oberhalb des HF-Bereichs.
Im Zusammenhang mit meiner Faszination für QO-100 und mit digitaler
Bildübertragung etwa für den Notfunk nähere ich mich neuen Amateurfunk-
aktivitäten an. Neben dem Bewährten, dem Bekannten gibt es so viel Neues
im Amateurfunk, das weitere Interessenten für unseren technisch-wissen-
schaftlichen Funkdienst begeistern könnte. Es gilt, den Kontakt herzustellen
und aufrechtzuerhalten.
Harald Kuhl, DL1AX
Katastrophe 2.0
Den 14. Juli werde ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Ja, Wetter-
dienste und Warn-Apps hatten Starkregen gemeldet. Aber Hand aufs Herz,
was sagt uns „Niederschläge über 120 Liter pro Quadratmeter“? Wir wohnen
in einem Haus auf einer Anhöhe am Dorfrand. Noch nie hatte Wasser dort
im Keller gestanden. Doch an diesem Abend wollte der heftige Regen nicht
enden.
Um 19.48 Uhr registrierte meine Wetterstations-Cloud einen Stromausfall.
Die Warnung per E-Mail kam nicht mehr an. Neben dem Telefon (VoIP) war
auch der Internetzugang weg. Nahezu zeitgleich fiel auch das Mobilfunknetz
aus. Damit ging auch kein Notruf mehr! Und das, während uns ein heftiges
Geräusch aus dem Keller signalisierte: Wassereinbruch. Der Versuch, noch
wichtige Dinge aus dem Keller zu retten, scheiterte weitgehend − so ganz
ohne Strom, mit nur zwei Taschenlampen ausgerüstet.
In so einer Situation ist Orientierung wichtig. Mit einem kleinen batterie-
betriebenen UKW-Radio konnten wir einen Lokalsender und ein öffentlich-
rechtliches Programm gut empfangen. Wir erfuhren: Unser Nachbardorf
war schon überflutet, direkt unterhalb der Steinbachtalsperre. Die war
übergelaufen. Es hieß, wir sollten nicht mehr in die Keller, der Damm drohe
zu brechen. Von möglichen Evakuierungen war die Rede. Von vorbeiziehen-
den Feuerwehren bekamen wir die Information, dass wir nicht evakuiert
werden sollten. Immerhin gingen noch die örtlichen Amateurfunkrelais
DB0SG bzw. DB0RHB, dort aber Stille. Im Radio ging man zum Nacht-
programm über, wir wurden über einen Stau bei Lübeck informiert. Nur
wenig später war das Lokalradio von der Skala verschwunden.
Um 4.49 Uhr am Folgetag wurden wir über Lautsprecherwagen informiert,
dass wir wegen akuter Lebensgefahr evakuiert würden. Der Rest ist bekannt:
Mehr als 170 Tote, zahlreiche Häuser und Ortsteile sind unbewohnbar. Noch
tagelang gibt es weder Strom noch Telefon oder Internet.
Die Katastrophe hat viele Schwachstellen offengelegt. BOS-Umsetzer für
Feuerwehr und Polizei funktionierten nicht, weil die Signalzuführung über
Leitung weggespült wurde. Mobilfunk-Basisstationen waren stromlos. Die
Netze waren auch später der hohen Zahl an Rettungskräften und Helfern
nicht gewachsen. Den frühzeitigen Warnungen im Rundfunk und per App
fehlten konkrete Handlungsanweisungen. Es wird dauern, all diese Mängel
zu erfassen, aufzubereiten und zu analysieren, um zukünftig Kommunikation
in Krisensituationen robuster gestalten zu können.
Aber es gibt auch Positives zu berichten: Rheinland-Pfalz hatte zeitnah in elf
Ortsgemeinden im stark betroffenen Ahrtal zwölf Starlink-Satellitenschüsseln
aufgestellt. So konnten sich Menschen vor Ort dort kostenlos in ein WLAN
einwählen und so Zugang zum Internet herstellen – Hilfe zur Selbsthilfe.
Nein, nicht die Digitaltechnik ist der Teufel, sondern Mängel in der Struktur
und hinsichtlich ihrer Ausfallsicherheit. Die Zukunft ist und bleibt digital.
Narrative aus Zeiten der Hamburger Sturmflut im Jahre 1962 (Stichwort
„Kurzwellen-Notfunk“ mit der Klopftaste) helfen uns mehr als fünfzig Jahre
später nicht weiter. Die Welt ist inzwischen eine andere geworden.
Tom Kamp, DF5JL,
HF-Referent des DARC e.V.
Eine lebenslange Passion eröffnet sich neu
Wenn man sich über 60 Jahre demselben Interesse und Hobby widmet,
dann spricht dies nicht nur Bände über die vorhandene Leidenschaft, sondern
offenbart auch eine Art magischer Flamme, die notwendig ist, um die Passion
in einer sich ständig verändernden Welt aufrechtzuerhalten.
Das Arbeiten von 340 DXCC-Gebieten ist eine lange Reise. Derzeit gibt es
9540 DXer, die alle Funkländer der Welt gearbeitet haben − ich benötigte dazu
17 Jahre! Aber wenn man sich dem Ziel nähert, wird es auch irgendwie lang-
weilig und es ist nur natürlich, nach Neuem Ausschau zu halten. Wie habe ich
es geschafft, meine Leidenschaft zu bewahren?
In meinem Fall wandelte sich die nachlassende DX-Jagd dahingehend, dass
ich selbst zum DXpeditionär wurde. Schritt für Schritt begann ich mit der
Erkundung der Welt und wandte mich immer selteneren DXCC-Gebieten zu.
Welch wundervolle neue Welt sich mir öffnete… Neue Kulturen und Heraus-
forderungen veränderten mein vorhandenes Wertesystem und ich begann die
Komplexität unserer Welt mehr und mehr zu begreifen. Für mich war es ein
Weg, zum Weltbürger zu werden und mich dort zu Hause zu fühlen, wo ich
mich in diesem Moment niedergelassen hatte.
Bald begann ich aus meinem Tun Energie zu ziehen; sowohl in Bezug auf
meine internationale berufliche Karriere als auch in Bezug auf mein Leben als
Funkamateur. Plötzlich stellte ich fest, dass meine Freunde nicht mehr nur aus
der finnischen Heimat kamen, sondern irgendwo auf der Welt wohnten. Im
Laufe der Jahre lebten meine Familie und ich auf verschiedenen Kontinenten,
sowohl im Osten als auch im Westen.
Ich erinnere mich noch an den großartigen Moment, als ich entdeckte, dass
meine Aufenthalte in seltenen DXCC-Gebieten nicht nur meinem persönlichen
Interesse und dem Interesse der DX-Gemeinde dienten, sondern auch den
einheimischen Menschen Nutzen brachten. In vielen Fällen kostete das nicht
einmal Geld, sondern es war oftmals nur eine nette Geste erforderlich, um ein
freundliches und angenehmes Gefühl zu hinterlassen. Es war gelebte
Völkerverständigung im persönlichen Umfeld.
Im Laufe der Jahre sind Alter und Erfahrung nicht mehr nur positive Kern-
attribute, da sich die Welt und insbesondere unser Amateurfunk durch neue
Technologien stark veränderte. Ich bemerkte, dass junge Menschen über
Themen redeten, mit denen ich mich zunächst schwertat. Ein Schlüssel-
erlebnis war, als ich entdeckte, dass das Lernen von der nächsten Generation
meine Eintrittstür in die Zukunft ist. Lernen von der Jugend erfordert, dass
man zuhören muss. Und geduldiges Zuhören war genau das, was uns damals
gelehrt wurde, als wir mit der DX-Jagd begannen.
Der Wandel hin zu den neuesten digitalen Sendearten, wie zum Beispiel FT8,
ist ein völlig natürlicher Vorgang. Es ist Teil der Weiterentwicklung seit den alten
Tagen, meinen Tagen − hin zu den modernen Zeiten. Wandel ist Bestandteil
der Erneuerung, der auch zu einem Neubeginn im eigenen Amateurfunk-Leben
führen kann.
Haben Sie jemals über Ihren eigenen Erneuerungsprozess nachgedacht?
Vielleicht sollten Sie das einmal tun.
Martti Laine, OH2BH
DX-Storys – und ein Dankeschön an die Bringer!
Wow, was für ein Titelbild und was für eine zugehörige Story ab S. 854 dieser
Ausgabe!
Jüngere Leser werden sich vielleicht zunächst veralbert fühlen, aber die
Vertreterinnen und Vertreter der reiferen Jahrgänge bis hin zu den Oldtimern
verstehen das bestimmt auf den ersten Blick. Danny Weil, u. a. VP2VB, war der
erste DXpeditionär aller Zeiten und Wegbereiter aller weiteren DXpeditionen…
Er war es auch, der erkannt hatte, dass unter den harten Bedingungen des
DX-Geschäfts − und freilich nur unter diesen − Fife-Nine-Thank-You-QSOs
eben die einzige Möglichkeit darstellen, um wenigstens einem kleinen Teil der
lauernden DX-Jäger ein QSO mit dem äußerst selten aktivierten DXCC-Gebiet
oder dem ersehnten Eiland „des Lebens“ zu ermöglichen.
Der Beitrag spricht mich auch persönlich außerordentlich an. Dabei wurde ich
selbst erst geboren, als Danny bereits seine FO8ON-Aktivität beendete, aber
eine QSL-Karte von Dick Spenceley, der auch im Beitrag erwähnten sagen-
umwobenen „Bandbake“ KV4AA auf 14 080 kHz, befindet sich zu Recht in
meinem Besitz. Und lustigerweise begann meine Karriere als Funkamateur
ähnlich wie bei Danny ebenfalls mit einer Panzerfunkstation, hier des Typs
10RT, ergänzt um den Allwellenempfänger Erfurt 188. Ich bin mir einigermaßen
sicher, dass etliche FA-Leser auf eine ähnliche Geschichte zurückblicken…
Genau genommen geht es aber in der mit dieser Ausgabe beginnenden
Beitragsserie, ungeachtet möglicher Parallelen, um die Anfänge des DX-
Geschäfts ab Mitte der 1950er-Jahre. Dabei hat Danny Weil in seiner schier
unglaublichen Begeisterung dafür Strapazen auf sich genommen, von denen
heutige DXpeditionäre − bis auf Ausnahmefälle, die es ja auch schon gab −
nicht einmal träumen können. Weder hochkarätiges Equipment noch eine
Hightech-Yacht konnte er sein Eigen nennen, das DX-Cluster wartete noch
Jahrzehnte auf seine Erfindung, und der von ihm an den Tag gelegte Enthusias-
mus ist wirklich phänomenal. Dabei waren ihm Mast- und Schotbruch, eigentlich
ein scherzhafter Gruß unter Seglern, im nahen Sinne des Wortes wirklich
beschert.
Und diese Geschichte erzählt uns kein anderer als Martti Laine, OH2BH, der
hier bewusst auch seine Calls AH3D und VP2VB erwähnt, wobei Letzteres
einmal Danny gehörte. Als ein so erfolgreicher DXpeditionär hat sich Martti
dieses Call wohl verdient und es wäre ganz sicher auch in Dannys Sinne.
Wer einmal archiv.funkamateur.de in die Eingabezeile seines Webbrowsers
eintippt und nach dem Autor OH2BH sucht, wird erkennen, dass uns Martti
bereits zwölf sehr schöne DX-Storys beschert hat. Wir sind daher wirklich
froh, diese Geschichte von ihm bekommen zu haben, zumal noch zwei weitere
Folgen für die Ausgaben 12/21 und 1/22 in Vorbereitung sind.
In die Reihe derjenigen, denen wir zu Dank verpflichtet sind, gehört an dieser
Stelle auf jeden Fall unser unermüdlicher Übersetzer und Bearbeiter Dr. Markus
Dornach, der bereits seit über 15 Jahren als ständiger freier Mitarbeiter für den
FA tätig ist. Markus akquiriert darüber hinaus ständig neue Stories − den an DX
interessierten Lesern ist das ganz sicher nicht entgangen.
Und wer des Schwelgens in der Vergangenheit überdrüssig ist, keine Sorge,
die brandaktuelle JW0W-Story steht bereits in den Startlöchern, siehe auch
S. 922! Zum Glück geht es ja nach dem entschärften Lockdown der Corona-
Pandemie wieder los…
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Fünf Minuten nach zwölf!
Der britische Premier Boris Johnson hat beim Glasgower UN-Klimagipfel
„COP 26“ in eindringlichen Worten vor Tatenlosigkeit im Kampf gegen die
Erderwärmung gewarnt: „Es ist eine Minute vor Mitternacht auf der Welt-
untergangsuhr!“ Man kann nur wünschen, dass er Recht behält und es
gelingt, den CO2- sowie Methanausstoß drastisch zu verringern, die weltweite
Entwaldung baldmöglichst zu stoppen und von fossilen Brennstoffen wegzu-
kommen. Erst dann wäre der vielgepriesene Umstieg auf Elektroautos wirklich
zielführend.
Angesichts der Flutkatastrophe 2021, die auch Teile Deutschlands sehr
hart traf, stimme ich gemäß meiner Überschrift Johnsons „optimistischer“
Einschätzung nicht so ganz zu. Der „Climate Action Tracker“, CAT, beziffert
die Erderwärmung angesichts der in Glasgow zugesagten Emissionsminde-
rungen auf +1,9 °C bis +3,0 °C. Deutschland will nun Treibhausgasneutralität
bereits bis 2045 und nicht erst bis 2050 erreichen, was aus dem bereits be-
schlossenen Klimaschutzgesetz 2021 hervorgeht.
Aber niemand kann genau sagen, welche schlimmen Konsequenzen selbst
das tatsächlich haben wird; die in den Medien diskutierten Szenarien stützen
sich doch lediglich auf Modellrechnungen am Computer. Die Folgen der glo-
balen Erwärmung sind bereits jetzt an der deutschen Polarforschungsstation
des Alfred-Wegener-Instituts, Neumayer III, in der Antarktis zu spüren. Zudem
handelt es sich bei den Glasgower Beschlüssen lediglich um unverbindliche
Zusagen, und China, Indien sowie die USA als die größten Kohlenutzer haben
dem bis 2030 geplanten Kohleausstieg gar nicht erst zugestimmt.
Wir Funkamateure und Hobbyelektroniker können global gesehen freilich
kaum etwas bewirken; trotzdem lohnt es allemal, das eigene Verhalten zu
hinterfragen. Dabei denke ich weniger an Binsenweisheiten wie das Anbringen
von Türdichtungen, den Einsatz von Energiesparlampen oder die Montage
von Solarpaneelen auf dem Dach. Letztere können jedoch, durch Akkumula-
toren gepuffert, beim Fieldday den knatternden Generator ersetzen. Aber
haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass sich viele Wege zu Fuß
oder mit dem Fahrrad bewältigen lassen, sofern die Verkehrssituation und
Wohnlage dies ermöglichen?
Die 750-W-Endstufe, so nützlich sie beim Pile-up ist, muss keinesfalls ständig
mitlaufen. Wenn der QSO-Partner einen Rapport S9 + 40 dB gibt, dann reicht
bereits der auf minimale Leistung gestellte Transceiver allein. Überhaupt ist es
in jedem Fall effizienter, sofern möglich, an der Verbesserung der Antennen-
anlage zu arbeiten. Obendrein nützt dies gleichermaßen beim Empfang. Der
FUNKAMATEUR hat im ausklingenden Jahr wieder eine Menge Beiträge zum
Selbstbau von Antennen veröffentlicht.
Wenn Sie selbst Ideen in dieser Richtung haben und diese mit zigtausend
Lesern teilen möchten, schreiben Sie uns bitte. Sei es eine Bemerkung für die
Postbox, ein Kurzbeitrag oder eine mehrere Seiten umfassende Bauanleitung.
Nicht jeder wird ein perfektes Manuskript abliefern können, doch unsere
Hinweise „Schreiben für uns“ auf der FA-Website helfen bestimmt weiter.
Und für den letzten Schliff sorgen unsere erfahrenen Redakteure, darauf
können Sie sich verlassen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leser, ein gesundes, friedliches
und erfolgreiches neues Jahr!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Neun Monate im Krisenmodus
geschickt habe, ahnte noch niemand, wie gravierend die Pandemie unser
aller Dasein verändern würde. Und keiner außer den Wissenschaftlern
rechnete damit, dass diese Krise so lange dauern würde. Selbst wenn bald
ein Impfstoff verfügbar ist, wird es noch mindestens ein Jahr dauern, bis ein
ausreichender Anteil der Bevölkerung geimpft ist, damit wir langsam wieder
in ein nor males Leben zurückkehren können. Wir müssen uns also auf
andauernde Einschränkungen einstellen.
Der frühe Lockdown beim FUNKAMATEUR hatte vor allem das Ziel, unser
kleines Team nicht unnötig dem Risiko von Ansteckungen auszusetzen, das
in öffentlichen Verkehrsmitteln zwangsläufig gegeben ist. Schon ein oder zwei
längerfristig Erkrankte hätten Auswirkungen auf die redaktionelle Arbeit, was
letztlich die termingerechte Fertigstellung der einzelnen Ausgaben gefährden
würde.
Ein paar Gigabyte Speicherplatz in der Cloud waren schnell gebucht, die
Weiterleitung der Telefone ins Homeoffice umgehend eingerichtet. So konnte
die Arbeit fast ohne Unterbrechung weitergehen, wenngleich alles ganz
erheblich umständlicher wurde.
Im Vergleich mit anderen sind wir Funkamateure bisher gut durch die Krise
gekommen. Das Überbrücken kurzer oder größerer Distanzen zu Funkpartnern,
also „Abstand halten“, gehört zum Wesen des Amateurfunks. Und so ist seit
Beginn des Frühjahrs-Lockdowns die Aktivität auf den Bändern spürbar ange-
stiegen. Viele haben sich Zeit genommen, um Neues auszuprobieren, wobei
der geostationäre Amateurfunksatellit QO-100 und die Digimodes FT4/8 im
Fokus des Interesses stehen. Eingeschränkte persönliche Kontakte verlagerten
sich in drahtlose Sphären, jedoch lassen sich ausgefallene OV-Abende und
Veranstaltungen nur schwer virtuell kompensieren.
Vor allem die unumgängliche Absage der Ham Radio hat die Gemeinschaft der
Funkamateure schwer getroffen. Das Zusammentreffen mit Gleichgesinnten,
zu denen man den Rest des Jahres über Funk Kontakt hält, ist normalerweise
für Tausende ein Höhepunkt des Jahres. Auch unsere Kollegen vermissen die
anregenden Gespräche mit Lesern, Autoren und Händlern.
Als Realist befürchte ich, dass es im Jahr 2021 neben dem bereits abgesagten
Funktag möglicherweise auch keine Ham Radio geben wird und keine UKW-
Tagung. Deren Veran stalter werden die Zeit sicher nutzen, um die Events
gegebenenfalls in noch anspruchsvollerer Form virtuell abhalten zu können.
DXpeditionen, Multi-OP-Conteste und andere Gemeinschaftsaktionen dürften
noch lange wegen Gefährdung der Gesundheit nicht oder nur
unter erschwerten Bedingungen durchführbar sein.
Inter essanterweise sind die Fachhändler dank ihrer Online-Auftritte bisher
gut durch die Krise gekommen. Zwar blieb der mit der temporären Senkung
der Mehrwertsteuer beabsichtigte Kaufrausch aus, aber viele Funkamateure
haben das infolge ausgefallener Urlaubsreisen gesparte Geld in neue Technik
investiert. Und weil der Nachschub aus Fernost stockte, kam es sogar zu
Lieferengpässen und Wartelisten.
Wenn ich Ihnen abschließend wünsche, dass Sie gesund bleiben, möchte
ich dies mit der dringenden Bitte verbinden, Ihren Teil dazu beizutragen,
damit weder unser Gesundheitssystem an seine Gr enzen gerät noch ein
weiterer teurer totaler Lockdown nötig wird. Es stehen uns weitere schwierige
Monate bevor.
Ihr
Knut Theurich, DG0ZB
Bundesweiter Warn- und Testtag
Am 10. September fand ein bundesweiter Warntag statt, der erste in
Deutschland seit dreißig Jahren. Diese gemeinsame Aktion von Bund und
Ländern steht fortan jährlich an jedem zweiten Donnerstag des Monats Sep-
tember im Kalender. Dabei federführend sind unsere obersten Katastrophen-
schützer vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).
Der geplante Ablauf der Übung schien eine lösbare Aufgabe: Um 11 Uhr
würde das BBK eine digitale Meldung als Probewarnung an alle sogenannten
Warnmultiplikatoren schicken, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) des
Bundes angeschlossen sind. Dazu gehören Rundfunkhäuser, Behörden und
Hilfsorganisationen, große Unternehmen, Internet- und Pagingdienste sowie
die Betreiber von App-Servern. Die Multiplikatoren sollten die Meldung an die
eigentlichen Adressaten, also an uns alle, weiterleiten. Um 11.20 Uhr würde
eine weitere digitale Mitteilung den Probealarm und damit den Warntag
beenden. Soweit zur Theorie.
In der Praxis verlief die Übung anders als geplant. Denn so mancher dürfte
erst im Nachhinein von alledem erfahren haben, und zwar in Zusammenhang
mit der bald aufkommenden Diskussion über ausgebliebene Warnungen.
Zwar informierten Rundfunksender über die Probewarnung und auf Anzeige-
tafeln der Deutschen Bahn sowie der Städte war darüber zu lesen. Doch die
auf vielen Smartphones als wichtiger Bestandteil des BBK-Warnkonzepts
installierten Warn-Apps NINA, KatWarn und BIWAPP rührten sich nicht.
Oft kam die Warnmeldung dort verspätet doch noch an, vielfach aber
auch nicht.
Die BBK-Leitung hatte die Ursache schnell gefunden: Statt wie geplant um
11 Uhr nur eine zentrale Meldung abzusetzen, hätten zeitgleich etliche ange-
schlossene Leitstellen eigene digitale Warnungen ausgelöst und damit
MoWaS überlastet. Es habe an Abstimmung gefehlt, was man bei der weiteren
Entwicklung des Systems berücksichtigen wolle. Interessanterweise lief bereits
von Oktober 2017 bis September dieses Jahres offenbar ein sogenannter
„Live-Testbetrieb“ dieses Bestandteils von MoWaS, doch die Realität hatte
nun alle Beteiligten eingeholt.
Häme ist bei alledem unangebracht, denn der in Teilen gescheiterte Warntag
brachte eine wichtige Erkenntnis und hatte damit auch etwas Gutes: Der vom
BBK geplante Ablauf funktioniert nicht und die erlebte Eigeninitiative mancher
Leitstellen kommt der Realität bei einem Katastrophenfall sicher näher als
die zentrale Warnmeldung einer übergeordneten Behörde. Die Praktiker des
Katastrophenschutzes leben und arbeiten bei uns vor Ort und auf die können
wir uns verlassen. Dies machten zahlreiche Beiträge in Radio und Fernsehen
deutlich, die im Nachgang über die örtlichen Alarmierungsmöglichkeiten
informierten. Von daher wurde ein weiteres Anliegen des Warntages, nämlich
für das Thema allgemein zu sensibilisieren, erreicht.
In diesem Zusammenhang könnten wir Funkamateure uns bei den örtlichen
Katastrophenschützern in Erinnerung bringen. Mit unseren Kenntnissen und
Geräten sind wir in der Lage, im Falle personeller oder technischer Engpässe,
auf Anforderung bei der Funkkommunikation auszuhelfen. Dass dies mehr als
Wunschdenken ist, habe ich bei einer gemeinsamen nächtlichen Großübung
selbst erlebt: Als der digitale Behördenfunk mangels Verbindung zum Relais
ausfiel, konnten wir Notfunker eine Meldung per FM-Sprechfunk letztlich
durchgeben. Die zunehmende öffentliche Wahrnehmung für das Thema
Katastrophenschutz bietet uns eine Chance.
Harald Kuhl, DL1AX
Sehr speziell
Die Pandemie stört nicht nur unser Alltagsleben, sondern ebenso die
Geschäfts- und Messetätigkeit. Vom 3. bis 5. September gab es statt einer
gewohnt pompösen IFA nur eine dreitägige Veranstaltung bei sehr beschränkter
Teilnehmerzahl, mit Online-Kommunikation und -Firmenauftritten.
Bekanntlich sieht sich die IFA in aller „Bescheidenheit“ als „Partner der
Zukunft“, wenn auch nur selbst ernannt. Möge dieser Anspruch diesmal nicht
in Erfüllung gehen. Stattdessen wollen wir doch hoffen, dass uns eine Zukunft
ohne Corona-Seuche, ohne „Special Editions“, wovon auch immer, erwartet.
Sehr speziell zeigte sich diese Not-IFA wirklich. Die Veranstalter wollten sie
offensichtlich um jeden Preis stattfinden lassen, wenn auch weit abgerüstet −
wie es der Infektionsschutz eben forderte. Also Messe ade: keine Großver-
anstaltung, kein Lärm, kein Publikum. Keine lästigen Messebesucher, die
sowieso vornehmlich nur Kugelschreiber oder Tüten sammeln und dabei das
Standpersonal mit dummen oder gemeinen Fragen, etwa nach technischen
Hintergründen, löchern. Statt derer gab es ein paar Vorträge, eine Welt-
Pressekonferenz (Global Press Conference), auf der man so tat, als wäre
ein Stück der heilen Welt noch da.
Das alles passierte vornehmlich virtuell und wurde per Video im Internet
übertragen. Nur wenigen Auserwählten wurde ein persönlicher Besuch dieser
„Special Edition“ ermöglicht, der profane Rest blieb draußen − so auch der
Berichterstatter für den FUNKAMATEUR. Es gab aber, Ehre wem Ehre gebührt,
die Möglichkeit, die wenigen Aussteller virtuell zu besuchen. So recht über-
zeugend war das alles nicht, denn es fehlte eben die Möglichkeit, die erwähnten
„dummen Fragen“ zu dem Gesagten und Gezeigten zu stellen. Und seien wir
doch ehrlich: Online kann man so ziemlich jede „Wahrheit“ verbreiten, die
sich beim direkten Anblick schnell als warme Luft entpuppen würde.
Berlin will immer noch Weltstadt werden, und so wurde für die Special Edition
ein richtig toller Werbeclaim erdacht: Tech is back. Tech steht möglicherweise
für technology (deutsch: Technik), aber back? Rücken, hinten, hinterer, rück-
wärts? Wenn man sehr, sehr gutwillig ist, und das sind wir selbstverständlich,
so könnte es bedeuten: Die Technik ist zurück. Ja, aber wo war
sie denn vorher? War sie verschwunden, emigriert? Hat sie jemand geklaut,
und keiner hat etwas gemerkt? Na, jetzt haben wir sie jedenfalls wieder, der
IFA Special Edition sei Dank! Und der englischen Sprache, die die Messe-
kommunikation in und aus Berlin dominierte. Eben Weltstadt!
An den drei Special-IFA-Tagen trafen 6100 Menschen aufeinander, fast
150 Unternehmen zeigten ihre Produkte und Innovationen gegenständlich.
1350 virtuelle Ausstellerpräsentationen im IFA Xtended Space und im
IFA Virtual Market Place wurden von über 78 000 Menschen online betrachtet,
samt der Vorträge, Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen und virtuellen
Produktvorführungen. Über 262 000 Views wurden so generiert.
Bei alledem liefen Fachpresse und einheimische Besucher nur noch auf
den allerletzten Plätzen mit, gerade noch online geduldet. Sollen technische
Fortschritte nun allein von den großen Elektronik-Handelsketten kommuniziert
werden? Der Fachpresse sollte mehr Bedeutung als sachkundige Messe-
begleiterin, auch bei zwangsweisen Online-Veranstaltungen, eingeräumt werden:
Allein die internationalen Fachbesucher sowie rund tausend IFA-Networker
und solche, die sich dafür ausgeben, können die Presse nicht ersetzen.
Freuen wir uns also auf das Jahr 2021, denn dann soll die IFA im Normalbetrieb
stattfinden und wieder Partner der Zukunft − hoffentlich ohne Corona − sein.
Wolfgang E. Schlegel
Amateurfunk und Kommunikation
Betrachtet man Entwicklungen im Amateurfunk in den vergangenen Jahren,
ist eine Umorientierung bei den Funkaktivitäten offensichtlich: Der Anteil
der Weak-Signal-Modi FT8 und FT4 erreicht im Vergleich aller Sendearten
mindestens 80 %. Dies hat zu erwartende Folgen innerhalb der gerade einmal
drei Kilohertz breiten Bandsegmente. So führten im Juli die Betreiber des
Reverse Beacon Network, dessen Hauptaugenmerk auf der Erfassung von
CW- und RTTY-Signalen liegt, eine testweise Einbeziehung von FT8-Spots
durch. Die anschließende Analyse ergab, dass dadurch eine Überforderung
der RBN-Infrastruktur möglich sei, sodass man sich eine Abschaltung der
FT8-Erfassung an Wochenenden mit CW- oder RTTY-Contesten vorbehält.
Wie ist dies zu bewerten? Richtig ist, dass die von Joe Taylor, K1JT, entwickel-
ten Sendearten zu einer Steigerung der Amateurfunkaktivitäten geführt haben,
was, auch angesichts der teilweise schwierigen Ausbreitungsbedingungen,
zu begrüßen ist. Zudem können nun Funkamateure mit Behelfsantennen oder
mit einem hohen lokalen Störpegel weiterhin ihr Hobby ausüben. Gleichzeitig
ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Sendearten nur minimale Optionen
bieten, Funkkontakten einen persönlichen Anstrich zu geben. Ebenso lässt
sich ein hoher Automatisierungsgrad beim Verbindungsablauf nicht leugnen.
In Zusammenhang mit der Popularität von FT8 stellen sich Fragen nach
Ursachen, Folgen und Alternativen. Ersteres ist noch relativ einfach zu beant-
worten: Weak Signal Modes sind unglaublich effektiv, sie können im wahrsten
Sinne neue (DX-)Horizonte eröffnen. Die Folgen sind jedenfalls kein „Amateur-
funk light“, denn Kenntnisse über Ausbreitungsbedingungen, Antennen und
Ausrüstung sind weiterhin essentiell. Zudem hat die Betriebstechnik ihre
Tücken; im FUNKAMATEUR veröffentlichen wir immer wieder Informationen
hierzu. Bleibt zu klären, wie es mit Gesprächsinhalten aussieht und was wir
unter „Kommunikation“ verstehen.
Bei der Frage nach digitalen Alternativen werden viele an Sendearten wie
PSK, SIM31 oder JS8Call denken. Diese Modi haben alle ihre Berechtigung,
doch seien wir ehrlich: Wer solche Verbindungen beobachtet, stellt schnell
fest, dass im Vergleich zu FT8 der realisierbare Informationsaustausch meist
nur um wenige Textbausteine erweitert wird. Ist durch die Auflistung der ver-
wendeten Ausrüstung oder des lokalen Wetters eine andere Qualitätsstufe
der Kommunikation erreicht?
Wohl kaum, aber lassen wir die Kirche doch im Dorf: Ein DX-Kontakt ist,
genauso wie DXpeditions- oder Contestbetrieb, keine Klönrunde. Wer einige
Dutzend Verbindungen nacheinander abwickeln möchte, sollte diese nicht
mit unrealistischen Ansprüchen überfrachten.
Wer minimalistische Übertragungsinhalte als Mangel empfindet, dem stehen,
ersatzweise oder als Ausgleich, viele weitere Spielarten des Amateurfunkbe-
triebs offen. Besinnen wir uns doch der Vorteile von SSB- oder CW-Kontakten,
die sich weniger oft auf Erstverbindungen beschränken! Ergänzend bieten
simultan nutzbare Chat-Funktionen oder der Erfahrungsaustausch über
Mailinglisten die Möglichkeit individueller Kommunikation. Nicht zu vergessen
die persönlichen Begegnungen im Funkklub. Unser Motto sollte nicht „entweder
oder“, sondern „sowohl als auch“ sein!
Sollte die Vielzahl der Optionen nicht reichen, wäre das Problem des Amateur-
funks kein durch FT8 verursachtes, sondern ein inhaltliches. Womit sich der
Fokus von einer Sendeart auf uns selbst verschieben würde.
Willi Paßmann, DJ6JZ
Gut gemacht!
Der Termin am letzten Juniwochenende war bereits im Jahreskalender vieler
Funkamateure eingetragen: Vom 26. bis 28. Juni würden die 45. Ham Radio
und das 71. Bodenseetreffen der Funkamateure stattfinden. Doch dann kam
die Corona-Pandemie und plötzlich war vieles anders. Als zur Eindämmung
des Virus Grenzen geschlossen und Mitte April zudem Großveranstaltungen
bis zunächst 31. August untersagt wurden, war die Absage von Europas
wichtigstem Amateurfunktreffen nur folgerichtig.
Viele hatten dies schon befürchtet, doch war die Enttäuschung über die
offizielle Mitteilung seitens der Veranstalter dann doch groß. Nicht nur in
Europa, wie mir Gene, K5GS, mitteilte: Er hatte bereits Flüge für eine
Europareise gebucht und wollte in Friedrichshafen über die erfolgreiche
VP8PJ-DXpedition berichten. Außerdem gehörten Informationen über ein
neues Projekt zu seinem Reisegepäck: Eine zur subantarktischen Insel
Campbell, Präfix ZL9, geplante DXpedition. „Aber im nächsten Jahr kommen
wir wieder zur Ham Radio nach Deutschland,“ zeigte er sich zuversichtlich.
Dann kündete der DARC e.V. eine Ham Radio Online für das letzte Juni −
wochenende an: Wenn es schon kein internationales Treffen im herkömmlichen
Sinn geben konnte, dann doch zumindest eine virtuelle Variante im Geiste der
Ham Radio mit Videopräsentationen im Internet. Dass am Schluss aus dieser
Idee ein dreitägiges Ereignis mit rund sechzig Stunden Programm werden
würde, damit haben die Veranstalter anfangs sicher selbst kaum gerechnet;
in diesem Umfang weltweit eine Premiere im Bereich des Amateurfunks.
Dank des Engagements und der Begeisterung zahlreicher Freiwilliger wurde dies
innerhalb von nur sechs Wochen auf die Beine gestellt. Diese anzuerkennende
Leistung war erst angesichts der Bereitschaft der vielen Beteiligten möglich,
sich ehrenamtlich für andere Funkamateure zu engagieren. Gelebter Ham Spirit.
Das Ergebnis war sehenswert, erkennbar am großen Zuspruch: Manche
Videopräsentationen verfolgten mehr als 2000 Zuschauer, was bei einer
herkömmlichen Ham Radio unmöglich gewesen wäre. Die behandelten Themen
zeigten den Facettenreichtum unseres Hobbys: Tipps für Antennenbauer oder
zur Interpretation von Funkprognosen für Kurzwelle gehörten ebenso dazu,
wie Beiträge zum Aufbau und Betrieb einer Bodenstation für den geostationären
Amateurfunksatelliten QO-100. Wer tiefer in das Thema Software Defined
Radio einsteigen wollte, fand dazu reichlich Gelegenheit in Vorträgen der SDR
Academy. DXer verfolgten Berichte über DXpeditionen, Contester erhielten
Anregungen für ihren Funksport. Hinzu kamen Beiträge mit Tipps zur Ausbildung
neuer Funkamateure und Berichte über das Klubleben während der Corona-
Pandemie.
Und vieles mehr. Mir erging es an dem Wochenende wie sonst in Friedrichs-
hafen: Das Vortragsangebot war derart umfassend, dass ich unmöglich alles
für mich Interessante verfolgen konnte. Da aber fast alle Beiträge der Ham
Radio Online nun per Internet abrufbar sind, ist das vermittelte Amateurfunk-
wissen weiterhin jederzeit zugänglich. Die Videoteams haben viele Arbeits-
stunden in die Nachbereitung investiert, und wie die Zugriffszahlen zeigen,
wird dieses Online-Angebot gerne genutzt. Auch so mancher Klubabend
dürfte sich damit gestalten lassen, inklusive anschließender Besprechung
und/oder Umsetzung des Gesehenen.
Erkennbar an vielen positiven Kommentaren während der Erstübertragung
der Vorträge, ist das Experiment Ham Radio Online gelungen. Das habt ihr
gut gemacht.
Harald Kuhl, DL1AX
Raus aus dem Shack!
Wenn Sie diese Ausgabe erreicht, hat der Sommer bereits begonnen.
Die mittlerweile mehr oder weniger gelockerten Ausgangsbeschränkungen
sollten dazu verlocken, den eventuell zum Jahreswechsel gefassten Vorsatz
in die Tat umzusetzen, sich nicht nur per Funkwellen vom Sofa aus durch
die Welt zu bewegen. Oft tritt dann der Amateurfunk in den Hintergrund.
Doch das muss nicht zwangsläufig so sein, lässt sich doch außerhalb des
Shacks ebenfalls unserem Hobby nachgehen. Will man dafür nicht gerade
einen der relativ schweren High-End-Transceiver verwenden, so ist die
erforderliche Ausrüstung heutzutage so klein und leicht, dass sie sich ohne
größere Probleme im Rucksack oder auf einem Fahrradanhänger verstaut
transportieren lässt. Antennendraht und ein leichter Teleskopmast mitsamt
Abspannungen passen zusätzlich hinein.
Bleibt noch die Frage nach der Stromversorgung am Ort des Portabelfunks.
Ein Gebäude mit Stromanschluss ist vielleicht nicht in der Nähe und ein
eventuell vorhandener Generator mit Verbrennungsmotor zu sperrig. Eine
Lösung findet man bei den Akkumulatoren. Seit einigen Jahren sind viele
neue Technologien für Hobbyanwender relativ preiswert erhältlich, sodass
der gute alte Bleiakkumulator getrost als Notstromversorgung im Shack
bleiben kann.
Gerade Lithium-Ionen- und Lithium-Eisen-Phosphat-Akkumulatoren bieten
Energie-Masse-Verhältnisse, die jeden Bleiakkumulator vor Neid gasen
lassen. Sind die benötigte Stromaufnahme beim Senden und Empfang
bekannt, lässt sich die für ein paar Stunden Funkbetrieb tatsächlich erforder-
liche Kapazität gut einschätzen. In der Regel ist man positiv überrascht, wie
klein und somit leicht ein Energiespeicher für Portabelfunk ausfallen kann.
Sofort einsetzbare Akkupacks sind in diversen Leistungsklassen bei vielen
Elektronikhändlern erhältlich. Zudem ist der Bau aus Einzelzellen möglich,
sofern man im Hinblick auf die gespeicherte Energie weiß, was man tut.
Geeignete Ladegeräte sind neben Einzelzellen und den beim Laden immer
einzusetzenden Schutzschaltungen ebenfalls verfügbar.
Das Funken außerhalb der heimischen vier Wände hat zusätzlich zum Gesund-
heitsaspekt weitere Vorteile. So kann man zumindest zeitweise Antennen
ausprobieren, die selbst im heimischen Garten nicht zu errichten wären.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Tatsache, dass der in Städten immer
stärker gestiegene Störpegel mit jedem hinter den Häusern zurückgelegten
Kilometer wieder sinkt. Somit werden Verbindungen möglich, bei denen man
den Funkpartner vom heimischen Shack aus im Störteppich schlicht nicht
aufnehmen könnte.
Und wer neben dem eigentlichen Funkbetrieb einen zusätzlichen Anreiz
benötigt, der kann seine Aktivität ja unter anderem mit dem Besteigen von
Bergen (SOTA, Sächsischer Bergwettbewerb), dem Durchwandern von
Naturparks und Reservaten (DLFF) oder dem Besuch einer Insel (IOTA)
verbinden. Für alle diese Bereiche lassen sich Punkte vergeben bzw. für
Diplome sammeln − die Anzahl der Teilnehmer steigt von Jahr zu Jahr.
Also bitte: Raus aus dem Shack und rein in die Natur! Die Möglichkeiten der
Technik sind vielfältig − wir müssen sie nur nutzen.
Ingo Meyer, DK3RED
Erweiterte Möglichkeiten auf 50 MHz
Vor 30 Jahren vergab das damalige Bundesamt für Post und Telekommuni-
kation eine begrenzte Anzahl von Sondergenehmigungen zur Nutzung des
50-MHz-Bandes an Funkamateure. Bis dahin beschränkten sich die Aktivitäten
in diesem interessanten Frequenzbereich in Deutschland auf Crossband-
Verbindungen und europaweiten Fernempfang von TV-Sendern in Band I.
Dies zu einem Zeitpunkt, als im Sonnenfleckenmaximum selbst mit kleiner
Leistung Verbindungen bis in den Pazifik möglich waren. Auflagen für Inhaber
der Sondergenehmigungen sahen Sperrzonen im Bereich der TV-Grund-
versorgung vor, jederzeitige Erreichbarkeit im Störungsfall per Telefon und
akribische Logbuchführung.
ie sofortige Betriebseinstellung bei Problemen mit Kabelkanal 2 war ein
ständiges Damoklesschwert. Nur ein gutes Verhältnis mit meinem Nachbarn,
dessen Lieblingssender ausgerechnet auf diesem Kanal lag, bewahrte mich
davor. Bei besten DX-Bedingungen kam von ihm ein Anruf und ich musste
zähneknirschend auf ein neues DXCC-Gebiet oder Mittelfeld verzichten.
Unzureichend geschirmte und unfachmännisch verlegte Kabel interessierten
niemanden. 1994 kamen weitere individuelle Genehmigungen hinzu, bis 2006,
nun durch die BNetzA, für Feststationen der Klasse A unter weiterhin strengen
Auflagen eine allgemeine Freigabe erfolgte.
Im vergangenen Jahr gelang es nach zähen Verhandlungen während der
Weltfunkkonferenz, WRC-19, dem Amateurfunkdienst in der Region 1 einen
erweiterten 50-MHz-Bereich auf weitgehend sekundärer Basis zuzuteilen.
Seit wenigen Tagen ist nun in Deutschland das komplette 6-m-Band für Inhaber
einer Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst der Klassen A und E
freigegeben; in einem Teilbereich sogar mit der jeweils zulässigen maximalen
Sendeleistung. Dafür sind wir einmal mehr den Verantwortlichen in DARC e.V.
und RTA, deren Einsatz dies ermöglicht hat, zu großem Dank verpflichtet.
Ebenso gilt unser Dank den Mitarbeitern der BNetzA und des Primärnutzers
Bundeswehr. Letzterer hatte lange Vorbehalte wegen möglicher Störungen
und machte nun den Weg für die neue Regelung frei.
Jetzt sind wir dran: Die meisten neueren Transceiver haben das 50-MHz-Band
integriert, zudem ist mithilfe von Transvertern eine Aktivität möglich. Der
Selbstbau von Antennen für diesen interessanten Frequenzbereich zwischen
Kurzwelle und UKW ist wahrlich kein Hexenwerk. Einen Platz dafür werden
wir im heimatlichen Antennenwald sicher finden.
Im FUNKAMATEUR sind genug Anregungen und Bauvorschläge erschienen,
um den Einstieg zu wagen. Während der Sommermonate gelingen selbst mit
kleinen Antennen regelmäßig ES-Verbindungen über 2000 km bis 4000 km,
etwas Gespür und Glück vorausgesetzt. Zu Zeiten des Sonnenfleckenmaxi-
mums, selbst wenn das kommende schwächer als frühere ausfallen sollte,
ist in diesem faszinierenden Band weltweiter Funkbetrieb über die F-Schicht
zu erwarten.
Allerdings sollten wir dabei weniger DX-Clustern und Ausbreitungsprognosen
vertrauen, sondern eigene Bandbeobachtungen als den sichersten Weg zum
Erfolg betrachten. Ich gehe davon aus, dass die Zahl der dem 50-MHz-Band
„Verfallenen“ rapide zunimmt. Nutzen wir also die uns Funkamateuren zuge-
standenen Freiräume! Die neue Sendeart FT8 dürfte bereits zu Zeiten mit nur
sehr geringer Ionisierung der betreffenden Ionosphärenschichten Funkbetrieb
ermöglichen − dann wirklich im Sinne des Erfinders mit schwachen und
schwächsten Signalen.
Martin Steyer, DK7ZB
Gemeinsam durch die Krise
Die aktuelle Situation stellt uns alle vor noch nie dagewesene Herausfor-
derungen. Binnen weniger Wochen hat sich das Leben in einem Ausmaß
verändert, das niemand sich hätte vorstellen können. Das öffentliche Leben
steht weitestgehend still. Niemand weiß derzeit, wie lange dieser Zustand
andauern wird und wie die immensen zusätzlichen Staatsschulden je
zurückgezahlt werden können.
Auch die Box 73 Amateurfunkservice GmbH ist von der Coronakrise betroffen,
wenngleich noch nicht in dem Ausmaß, wie Unternehmen in vielen anderen
Branchen. Schon seit 4. März arbeiten alle Kollegen im Homeoffice − dank
Internet, Cloud und Skype war das technisch kein Problem. So muss kein
Mitarbeiter öffentliche Verkehrsmitteln benutzen und eine Infektion am
Arbeitsplatz ist ausgeschlossen. Unvermeidbar kommt es zu Informationsver-
lusten, da man sich nicht direkt mit den Kollegen austauschen und Probleme
auf kurzem Wege lösen kann. Vieles ist jetzt zeitaufwendiger und manches
umständlicher. Trotzdem funktioniert die redaktionelle Arbeit sehr gut und
diese Ausgabe ist nun schon die zweite, die unter erschwerten Bedingungen
produziert werden musste.
Zeitgleich unternehmen wir große Anstrengungen, um auf eine eventuelle
Verschärfung der Krise vorbereitet zu sein. Denn es ist uns äußerst wichtig,
unter allen Umständen monatlich ein interessantes Heft an die Abonnenten
und den Zeitschriftenhandel auszuliefern.
Am meisten leidet unser Onlineshop unter der aktuellen Situation: Lieferungen
verzögern sich oder werden ganz storniert. Der Versand von Bestellungen
kann nicht mehr so regelmäßig erfolgen, wie es unsere Kunden gewohnt sind.
Längere Lieferzeiten sind die Folge, für die man uns aber viel Verständnis ent-
gegenbringt. Der QSL-Shop arbeitet zuverlässig wie immer und produziert
nach wie vor QSL-Karten in hoher Qualität.
Ähnlich wie bei uns hat die Krise negative Auswirkungen auf den Amateurfunk.
Auch die Ham Radio als wichtigste europäische Veranstaltung für Funkama-
teure ist, wie wir gerade noch rechtzeitig erfuhren, abgesagt. Weitere Events
werden betroffen sein und vieles mehr wird ausfallen müssen: Amateurfunk-
prüfungen, Fielddays, Multioperator-Contestbetrieb und OV-Abende. Als Ersatz
für letztere bietet sich allerdings deutschlandweit die Chance, die aus der
Mode gekommenen Ortsrunden auf FM-Kanälen neu zu beleben. Jeder hat
sicherlich einen VHF/UHF-Transceiver, der sich problemlos reaktivieren lässt.
Bei dieser Gelegenheit kann zudem geprüft werden, ob mit der vorhandenen
Technik Notfunkbetrieb möglich wäre, dessen Notwendigkeit gegenwärtig gar
nicht mehr so undenkbar erscheint.
Ansonsten bemerkt man, dass auf den Bändern mehr Betrieb ist; dies auch
dank „Stay-Home“-Sonderrufzeichen. Was bis auf Weiteres fehlen wird, sind
die vielen DXpeditionen, die sich nur zum Teil verschieben lassen, und auch
die meisten geplanten Urlaubsaktivitäten dürften ausfallen. Wer den Empfeh-
lungen der Virologen folgt und zu Hause bleibt, hat nun nicht nur mehr Zeit
zum Funken sondern auch zum Basteln und Experimentieren oder, um für den
FUNKAMATEUR Beiträge zu schreiben.
Bleiben Sie uns auch in der kommenden Zeit treu und gewogen.
Bitte achten Sie sehr auf sich und halten Sie die vorgegeben Verhaltensregeln
unbedingt ein, damit wir uns vom 25. bis 27. Juni 2021 auf der Ham Radio in
Friedrichshafen wiedersehen.
Bleiben Sie vor allem gesund!
Ihr
Knut Theurich, DG0ZB
Seinen Ohren trauen
Funkkontakte mit Stationen in oder nahe der Antarktis sind für mich etwas
Besonderes. Meine Faszination für Signale aus dem Südpolargebiet begann
in den frühen 1980er-Jahren, als ich mit Weltempfänger und Teleskopantenne
erstmals Radio Nacional Arcángel San Gabriel von der argentinischen Base
Esperanza im 19-m-Rundfunkband hörte. Heute nicht mehr aktiv sind Wetter-
funknetze auf Kurzwelle, über die Forschungsstationen in der Antarktis täglich
ihre Beobachtungsdaten sendeten und in das globale Informationssystem
der Wetterforscher einspeisten. Dieser Informationsaustausch läuft heute
über Satellit.
Funkamateure haben nun ebenfalls eine quasi jederzeit verfügbare
Satellitenverbindung mit der Antarktis: Die Neumayer-Station III, Deutschlands
ganz jährig besetzte Forschungsbasis auf dem Ekström-Schelfeis, hat eine
Bodenstation für den Betrieb über den geostationären Amateurfunksatelliten
QO-100 erhalten. Felix, DP1POL und DL5XL, war im Februar regelmäßig unter
DP0GVN in SSB über diesen Satelliten aktiv und beeindruckte mit kräftigen
Signalen sowie zügigem Funkverkehr in den sich entwickelnden Pile-ups.
Roman, HB9HCF, gehört als Elektroniker zum aktuellen Überwinterungsteam
von Neumayer III und dürfte in den kommenden Monaten über QO-100
aktiv sein.
Eine derart stabile und auch für Nichtfunker gut verständliche Sprechfunk-
verbindung mit DP0GVN, wie sie QO-100 jetzt ermöglicht, war bislang kaum
planbar. Vor einigen Jahren hatten wir in einer örtlichen Schulstation Besuch
von der Tagespresse, um einen Sprechfunkkontakt mit der Neumayer-Station
auf Kurzwelle vorzuführen und so unseren Amateurfunkdienst öffentlichkeits-
wirksam zu präsentieren. Der Kontakt kam an dem betreffenden Abend
schließlich zustande, doch war dies der Geduld aller Beteiligten zu verdanken.
Für nicht mit den Eigenheiten der Kurzwelle vertraute Beobachter wohl
beeindruckender, und dies schreibe ich als leidenschaftlicher Kurzwellenfunker,
wäre heute ein solcher Schulkontakt mit der Antarktis über QO-100. Hier bietet
sich eine weitere Möglichkeit, für unseren Amateurfunkdienst öffentliches
Interesse zu wecken.
Das Potenzial des Kurzwellenfunks wiederum ließ sich bis Anfang März
während einer anderen Funkaktivität in der Region erleben: Die Pile-ups
einer internationalen DXpedition auf den Südlichen Orkneyinseln waren wie
zu erwarten immens. Mich beeindruckte die Regelmäßigkeit, mit der VP8PJ
von Europa aus zu erreichen war; mitten im Sonnenflecken-Minimum. Wer die
Frequenzen beobachtete und auf einen günstigen Ausbreitungspfad wartete,
hatte gute Chancen auf einen Kontakt.
Mit ihrer Satellitenverbindung, die unter anderem zum Hochladen des Logs
vorgesehen war, hatte die DXpedition weniger Glück: Ein Berg verhinderte den
Kontakt zum kommerziellen Kommunikationssatelliten und so mussten die DXer
weltweit ohne den mittlerweile üblichen Komfort eines regelmäßig aktualisierten
Online-Logs auskommen. Stürme der Entrüstung entfalteten sich daraufhin in
den DX-Clustern. Erst als der Upload nach Ende der DXpedition vom Schiff aus
gelang, legte sich die Aufregung. Offenbar trauten etliche DXCC-Sammler ihren
eigenen Ohren nicht und verlangten zeitnah eine Online-Bestätigung, dass sie
von VP8PJ tatsächlich ihr eigenes Rufzeichen gehört hatten. Solche Zweifel
waren unbegründet, denn die erfahrenen DXpeditionäre pflegten eine hervor-
ragende Betriebstechnik. Zudem sollte gewohnter Komfort nicht in Anspruchs-
denken oder gar Abhängigkeit münden.
Harald Kuhl, DL1AX
Faszination DX auf dem 2-m-Band
Ich erinnere mich noch gut an meine ersten DX-Kontakte über troposphärische
Überreichweiten, kurz Tropo: Im Oktober 1977 ging es aus DK50d, heute
Locator JO30XJ, auf 2 m plötzlich bis nach Polen, Ungarn und Rumänien.
Das CW-Subband war voller lauter Signale und man hatte Mühe, eine freie
Frequenz zu finden. Die Faszination, dass man statt der üblichen 300 km bis
400 km plötzlich mit 10 W über eine Yagi-Antenne mehr als 1000 km weit
funken konnte, hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
Insbesondere die im vergangenen Jahr gemeldeten − und bis dahin in Europa
für unmöglich gehaltenen − QSO-Erfolge zeigen auf, dass auf 144 MHz und
432 MHz das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. Wer hätte sich
jemals vorstellen können, dass man aus Deutschland auf 2 m via Tropo bis zu
den über 3000 km entfernten Azoren funken kann? Oder dass aus England
und Schottland auf beiden Bändern Funkverbindungen über Distanzen von
mehr als 4600 km bis zu den Kapverden möglich sind? Wer weiß, welche
DX-Ereignisse diese Form von Überreichweiten für uns noch bereit hält?
Insbesondere 144 MHz bietet eine Fülle verschiedener Ausbreitungsarten:
neben Tropo noch Sporadic E, Meteor-Scatter, Radio-Aurora, Feldlinienorien-
tierte Irregularitäten (FAI), Tropo-Scatter, Iono-Scatter sowie Erde-Mond-Erde.
Dadurch ist dieses Amateurfunkband wohl einzigartig.
Der FUNKAMATEUR trägt dem Rechnung, so haben wir im Januar und jetzt
Bakenkarten abgedruckt. Auf unseren Blauen Seiten im Februar sowie in der
vorliegenden März-Ausgabe erläutern wir den Sinn von Funkbaken, wie man
diese beobachtet und welche Rückschlüsse sich daraus auf Überreichweiten
ziehen lassen. Auf den Seiten 228 bis 231 finden Sie zum Thema Tropo
außerdem einen kommentiert nachgedruckten Beitrag aus dem Jahre 1970:
Schon damals hatten Christoph, OE3LI, und Gerhard, DM2BEL, − beide
zwischenzeitlich verstorben − das Entstehen troposphärischer Überreich −
weiten anschaulich erklärt. An deren grundsätzlichen Aussagen hat sich in
den vergangenen 50 Jahren substantiell nichts geändert.
Ebenfalls unverändert gilt die Regel, dass bei solchen Öffnungen Standort vor
Stationsausrüstung geht. Sofern die eigene Antenne nicht gerade in Richtung
Berg strahlt, gelingen bereits mit einer 4-Element-Yagi und 10 W schöne
Verbindungen. Darüber hinaus hat uns die technische und softwaremäßige
Entwicklung mit den WSJT-Modes, insbesondere FT8, mächtige Werkzeuge
an die Hand gegeben, um bereits mit geringer Sendeleistung und schwachen
Signalen Weitverbindungen zu tätigen. Einige Kurzwellen-Transceiver haben
das 2-m-Band bereits integriert, mit 50 W oder sogar 100 W Sendeleistung.
Für eine geeignete Antenne ist auf dem Dach oder einem Mast oft noch Platz.
Das 2-m-Amateurfunkband ist allerdings für andere Funkdienste ebenfalls
attraktiv. Das zeigte der Versuch der französischen Administration vom ver-
gangenen Jahr, darin eine parallele Nutzung durch Amateurfunk und mobilen
Flugfunkdienst durchzusetzen. Dies ließ sich nur durch eine konzertierte
Aktion europäischer Amateurfunkorganisationen, deren nationaler Regulie-
rungsbehörden und der IARU erfolgreich abwehren. Es wird wohl nicht der
letzte Angriff gewesen sein.
Deshalb gilt: „Use it or lose it“. Funken Sie doch wieder einmal auf 2 m − nicht
nur beim Contest, und nicht nur in FT8. SSB und CW haben ihren besonderen
Reiz, man hört seinen Funkpartner oder dessen CW-Handschrift. Zudem
kommt bald der Frühling: Also Antenne aufs Dach, Kabel ziehen und loslegen.
Oder vielleicht auf einen Berg oder eine Hochebene fahren und von dort aus
dem Auto funken. Zudem ist das 2-m-Band für Portabelfunk bei SOTA-Funkern
beliebt.
In diesem Sinne: viel DX auf 2 m!
Bernd Mischlewski, DF2ZC
Amateurfunkgeschichte bewahren
Das Dokumentationsarchiv zur Erforschung der Geschichte des Funkwesens
und der elektronischen Medien, kurz DokuFunk, in Österreichs Hauptstadt
Wien ist vielen Lesern seit Jahrzehnten als QSL-Collection bekannt. Zahlreiche
langjährige Funkamateure haben dort bereits ihre „erfunkten“ QSL-Samm-
lungen hinterlegt. Auch die Yasme-Foundation schickte den gesamten
QSL-Schatz von Lloyd Colvin, W6KG, und seiner Ehefrau Iris, W6QL, zur
Bewahrung nach Wien. Diese einmalige Dokumentation ihrer bei DXpeditionen
in 25 Jahren getätigten Funkverbindungen ist bei DokuFunk wohl geordnet
erfasst und archiviert, s. a. den Beitrag ab S. 130.
Zur reinen Aufbewahrung bedeutender QSL-Sammlungen kommt in Wien
die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte des Amateurfunks hinzu:
Persönlichkeiten, Hintergründe, Ziele, Zusammenhänge, politische Umfelder,
exakte zeitliche Einordnungen usw. Als wichtige Quellen dienen daher eben-
falls Bücher, Zeitschriften, Protokolle, Rundschreiben, Bulletins, Plakate−
also Publikationen und Schriftgut aller Art. Dieses Material gilt es ebenfalls
zu bewahren. Zum Traditionellen kommt das Moderne hinzu, denn die digitale
Welt bietet ungleich mehr Informationen und Details. Diese sind in die Abläufe
der Geschichte aufzunehmen, einzuordnen und zu pflegen.
Gemeinsam mit dem Stammpersonal bereiten ehrenamtliche Mitarbeiter in oft
mühsamer Kleinarbeit Informationen über Entwicklungen beim Amateurfunk
auf und stellen diese Interessenten zur Verfügung. Solche Nachnutzung ist für
Historiker, Journalisten sowie Studenten vieler Wissensgebiete als zusätzliche
Informationsquelle besonders interessant. Zur Erstellung historischer Aufarbeit-
ungen und Präsentationen können zudem Amateurfunkverbände und einzelne
Funkamateure das Archiv nutzen. Gegen Erstattung von Versand kosten zuzüg-
lich einer Spende erhalten Interessenten Informationen sowie QSL-Dubletten
aus dem Bestand.
Doch befasst sich DokuFunk nicht alleine mit Amateurfunk. Zusätzlich bewahren
die Wiener beträchtliche Sammlungen von Rundfunk- und Fernsehdokumenten,
einschließlich Rundfunkhörer-QSLs aus aller Welt. Der Österreichische Rund-
funk, ORF, stellt DokuFunk hierfür die im vergangenen Jahr bezogenen neuen
Räume in einem im Südwesten Wiens gelegenen Gebäude zur Verfügung.
Der Umzug in ein neues Domizil, das für die Zukunft dem weiter wachsenden
Archiv ausreichend Raum bietet, war dringend notwendig. Immerhin umfassen
die über zwei Millionen bereits erfassten und geordneten QSL-Karten nur 25%
des aktuellen Gesamtbestands. Mit viel Kraft und Engagement bewältigten
die Mitarbeiter den Umzug Mitte 2019.
Für die Leitung der Stiftung DokuFunk ist ein vierzehnköpfiges Kuratorium
zuständig. Dessen Leitung hat Professor Wolf Harranth, OE1WHC, Mitte
Oktober vergangenen Jahres in jüngere Hände gelegt, die das in 30 Jahren
mit viel Elan und Geschick aufgebaute Archiv weiterführen. Geschäftsführende
Kuratorin ist nun Paulina Petri, OE1YPP. Trägerorganisationen, Partner,
Fördermitglieder und Sponsoren sichern die Finanzierung von DokuFunk.
Das Archiv lebt von Zeitzeugnissen. Es ist eine Frage der Mitverantwortung
und des Respekts gegenüber der Geschichte aller jener, die an entscheidenden
Prozessen der Entwicklung des Amateurfunks mitgewirkt haben. So gesehen
ist es wichtig, seine eigenen Archive beizeiten den Fachleuten in Wien zu
überlassen, bevor die Enkel aus Unkenntnis wichtige Dokumente dem Reißwolf
übergeben.
Es gilt das Motto von DokuFunk: „Alles was hier ist, wäre nicht mehr, wäre es
nicht hier“.
Hardy Zenker, DL3KWF
Elektronikhobby im Wandel der Zeit
Angenommen, lieber Leser, Sie waren in Ihrer Jugendzeit begeisterter Funktechnik- und Elektronikbastler, hatten zwischendurch dafür keine Zeit mehr und steigen heute wieder ins Hobby ein. Wenn Sie jetzt nach interessanten Projekten Ausschau halten, würden Sie sich zunächst wahrscheinlich erstaunt die Augen reiben. Denn es hat sich in der Zwischenzeit eine Menge getan, was angesichts des rasanten technischen Fortschritts nicht verwunderlich ist. Junge Bastler heißen heute neudeutsch Maker und die Fortgeschrittenen unter ihnen beschäftigen sich hauptsächlich mit Mikroprozessoren sowie Kleincomputern und deren Peripherie.
Die Inventur Ihrer alten „Bastelkiste“ fördert die seinerzeit vom gesparten Taschengeld gekauften Bauteile zutage, die aber größtenteils heute nur noch Museumswert haben. Ein Blick auf die aktuelle Beschaffungssituation zeigt, dass die seinerzeit etablierten Händler entweder verschwunden sind oder diese ihr Bauteilsortiment merklich ausgedünnt haben. Hinzugekommen sind einige große Distributoren mit einer Angebotsvielfalt, die früher ihresgleichen suchte.
Mit etwas Wehmut werden Sie vielleicht den altbekannten Halbleiterbauelementen mit Anschlussdrähten oder den Standard-ICs im DIL-Gehäuse nachtrauern. Neue Schaltkreise sind erheblich kleiner, komplexer und leistungsfähiger, wobei Letzteres diese für Hobbyelektroniker interessant macht. Dank des hohen Bedarfs der Industrie für die Produktion von Mobilfunk- und drahtloser Netzwerktechnik sind preisgünstige aktive HF-Bauelemente verfügbar, die bis weit in den Gigahertz-Bereich hinein technische Daten aufweisen, von denen man früher nur träumen konnte. Dazu gehören programmierbare Verstärker, Dämpfungsglieder, Quarzoszillatoren, logarithmische Detektoren, miniaturisierte Filterstrukturen bis hin zu kompletten Sendeempfängermodulen.
Wegen ihrer Gehäusebauform mit wenigen Millimetern Kantenlänge sowie Lötflächen, die kein Lötkolben mehr erreicht, sind diese jedoch für den Hobbyanwender kaum noch handhabbar. Die Lösung bieten preisgünstige kleine Platinen, auf denen jeweils eines dieser Bauelemente zusammen mit einigen peripheren Bauteilen bestückt ist. Sie stammen von fernöstlichen Lieferanten, die offenbar eine Marktlücke erkannt haben.
Für den Hobbyelektroniker besteht die Herausforderung zunächst darin, auf den bekannten Handelsplattformen im Internet, wie E-Bay und Amazon, das Richtige für sein Projekt zu finden. Bei elektronisch steuerbaren Bauelementen bzw. Baugruppen hilft uns die in den vergangenen Jahren rasant gewachsene Mikrocontrollerszene um Arduino & Co. mit einfachen, im Internet frei verfügbaren Entwicklungsumgebungen und reichhaltigen Softwarebibliotheken. Softwareentwicklung gehört inzwischen ohnehin zum Elektronikhobby und ist längst nicht mehr die Domäne weniger Spezialisten. Beides, sowohl Löten als auch Programmieren, hat seinen Reiz und die Erfolgserlebnisse fühlen sich sehr ähnlich an.
Unser Anliegen ist es, Elektronikbastler mit Wissen, Ideen und Hilfestellungen zu unterstützen. Die Bausätze vom FA-Leserservice sind auch für Einsteiger nachvollziehbar und so konzipiert, dass beim Aufbau praktisch nichts schiefgehen sollte. Im Gegenzug freuen wir uns über Ihre Zuschriften und Projektbeschreibungen, die uns dabei unterstützen und den FUNKAMATEUR inhaltlich bereichern.
Man darf übrigens gespannt sein, wie die Bastlerszene in zwanzig Jahren aussieht. Vermutlich belächelt man dann unsere heutige Technik.
Peter Schmücking, DL7JSP
FA-Leserservice
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Auf ein Neues!
Das Amateurfunk-Highlight des Jahres 2019 war sicher die Inbetriebnahme
des Amateurfunktransponders AMSAT QO-100 auf dem geosynchronen
Satelliten Es’hail-2. Dank der Mitwirkung ambitionierter Autoren haben wir
Sie mit einer Reihe von Beiträgen zum Funkbetrieb über diesen fliegenden
Umsetzer unterstützt. Dies setzen wir mit weiteren Bauanleitungen fort.
Das ausklingende Jahr hat uns zudem schöne terrestrische Funkverbin-
dungen beschert − sogar auf den von der Talsohle der Sonnenaktivität stark
betroffenen oberen KW-Bändern. Nicht nur FT8 & Co. haben das ermöglicht,
sondern hochempfindliche Transceiver, ausgeklügelte Antennen und
das schnelle Bekanntwerden von Bandöffnungen dank DX-Cluster, RBN
und PSK-Reporter. Zwar kann man nicht täglich auf 10 m mit Australien
„telefonieren“, wie dies im Sonnenfleckenmaximum selbst mit QRP gelang,
aber insbesondere während der großen Conteste dürfte dennoch so manche
aufregende Verbindung geglückt sein.
Auf der anderen Seite können jedoch viele Funkamateure die leisen DX-Signale
trotz modernster Technik nicht mehr aufnehmen, weil das S-Meter am häus-
lichen Transceiver infolge des örtlichen Störnebels bei S9 geradezu „klebt“.
Aufgeben muss man deswegen noch lange nicht. Denn wir sind nicht
machtlos: Vielmehr gilt es, solche Störungen zu identifizieren, Verursacher
zu lokalisieren und, soweit möglich, dagegen anzukämpfen. Auch dabei
möchten wir als Fachzeitschrift Sie mit Ihren Problemen nicht allein lassen.
Vielleicht befindet sich eine solche Störquelle sogar im eigenen häuslichen
oder benachbarten Umfeld, sodass bereits ohne Inanspruchnahme der
Bundesnetzagentur Abhilfe möglich ist? Dazu braucht es neben der Technik
auch Kenntnisse und Erfahrungen. Wir verfügen heute über tolle SDRs,
die mehrere Megahertz breite Segmente, mitunter sogar den gesamten
KW-Bereich, auf einen Blick visualisieren. So lassen sich leicht charakte-
ristische Muster bestimmter Signaltypen erkennen − PLC stellt sich ganz
anders dar als das Störspektrum eines Schaltnetzteils oder einer der vielen
LED-Leuchten. Haben Sie diesbezüglich bereits Erfahrungen gesammelt?
Wir möchten Screenshots sowie Soundfiles sammeln und katalogisieren,
um allen Lesern das Identifizieren von Störquellen anhand deren charakte-
ristischen „Fingerabdrucks“ zu ermöglichen. Dazu bedarf es Ihrer Mithilfe −
schicken Sie uns bitte entsprechendes Material! Ebenso interessieren uns
Ihre Erfahrungen beim Orten solcher Störquellen.
Eine weitere und obendrein potenziell die Gesundheit fördernde Möglichkeit,
dem urbanen Störnebel zu entrinnen, besteht im Portabelbetrieb. Auf Bändern
oberhalb 70 cm geht es ja kaum anders, aber dem KW- bis hinunter zum
Lang- und Mittelwellen-Funkbetrieb ist dies gleichfalls zuträglich. Die feder-
leichten GFK-Masten eröffnen uns seit Jahren Möglichkeiten, von denen
unsere Altvorderen nicht einmal zu träumen wagten.
Eine raffinierte vertikale Antenne für den Portabelbetrieb von 40 m bis 10 m
präsentierte Martin Steyer, DK7ZB, in FA 11/2019. Haben Sie vielleicht eine
ähnlich nützliche Antenne, gern auch für VHF/UHF, ausgetüftelt und erprobt?
Wir freuen uns auf Ihre Ideen – und die anderen Leser bestimmt ebenfalls.
In diesem Sinne bedankt sich die Redaktion bei denjenigen unter Ihnen,
die hin und wieder selbst „zur Feder“ gegriffen haben oder greifen werden −
angefangen von der zweizeiligen Kritik per E-Mail bis hin zu mehrseitigen
Fachbeiträgen zu den oben angesprochenen oder gänzlich anderen Themen,
wie etwa Elektronik und Smart Home. Ein ebenso herzliches Dankeschön an
Sie, liebe Leser, für Ihre Treue!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Das große Missverständnis
In Zeiten des Internets und der allgegenwärtigen Smartphones ist Amateur-
funk hoffnungslos altmodisch − das hört man immer wieder. Doch stimmt
dies tatsächlich? Letztlich ist auch das Mobiltelefon ein Funkgerät, man
kommuniziert also wie beim Amateurfunk über elektromagnetische Wellen.
So weit, so vereinfachend.
Doch haben Sie schon einmal versucht, per Mobiltelefon einen CQ-Ruf
abzusetzen und mit Spannung abzuwarten, welcher nette Zufallskontakt sich
nun ergibt? Wohl kaum! Vielmehr tippt man eine bestimmte Telefonnummer
ein und weiß im Voraus ganz genau, wen man erreichen will und welche
Informationen über die vom Netzbetreiber aufgebaute Verbindung dann
ausgetauscht werden sollen. Ist dies Spannung, Spaß und Unterhaltung?
Nein, es ist zweckgebundener Informationsaustausch, bei dem die beiden
isolierten Teilnehmer von vornherein feststehen.
Zugegeben, es gibt die sogenannten Chatrooms im Internet. Bei diesen
weiß man vorher nicht, wer einem antwortet. Manchmal verkommen solche
„Verbindungen“ jedoch zu anonymen Postings von Halbwissenden. Gedanken
über Technik, Ausbreitungsbedingungen und Verbindungsqualität braucht
man sich dort nicht zu machen. Das Internet ist ja weltweit stabil vernetzt.
Jedenfalls, wenn auf „Robinsons einsamer Insel“ ein zuverlässiger Netz-
zugang vorhanden ist oder man sich nicht in einem selbst hier nicht seltenen
Funkloch befindet.
Doch was hat dies mit Amateurfunk zu tun? Nichts, denn Mobiltelefon und
Internet sind heute alltägliche Kommunikationsmittel. Amateurfunk ist dagegen
ein ganz besonderes Hobby mit zahlreichen unterschiedlichen Spielarten und
Facetten.
Da gibt es die Techniker, denen es weiterhin Freude bereitet, mit Eigenbau-
geräten Funkstationen auf der ganzen Welt zu hören − oder von diesen selbst
gehört zu werden. Für die Contester ist die Jagd nach vielen Funkkontakten
eine sportliche Herausforderung − ohne die bequeme Sicherheit einer garan-
tierten DSL-Datenrate. Wieder anderen Funkamateuren ist es ein Anliegen,
mit Funkfreunden auf allen Kontinenten persönliche Kontakte zu pflegen
und/oder sich dabei in Fremdsprachen zu üben.
Die Faszination, auf verschiedenen Bändern die Ausbreitungsbedingungen
zu testen, den Einfluss von Sonnenflecken zu untersuchen oder gar mittels
Funkwellenreflexionen über unseren Erdtrabanten, den Mond, zu kommuni-
zieren, bieten weder Internet noch Smartphone.
Funkamateure entwickeln eigene Kommunikationssatelliten, die in eine
Erdumlaufbahn gebracht werden. Sie studieren Wetterphänomene, die zu
Überreichweiten führen. Sie experimentieren mit Antennen, um deren
Strahlungseigenschaften zu untersuchen. Sie entwickeln digitale Sendearten,
bei denen die Signale im Computer aufbereitet werden − von Packet-Radio
bis zum digitalen Amateurfunkfernsehen.
Und Amateurfunk kann mit einer eigenen Stromversorgung auch völlig
autonom funktionieren, ohne Funkmasten oder Leitungssysteme…
Neben den kommunikativen Aspekten tragen Funkamateure damit zum
technischen Fortschritt bei. Wenn wir diese vielfältigen Möglichkeiten mit
Begeisterung an potenzielle Neueinsteiger vermitteln, sollte uns um den
Fortbestand unseres faszinierenden Hobbys nicht bange sein. Wir müssen
es nur tun. Denn manchmal ist eben alles nur ein großes Missverständnis…
Dr. Reinhard Horn, DD6AE
Licht und Schatten auf der IFA
Wären für die Weltläufigkeit unserer Hauptstadt das Vermeiden der deutschen
Sprache und das ungehemmte Verwenden angelsächsischer „Fachbegriffe“
entscheidend, so hätte es Berlin, zumindest auf dem Messegelände am
Funkturm und während der IFA, schon geschafft. Leider lassen die dort frisch
gedichteten Anglizismen immer noch die Provinz durchschimmern, trotz
gegenteiliger Behauptungen. Rühmliche Ausnahmen gab es, bemerkens-
werterweise, von etlichen asiatischen Herstellern, auch die großen deutschen
Elektrogeräteproduzenten bedienten sich zu Hause der deutschen Sprache
und boten den Ohren fremdländischer Gäste Simultanübersetzungen.
So soll es sein.
Wie in jedem Jahr feierte sich diese Messe als die größte, bedeutendste und
wichtigste IFA aller Zeiten. Trotz aller Übertreibungen wurden unter dem
Funkturm auch aktuelle Trends wie die Anwendung künstlicher Intelligenz
oder die Vernetzung der Wohnsphäre sichtbar: Es gibt nun vernetzte Wasch-
maschinen, Herde mit neuronalen Netzen und intelligente Kaffeeautomaten,
mit denen der Kaffee gleich noch mal so gut schmeckt. Was sich auf dem
Markt durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.
Auf Schrumpfkurs hingegen schien die Unterhaltungselektronik zu sein, die
in einigen Teilen recht gleichförmig daherkam. Vier bis fünf große Anbieter
von TV-Geräten dominieren heute das technische Niveau mit durchaus
ansehnlichen Modellen, und die Mitbewerber versuchen, Schritt zu halten.
Dabei sind sie oft abhängig von Zulieferungen der Großen, z. B. bei den
modernsten Displays. Nach dem traurigen Abgang von Loewe und der
IFA-Abstinenz von Technisat ist mit Metz nur noch ein deutscher TV-Geräte-
hersteller auf der Messe übriggeblieben, und der hat den chinesischen
Besitzer Skyworth.
Anspruchsvolle Audiotechnik war einst ein Magnet. Es gibt sie noch, aber die
Traditionsunternehmen haben zu kämpfen. Neugründungen wollen teilhaben,
besonders am wachsenden Kopf- und Ohrhörermarkt. Mit langweiligen
technischen Daten geben die sich aber kaum ab, tun bunte Farben und flotte
Sprüche es nicht auch? Die Musikbeispiele zeigten, dass sich viele neue
Anbieter an ein Publikum wenden, dem Wiedergabequalität nicht nur
gleichgültig ist, es braucht sie einfach nicht.
Branchenübergreifend stand auf der diesjährigen IFA die Anwendung künst-
licher Intelligenz im Brennpunkt der Messe, mit interessanten und überzeugen-
den Exponaten. Doch Skurriles durfte auch hier nicht fehlen: In einer Studie,
deren Ergebnisse auf der Pressekonferenz eines großen deutschen Herstellers
von Haushaltgeräten vorgetragen wurden, konnte nachgewiesen werden,
dass „Metropolitan Lifestyler“ vornehmlich in großen Städten zu finden seien.
Diese Gruppe ist tagaus, tagein damit beschäftigt, dem Lifestyle hinterher-
zujagen bzw. ihn genussvoll auszuleben, sodass sie keine Zeit mehr für andere
Dinge hat. Bestenfalls zeigen diese Lifestyler, so die Studie, mal ihre schicke
Küche, die genau dem Lifestyle entspricht und auf die sie mächtig stolz sind.
Wegen des notorischen Zeitmangels dieser Menschen kreiert die Industrie
immer „intelligentere“ Geräte, die ihren Besitzern lästige Arbeiten abnehmen.
Die neuen technischen Helfer kochen, backen, braten selbst, sie erkennen
die schmutzige Wäsche für die Waschmaschine und behandeln diese
entsprechend. Und nun? Die modernen Zeitgenossen können sich müßig
auf dem Sofa räkeln und sich an den Programmen auf ihren Super-Großbild-
UHD-Fernsehgeräten erfreuen. Aber: Wollen wir das alles wirklich?
Wolfgang E. Schlegel
Jegliches hat seinen Zweck
Auf der Ham Radio wurde der Nobelpreisträger, Astrophysiker und Funk-
amateur Joe Taylor, K1JT, mit dem Rudolf-Horkheimer-Preis geehrt. Eine gute
Entscheidung, hat doch kaum jemand den Amateurfunk in diesem Jahrhun-
dert so vorangebracht wie er. Joe hat für die Informationsübermittlung mithilfe
von extrem schwachen, akustisch kaum oder nicht wahrnehmbaren Funksig-
nalen Computerprogramme und Kommunikationsprotokolle entwickelt. Das
2001 erstmals vorgestellte Programmsystem WSJT revolutionierte zunächst
den EME- und Meteor-Scatter-Betrieb.
Wer sich an die Veröffentlichungen von Olaf Oberrender, Y23RD bzw. DL2RSX
aus dem FA von 1987 und 2001 oder an vergleichbare Publikationen erinnert,
weiß, welcher immense Aufwand damals notwendig war, um wenigstens
einmal mit den „Big Guns“ via EME auf 144 MHz in Kontakt zu kommen.
Dank WSJT genügen heute eine einzelne Yagi und 100 W Sendeleistung.
Mit der ursprünglich für 50-MHz-DX entwickelten Sendeart FT8 hat WSJT seit
Sommer 2017 einen weltweiten Siegeszug angetreten und ermöglicht nun
DX-Verbindungen mit geringer Leistung und/oder einfachen Antennen auf KW
− trotz des gerade herrschenden Minimums der Sonnenaktivität. Ich hatte
Anfang 2018 im FA mit „Digimode FT8 im DX-Verkehr“ den Einstieg für Leser,
die mit Digimodes bisher wenig vertraut waren, detailliert beschrieben.
Wenn Kritiker FT8 ablehnen, weil hier bloß Computer miteinander funken
würden, kann ich dem nur entgegenhalten: Versucht erst einmal, das DXCC-
Diplom in FT8 zu erarbeiten! Zwar ist der eigentliche Verbindungsablauf pro-
grammgesteuert, weil ein Mensch kaum schnell genug reagieren könnte.
Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit und recht oft muss man persönlich
eingreifen, nicht nur zur Anbahnung und Nachbereitung eines Kontakts.
Cleveren Programmierern wäre es leicht möglich, dies weitgehend zu auto-
matisieren. Doch ist „Robot-Mode“ absolut nicht im Sinne des Erfinders,
wie K1JT in seinem bemerkenswerten Vortrag auf der Ham Radio betonte.
Etwas anderes beunruhigt mich mehr: Verschiedentlich war Freude darüber
zu vernehmen, dass „heute schon etwa 70%“ aller Amateurfunkverbindungen
in FT8 liefen. Das bezieht sich wohl auf Club Log, wo aktuell von 62% zu lesen
ist − also lediglich unter den dort gemeldeten Verbindungen, sodass dieser
Wert zweifelhaft ist. Aber wieso „heute schon“? Streben wir 100% an?
FT8 ist für die Kommunikation an der „Grasnarbe“ gedacht, schließlich steht
„WSJT“ für „Weak Signal Joe Taylor“. So hat ein befreundeter OM im Juni
bei einer Bandöffnung nach Mittelamerika mit eher unterdurchschnittlicher
Ausrüstung auf 6 m etliche Stationen aus der Karibik erreichen können,
bei denen er mit −21 dB ankam. Genau dazu ist FT8 geschaffen worden.
Ein schöner Erfolg, Dank an K1JT. Doch waren die bejubelten „70 %“ alles
solche Verbindungen unter der Rauschschwelle?
Wenn ich abends ein völlig leeres Band vorfinde und mir beim Drehen über
den FT8-Kanal bald die Kopfhörer wegfliegen, macht mich das traurig.
Das sind offensichtlich überwiegend keine „weak signals“. Und selbst im ver-
schärften Pile-up oder hektischen Contestbetrieb hängt man noch ein kleines
„tu“, „gl“ oder Dit-Dit an bzw. wünscht in Fonie „viel Erfolg“ oder Ähnliches.
Dagegen wird in FT8 die Möglichkeit kaum genutzt, eine persönliche Gruß-
floskel anzuhängen.
Sollen derart unpersönliche Verbindungen, selbst bei für CW, SSB und
Digimodes mit echtem Informationsaustausch ausreichenden Signalstärken,
die Zukunft des Amateurfunks sein? Helfen Sie mit, dass es nicht so kommt −
schon jetzt und nicht erst, wenn die Sonne wieder mehr Flecken zeigt!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Unsere Ham Radio mit jugendlichem Charakter
Jugendlicher Charakter − das steht für die sichtbare Präsenz begeisterter
Jugendlicher auf der diesjährigen Ham Radio sowie für die wohltuend
frische Stimmung bei Begegnungen mit Funkfreunden aus allen Erdteilen.
Ebenso steht dies für neue Technologien, die in Fachvorträgen und Seminaren
kompetent vermittelt wurden. Im Programm fanden sich alle aktuellen Trends,
die den Amateurfunk gegenwärtig bereichern.
Dank übersichtlich gestalteter Programmhefte, wie dem vom FUNKAMATEUR,
behielt man den Überblick. Für die Referenten, die viel Freizeit in die Vorbe-
reitungen investiert hatten, waren die oft überfüllten Vortragsräume das beste
Kompliment. Ein herzlicher Dank geht an alle Referenten und Aussteller, die
Standbesatzungen, das Messeteam, den Ortsverein Friedrichshafen und die
ungezählten Helfer.
Seit 1991 verbrachte ich die drei Messetage fast ausschließlich auf den
Messeständen des HF-Referates und später auf dem des Radio Telegraphy
High Speed Clubs. So geht es vielen Funkamateurinnen und Funkamateuren,
die sich in Friedrichshafen engagieren und den Rahmen für die „Nummer 1
in Europa“ gestalten. In diesem Jahr hatte ich jedoch samstags „frei“ und
begleitete meinen zwölfjährigen Enkel während der Ham Rallye. Dabei
erlebte ich die Messe aufmerksam aus einem Blickwinkel, den ich bisher
aus Zeitgründen verpasst hatte.
Mir gefiel sowohl die große Resonanz seitens der Jugendlichen als auch
die aufgeschlossene und freundliche Art der Standbetreuer, die stets das
Gespräch mit den jungen Interessenten suchten. Diese vom Ham Spirit
geprägte Atmosphäre wirkt nachhaltig. Sie motiviert, auch im kommenden
Jahr wieder dabei zu sein. Dafür von mir ein großes Lob! Die hohe Wertigkeit
der Jugendarbeit zeigte sich bei der ideenreich zusammengestellten
Ham Rallye ebenso wie in der Präsenz von DARC-Referaten, AATiS und
YOTA. Hinzu kamen Vorträge und die Möglichkeit, auf der Ham Radio eine
SWL- oder Amateurfunkprüfung abzulegen.
Beispielgebend waren die Exkursion von Schülern des Liborius-Gymnasiums
Dessau, die begeistert über ihre Funkverbindung mit der ISS berichteten,
sowie am Samstagmorgen ein Ballonstart unter großer Anteilnahme junger
Leute. Schade, dass solche Ereignisse und das themenreiche Messeprogramm
fast nur in amateurfunkinternen Medien publiziert werden. Überdies ist es für
mich unverständlich, dass die primär für junge Leute konzipierte Maker Faire
mangels Sponsoren im finanzstarken „Hightech-Umfeld“ des Bodensees
nicht mehr stattfand.
Ein weiterer Höhepunkt war die verdiente Würdigung von Prof. Dr. Joe Taylor,
K1JT, mit dem Horkheimer-Preis 2019. Seine anschließenden Vorträge fanden
in überfüllten Räumen große Resonanz. Die SDR-Akademie und viele hoch-
klassige Technikvorträge hatten ebenso zahlreiche interessierte Zuhörer.
Neue Technologien, wie die Anwendung digitaler Signalprozessoren im
Amateurfunk, beflügeln in Ortsverbänden und Interessengruppen sowohl
die Softwarespezialisten als auch die Bausatzentwickler. Es wird heute
wieder mehr selbst gebaut als noch vor Jahren und das auf hohem Niveau.
Nehmen wir die auf der Ham Radio erlebte Technikvielfalt als Anregung mit
in unsere Ortsverbände und bereichern unser Klubleben mit neuen Ideen.
Jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten für die Amateurfunkgemeinschaft
etwas tun. Die Freude daran kommt dabei von selbst.
73/55 und awds 2020 in Friedrichshafen
Dr.-Ing. Hartmut Büttig, DL1VDL
Auf in die Natur!
Endlich ist es draußen wärmer und das schöne Wetter lockt zu Fahrten ins
Grüne. Mögen auch noch so viele DXpeditionen warten, die nur mit Endstufe
und Beam zu arbeiten sind, doch ist gerade jetzt an Wochenenden oder im
Urlaub nicht die Zeit, um in der (Funk-)Bude zu hocken. Wer ohnehin nicht
von daheim funken kann, für den ergeben sich nun einzigartige Chancen.
Wie wäre es denn mit Portabelbetrieb? Früher ging dies oft nur mit ein paar
Watt, was freilich auch heute noch beim QRP-Betrieb opportun ist. Anderer-
seits sind 100-W-Transceiver im Autoradioformat inzwischen Stand der
Technik und VHF/UHF-Mobiltransceiver im mittleren Leistungsbereich passen
locker in eine Damenhandtasche. Ein 20-Ah-Lithiumakkumulator wiegt kaum
mehr als 2 kg und ist nur im Vergleich zu einem Satz Monozellen teuer,
gegenüber einem KW-Funkgerät dagegen nicht. Ergänzt um einen GFK-Mast
und eine leichte Antenne ist solch eine Portabelausrüstung, ob für KW oder
UKW, von einer Person problemlos zu transportieren.
Zum einen kann man sich damit an den vielfältigen Aktivierungsprogrammen
beteiligen, ob es um Berge à la SOTA, GMA, Sächsischer Bergwettbewerb
geht, neuerdings sogar um Triangulationspunkte, oder um Burgen und
Schlösser, Inseln, Leuchttürme, Mühlen, Natur- und Landschaftsschutz -
gebiete, oder oder oder…
Zum anderen tut es auch ein Hügel, eine Wiese, ein Feldrand oder gar eine
Parkbank, um fernab des häuslichen Störnebels auf einem oder mehreren
Bändern von Lang-, Mittel- und Kurzwelle über UKW bis in den Gigahertz-
bereich aktiv zu werden. So kann man „ganz normal“ funken oder den
Aktivierern o. g. markanter Örtlichkeiten als Punktelieferant dienen.
Wer daheim keine Möglichkeit zur Montage einer Satellitenantenne mit freiem
Blick nach Südosten hat, versucht vielleicht mit einem Camping-Spiegel,
preiswertem LNB und SDR am Tablet oder Notebook, dem Funkverkehr auf
unserem neuen geostationären Satelliten QO-100 zu lauschen. Möglicherweise
entwickelt sich Lust auf Mehr, um sich für das nächste Mal auch um
eine Sendeeinrichtung zu kümmern.
Nebenbei muss man sich unterwegs ganz anderen technischen Heraus-
forderungen stellen als beim Funkbetrieb im Shack, wo Werkzeuge, Adapter,
Verbindungskabel, Messgeräte, Lötutensilien und vieles andere in Griffnähe
liegen. Wer es noch nicht ausprobiert hat, wird sich wundern, was man beim
Portabelbetrieb alles vergessen kann und wo überall der Fehlerteufel lauert.
Es kann durchaus reizvoll sein, unerwartet improvisieren zu müssen − ein
Hauch von MacGyver…
Zudem ist es ein Erlebnis, wie gering der allgemeine elektromagnetische
Störpegel abseits aller Siedlungen oft ist. Solch eine Funkaktivität, ob allein,
mit Freunden oder bei einem Fieldday, bleibt mit Sicherheit in Erinnerung.
Also einfach mit Transceiver, Mikrofon, ggf. Morsetaste, Akkumulator und
Portabelantenne im Kofferraum oder Rucksack losziehen, um das Glück auf
den Bändern zu versuchen. Mit vergleichsweise geringem Aufwand erfahren,
wie es sich anfühlt, an der frischen Luft Funkbetrieb durchzuführen oder gar
selbst am anderen Ende eines kleinen Pile-ups zu sitzen. Dafür reicht oft
schon ein Nachmittag, sodass der nötige Zeitaufwand überschaubar bleibt
und sich in Familienaktivtäten einbinden lässt.
Fachliche Unterstützung finden sie im aktuellen FUNKAMATEUR und in
zurückliegenden Ausgaben zur Genüge: in Form von Beiträgen, die einzelne
Teilaspekte beleuchten, sowie im QTC-Teil. Nun denn − worauf warten Sie
noch?
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Ham Radio und 70. Bodenseetreffen
Vor einem Jahr schrieb ich an gleicher Stelle, die Ham Radio stehe „unter
keinem guten Stern“. Deren Termin kollidierte unter anderem mit dem bei
vielen Funkamateuren beliebten IARU-R1-Fieldday sowie einem wichtigen
Mikrowellen-Contest. Ist es nun in diesem Jahr besser?
Immerhin liegt der Termin wieder in der angestammten dritten Juni-Dekade
und weder ein großer Contest noch ein Distrikt-Wettbewerb stehen an.
Mehr noch, Interessenten aus Bundesländern, in denen Fronleichnam am
20. 6. ein gesetzlicher Feiertag ist, können die Fahrt nach Friedrichshafen
dank Brückentag in ein verlängertes Wochenende einbetten.
Leider wurde die Maker Faire Bodensee abgesagt, da sich nicht genug
Sponsoren in der Region fanden. Das ist nach fünf hochinteressanten
Veranstaltungen schade wegen der nun wegfallenden wechselseitigen
Synergieeffekte. Zudem tut es mir um die vielen jugendlichen Aussteller leid,
die dort mit beeindruckender Begeisterung ihre Exponate präsentierten.
Nun werden die schätzungsweise rund 3000 Maker-Faire-Besucher in der
Gesamtbilanz der 44. Ham Radio fehlen, da es für beide Veranstaltungen
gemeinsame Eintrittskarten gab. Unter den vielen in Friedrichshafen veran-
stalteten Messen ist die unsrige hinsichtlich der Zahl der Besucher sowie der
zahlenden Aussteller ohnehin nur ein kleines Rädchen im kommerziellen
Messegetriebe. Weiter sinkende Besucherzahlen könnten die Ham Radio für
die Messeleitung noch unattraktiver machen. Eine in den Folgejahren dann zu
befürchtende Verlagerung auf einen unbequemeren Termin hätte womöglich
eine Kettenreaktion zur Folge − je weniger Besucher, desto unlukrativer…
Daher sollten wir jetzt gegensteuern. Zwar lassen sich Funktechnik und
Zubehör heutzutage vielleicht einfacher online ordern. Die Bedeutung des
Flohmarktes ist mit der breiten Nutzung von Internet-Auktionsbörsen oder
Klein anzeigenportalen zweifellos zurückgegangen. Doch das Flair eines
solchen Amateurfunktreffens, die unzähligen persönlichen Begegnungen,
die Diskussionen mit Fachhändlern und Herstellern, die hochkarätigen
Vor träge mit direkten Autorenkontakten, die Meetings der zahlreichen
Interessengruppen, das umfangreiche Jugendprogramm sowie die kleinen
Wettbewerbe am Rande lassen sich weder durch Youtube noch durch
Social Media ersetzen.
Um die in Europa einzigartige und vom Standort her alternativlose Ham Radio
sowie insbesondere das begleitende traditionsreiche Bodenseetreffen weiter
zu erhalten, ist es heuer wichtiger denn je, sich auf den Weg nach Friedrichs-
hafen zu machen. Egal, ob Stippvisite oder komplettes Drei-Tage-Programm,
vielleicht kombiniert mit einem Familienurlaub in der Bodenseeregion:
Ihr Kommen zählt!
Das nunmehr 70. Bodenseetreffen mit seinen über 80 Veranstaltungen steht
unter dem Motto „Amateurfunk on Tour“. Dies zielt passenderweise auf
Reiselust mit Aktionen, Ausstellungen und Vorträgen ab, insbesondere aber
auf portablen Amateurfunkbetrieb vom benachbarten Hügel oder gar von
einer fernen Insel. Wegen versagter Antennengenehmigungen, Elektrosmog-
Hysterie und stetig wachsender Empfangsstörungen ist der Funkbetrieb von
unterwegs, vielleicht sogar energieautark, ein Trend der Zeit.
Die vorgesehene Präsentation verschiedenster mobiler Shacks und der darauf
aufbauende Interessenaustausch sind sicher ein Besuchermagnet. Daneben
wird Satellitenfunk über unseren geostationären Transponder QO-100 auf
Es’hail-2 ein wichtiges Thema sein.
Awds in FN!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Treffen der Techniker
Mitte der 1980er-Jahre bin ich erstmals zum Messegelände nach Hannover
gefahren und von da an war die CeBIT jährlich ein fester Termin in meinem
Kalender. Anfangs gab es dort noch Kurzwellengeräte zu sehen, etwa
am Stand von Rohde & Schwarz oder bei einem örtlichen Aussteller von
Amateurfunktechnik. Bald kamen vermehrt Satellitenfunksysteme hinzu,
später Mobiltelefone und Digitalfunk. Selbst wenn man sich nicht für die
neueste Bürotechnik oder Betriebssysteme interessierte, gab es in Hannover
immer viel interessante neue Technik zu entdecken. Die Messe war ohnehin
viel zu groß, als dass man alles hätte sehen können.
Doch das Interesse bei Ausstellern und Besuchern ließ im Laufe der Jahre
nach. Ein neuer Termin im Sommer und ein deutlich verändertes Konzept
konnten den Abwärtstrend nicht stoppen, schienen diesen sogar zu ver-
stärken. Als der Veranstalter dann im Herbst vergangenen Jahres entschied,
die CeBIT 2019 mangels ausreichender Buchungen abzusagen, hielt sich
bei Kritikern des zuvor eingeschlagenen mutigen Wegs die Überraschung
in Grenzen. Die Zeit der großen Messen wie einer CeBIT, so waren diese
überzeugt, sei nun einmal vorüber.
Dass dem nicht so ist, zeigte sich Anfang April auf der Hannover Messe
Industrie. An den fünf Messetagen kamen mehr Besucher als im Vorjahr und
sämtliche Messehallen waren früh komplett ausgebucht. Aussteller, die sich
für die CeBIT 2019 bereits angemeldet hatten und nach deren Absage zur
Industriemesse wechseln wollten, fanden kaum noch einen adäquaten Platz
für ihre Präsentationen. Erwartungsgemäß war das Fazit der Veranstalter am
Ende der Messewoche ausgeprägt positiv und viele Aussteller äußerten sich
ebenfalls zufrieden.
Diese gute Stimmung zeigte sich bereits während der Woche beim
Rundgang durch die mit Besuchern gefüllten Messehallen. Es reicht eben
nicht, über neue Lösungen und Konzepte nur zu lesen und sich darüber im
Internet zu informieren − seien dortige Multimediapräsentationen auch noch
so ausgefeilt. Vielmehr wollen sich Anbieter und potenzielle Anwender im
direkten Gespräch miteinander austauschen, um die bestmögliche Lösung
für eine Aufgabe zu finden. Dies trifft für einen technisch geprägten Bereich
verstärkt zu.
Doch ging es in Hannover nicht allein um den aktuellen Stand der Technik
und den Blick auf künftige Technologien, wie die erwartete weitere Vernet-
zung von Maschinen mittels 5G-Mobilfunk und den zunehmenden Einsatz
von Künstlicher Intelligenz in der Produktion. Vielmehr diskutierten Industrie-
vertreter und Mahner während Podiumsdiskussionen sowie bei einem
Kongress über mögliche Folgen dieser Entwicklungen für die Gesellschaft,
die einige als neue industrielle Revolution betrachten.
Auch in dieser Hinsicht befindet sich der Messeveranstalter auf dem richtigen
Weg und es bleibt zu hoffen, dass etwa die von einem prominenten Sprecher
formulierte Forderung nach einem zeitgemäßeren Bildungssystem nicht
ungehört verhallt.
In diesem Zusammenhang war es erfreulich, dass, wenn auch vereinzelt,
ganze Schulklassen nach Hannover gekommen waren und sich über die
Zukunft der industriellen Produktion informierten. Angesichts des oft
beklagten Fachkräftemangels ist es wichtig wie nie, Jugendliche für die
in Hannover gezeigte Technik zu begeistern.
Harald Kuhl, DL1AX
OSCAR-100: (k)ein Märchen aus 1001 Nacht!
Mit dem erfolgreichen Start der AMSAT-P4-A-Transponder auf dem kommer-
ziellen Telekommunikationssatelliten Es’hail-2 des katarischen Betreibers
Es’hailSat erfüllte sich am 15. November 2018 für Funkamateure ein Traum.
Dieser erste geostationäre OSCAR, Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio,
ist gleichzeitig der einhundertste Amateurfunksatellit in der über 50-jährigen
Geschichte der AMSAT. Positioniert in 36 000 km Höhe bei 26° Ost,
verbindet Qatar-OSCAR-100 (QO-100) nun Amateurfunkstationen von der
Ostküste Brasiliens über ganz Europa und den afrikanischen Kontinent bis
nach Malaysia, Thailand und den westlichen Teil Chinas.
Alles begann im Dezember 2012 mit einer Einladung durch den katarischen
Amateurfunkverband, QARS, dessen Vorsitzender, HE Abdullah bin Hamad
Al Attiyah, A71AU, der ehemalige stellvertretende Premierminister von
Katar ist. So ergab sich für den Vorstand des AMSAT-Deutschland e. V. die
Gelegenheit, dort über Satellitenprojekte zu referieren.
Dabei war der sprichwörtliche Funke offenbar übergesprungen und es vergingen
nur wenige Monate, bis auf ein erstes Telefonat mit dem Satellitenbetreiber
Es’hailSat eine ganze Reihe weiterer Treffen in Katar und Japan folgten. Im
Namen der QARS übernahm AMSAT-DL die technische Verantwortung und
Koordinierung für die AMSAT-P4-A-Transponder auf dem geplanten Satelliten
Es’hail-2. Wir durften alles spezifizieren und der Hersteller sollte nach unseren
Vorgaben die beiden Transponder realisieren.
Auf einige vorhandene Komponenten konnte man zwar zurückgreifen, jedoch
musste vieles nach unseren Anforderungen neu- oder umkonstruiert werden.
So war den erfahrenen Konstrukteuren von Transpondern für Satelliten-TV
die Problematik eines unkoordinierten Vielfachzugriffs ebenso unbekannt
wie die Notwendigkeit einer automatischen Verstärkungsregelung. Hier konnte
sich die AMSAT mit viel Erfahrung und Wissen aus dem Betrieb der Linear-
trans ponder auf dem P3-Satelliten einbringen.
Nach einer umfangreichen In-Orbit-Testphase war es am 14. Februar 2019
so weit: Während der Einweihungsfeier des Teleports von Es’hailSat in Doha
gaben Vertreter der QARS die beiden Amateurfunktransponder auf dem
Es’hail-2-Satelliten für den Funkbetrieb offiziell frei. Ein weiterer Höhepunkt
war die Ansprache von Abdullah bin Hamad Al Attiyah, A71AU, die live über
den DATV-Transponder des Satelliten in das Kontrollzentrum übertragen und
vom amtierenden Premierminister staunend verfolgt wurde. Die dazu erforder-
lichen Geräte hatten Mitglieder der AMSAT-DL entwickelt und gebaut. Diese
sind nun fest im Es’hailSat-Teleport sowie im Hauptquartier der QARS in der
Klubstation A71A installiert. Eine Backup-Station ist bei der AMSAT-DL an
der Sternwarte Bochum betriebsbereit.
Den Funkamateuren steht nun ein eigener Satellit zur Verfügung, dessen
Ausleuchtzone ständig ein Drittel der Erdoberfläche abdeckt und so die Über-
brückung großer Entfernungen bei vergleichsweise geringem terrestrischem
Aufwand ermöglicht. QO-100 ist täglich 24 Stunden für Amateurfunkbetrieb
erreichbar und dies hoffentlich für bis zu fünfzehn kommende Jahre.
AMSAT-DL, QARS und Es’hailSat haben mit dem ersten geostationären
OSCAR gemeinsam die Geschichte der Amateurfunksatelliten weiter-
geschrieben. Bitte unterstützen Sie unsere ehrenamtliche Arbeit weiterhin
durch eine Mitgliedschaft oder Spende.
Peter Gülzow, DB2OS
Faszination Digital Voice
Unser Hobby Amateurfunk ist außerordentlich facettenreich. So findet auch
die Beschäftigung mit digitaler Sprachübertragung, hier im Weiteren DV
genannt, immer mehr Anhänger. Eine Triebfeder ist die Freude an moderner
Technik und am Ergründen neuer Kommunikationswege, die über die alther-
gebrachter analoger Relaisfunkstellen weit hinausgehen.
In Deutschland etablierte sich dank preisgünstiger ausgemusterter Kommu-
nikationstechnik bereits Anfang der 2000er-Jahre das US-amerikanische
Digitalfunksystem APCO P25. Dann brachte Icom Geräte auf den Markt,
die nach dem vom japanischen Amateurfunkverband entwickelten D-STAR-
Protokoll arbeiten.
Später kam Digital Mobile Radio (DMR), basierend auf ETSI-Normen, hinzu
und vor allem chinesische Hersteller nutzten den neuen Markt, um preis-
günstige Geräte anzubieten. Schließlich begann Yaesu, seine Handfunk-,
Mobil- und Feststationsgeräte mit dem eigens für Amateurfunk konzipierten
digitalen Übertragungssystem C4FM Fusion auszurüsten.
Diese Entwicklung setzt sich fort: Findige Funkamateure befassen sich
bereits mit weiteren DV-Modi wie TETRA oder dPMR, um nur einige zu nennen.
Parallel dazu haben wir weltumspannende Netzwerke etabliert, die unsere
digitalen Relaisfunkstellen internetgestützt verbinden. Unabhängig von
Ausbreitungsbedingungen können wir darüber weltweit kommunizieren.
Daneben gab es schon früh Bestrebungen, auch ohne Funkgerät am DV-Verkehr
teilzunehmen. Angefangen vom 2009 im FA vorgestellten DV Dongle für
D-STAR bis hin zum kürzlich beschriebenen DVstick 30 war dafür jeweils
Zusatzhardware für PC oder Smartphone erforderlich.
Eine neue Phase beginnt derzeit dank des niederländischen Software-
entwicklers David Grootendorst, PA7LIM. Seine „Peanut“ genannte Lösung
ermöglicht es lizenzierten Funkamateuren, mit einem Smartphone, Tablet
oder anderen Android-basierten Geräten ohne DV-Zusatzhardware am
D-STAR-, DMR- oder C4FM-Fusion-Betrieb teilzunehmen. Mehr darüber
lesen Sie im Digital-QTC dieser FA-Ausgabe auf Seite 286.
Doch ist dies überhaupt noch Amateurfunk? Für mich stellt sich diese Frage
nicht. Vielmehr betrachte ich diese Entwicklung als erhebliche Bereicherung
für unsere Kommunikationsmöglichkeiten. Und es zeigt einmal mehr, dass
Funkamateure Pionierleistungen erbringen.
Zwar können wir kompakte Hightech-Funkgeräte für DV oder gar Smart-
phones kaum selbst bauen, und die Glasfaserkabel sowie Knotenrechner
des Internets gehören der Industrie. Doch die unzähligen Internet-Server,
teils mit selbst gebauten Zusatzbaugruppen, die die weltweite Kommunikation
in unseren digitalen Netzen gewährleisten, wurden durch engagierte Tüftler
unter uns errichtet. Programmierende Funkamateure haben überdies in zwei
Jahrzehnten DV-Betrieb unzählige Zeilen Quelltext geschrieben, um diesen
Servern „Leben“ einzuhauchen.
Nicht zuletzt steckt in unseren zunehmend digitalen Relaisfunkstellen,
wenngleich sie meist auf kommerzieller Technik basieren, das Herzblut
begeisterter Funkamateure vor Ort.
Erfreuen wir uns also an den modernen Funkverfahren, entdecken ständig
Neues, und behalten dabei die unschätzbaren Mühen derjenigen Funk-
amateure im Auge, die dies alles am Laufen halten!
Jochen Berns, DL1YBL
Auf die Mischung kommt es an
An manchen Tagen erscheinen die Amateurfunkbänder auf Kurzwelle, vor
allem im oberen HF-Bereich, wie abgeschaltet. Beim Absuchen der Bänder
ist weit und breit kein Signal zu entdecken und scheinbar sind es die Aus-
breitungsbedingungen, die keine Verbindung zulassen. Letzteres ist derzeit
tatsächlich häufig die Ursache, oft aber auch nicht. Vielmehr kann ein leeres
Band daran liegen, dass trotz Öffnung einfach niemand funkt und sich alle
allein aufs Hören konzentrieren oder sich auf das DX-Cluster verlassen.
Umso größer ist dann die Überraschung, wenn man selbst einen allgemeinen
Anruf startet und die Antwort aus unerwarteter Richtung kommt. Ein wohl
extremes Beispiel durfte ich vor einigen Jahren erleben, als ich spätabends
im wenig belebten 20-m-Band in SSB rief und nach kurzer Zeit eine Station
auf Deutsch zurückkam. Der OM hatte offenbar eine leistungsfähigere
Antenne als ich mit meinem Vertikalstrahler auf dem Balkon, sodass ich sein
Rufzeichen erst beim zweiten Durchgang korrekt aufnehmen konnte. Dies war
die für mich bis dahin spektakulärste Amateurfunkverbindung: Die Antwort
auf meinen CQ-Anruf kam von den Galapagosinseln im Pazifik, einem für
viele europäische DXer raren DXCC-Gebiet.
Zugegeben, ein derartiger Glücksfang kommt nicht oft vor. Doch ohne
meinen CQ-Ruf, von dem ich mir angesichts meiner schwierigen Antennenlage
wenig versprochen hatte, wäre dieser Funkkontakt nicht zustande gekommen.
Der Funkfreund lebte ständig auf Galapagos und hatte kein Interesse an
Pile-ups. Hätte er doch selbst CQ gerufen, wäre mein Signal aufgrund des im
Handumdrehen hohen Andrangs sehr wahrscheinlich nicht mehr bis zu ihm
durchgedrungen. Doch muss es nicht gleich die Aussicht auf eine Verbindung
mit einer Station im fernen Pazifik sein, um selbst auf den Bändern zu rufen
und interessante Gesprächspartner zu finden. Einen Versuch, besser
mehrere, ist es allemal wert.
Dennoch ist der Hörbetrieb ebenso wichtig. Viele an DX-Verbindungen
interessierte Funkamateure, und ich schließe mich selbst nicht aus, nutzen
heute gerne Meldungen im DX-Cluster oder im Reverse Beacon Network,
RBN. Beide sind unbestritten hilfreiche Werkzeuge, um sich einen Überblick
der aktuellen Funkaktivitäten zu verschaffen und die für einen selbst interes-
santen DX-Stationen zu finden.
Doch verpasst man seltene Gelegenheiten, sofern man sich alleine darauf
verlässt. So tauchte kürzlich das Rufzeichen einer außergewöhnlichen Station
in der Antarktis in den Meldungen bei RBN überhaupt nicht auf, obwohl
deren Signal im 30-m-Band hier einigermaßen gut lesbar war. Aufgrund wohl
selektiver Ausbreitungswege an jenem späten Abend erreichte es offenbar
die Antennen der europäischen RBN-Stationen nicht.
In Berichten von Teilnehmern an DXpeditionen liest man zudem immer
wieder, dass die erhofften Pile-ups erst an Dynamik gewannen, nachdem
die Frequenz der betreffenden Station im DX-Cluster gemeldet wurde.
Im Umkehrschluss könnte man vermuten, dass viele DXer die einschlägigen
bzw. oft vorab veröffentlichten Frequenzen der DXpeditionäre selbst nicht
mehr beobachten und ohne DX-Cluster die Aktivität gar verpassen würden.
Letztlich kommt es bei der erfolgreichen Suche nach interessanten Stationen
noch immer auf die Mischung zwischen selber rufen und mit gespitzten Ohren
hören an. Dies gilt umso mehr, wenn man keine Richtantenne aufbauen kann
und das begehrte Rufzeichen im Log haben will, bevor ein Pile-up beginnt.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Vom Messen, Wissen und Lernen
Die Beschäftigung mit einem technischen Hobby wie dem Amateurfunk ist für
viele Menschen auch deshalb so faszinierend, weil dies eine geistige Heraus-
forderung bedeutet. Neues Wissen und vielerlei Erkenntnisse erwachsen nicht
nur aus der weltweiten drahtlosen Kommunikation, sondern ebenso aus dem
eigentlichen Privileg der Funkamateure: dem Selbstbau und eventuell sogar
der Reparatur der eingesetzten Transceiver, Antennen und Zusatzbaugruppen.
Dabei führt wiederum besonders der Umgang mit elektronischer Messtechnik
dazu, dass man praktisch ständig dazulernt, sei es über das Messobjekt,
das Messgerät selbst oder mögliche Messfehler. Dies gilt speziell für den
HF-Bereich.
Noch interessanter wird es für den Funkamateur und Hobbyelektroniker, wenn
er sich seine Messtechnik selbst baut. Dabei bieten nicht nur Aufbau und
Abgleich zusätzliches Lernpotenzial, auch das Verstehen der Funktionsweise
fällt leichter. Nicht zu unterschätzen ist zudem das damit verbundene Erfolgs-
erlebnis, einer für viele Selbstbauer starken Triebkraft.
Dies war für den FA-Leserservice der Beweggrund, von Funkamateuren
entwickelte Messgerätebausätze zu produzieren und preisgünstig anzubieten.
Sie berücksichtigen das, was für den Hobbyanwender wirklich wichtig ist.
Wer etwa zum ersten Mal den von Michael Knitter, DG5MK, entwickelten
Antennenanalysator FA-VA5 an seine selbstgebaute Antenne anschließt, wird
wahrscheinlich überrascht sein und neue Erkenntnisse gewinnen. Diese könnten
den tatsächlichen Wert der Resonanzfrequenz betreffen oder den Einfluss
der Speiseleitung auf die Anschlussimpedanz. Am Ende wird man sich sagen:
Wieder etwas dazugelernt…
Vor diesem Hintergrund ist auch unsere Entscheidung zu sehen, den
FA-Netzwerktester neu aufzulegen. Der bastelnde Funkamateur erhält damit
ein ebenso universelles wie preiswertes Messgerät, das im Hobbylabor gute
Dienste leistet und ihn hinsichtlich der Bedienung nicht überfordert. Die
Software von Andreas Lindenau, DL4JAL, ist fast intuitiv zu handhaben und
vermittelt quasi nebenbei einige Grundbegriffe, die auch bei der Arbeit mit
professionellen Messplätzen nützlich sind.
Der von NF bis VHF reichende Frequenzbereich des FA-NWT2 dürfte für
Messaufgaben an den meisten Eigenbauprojekten ausreichen. Das bewährte
Konzept des Vorgängers hinsichtlich der skalaren Darstellung der Ergebnisse
von Durchgangs- und Reflexionsmessungen wurde bewusst beibehalten.
Diese sind relativ einfach zu interpretieren und liefern zumeist genügend
Informationen, um das Messobjekt zu beurteilen. Amateurfunk-Einsteiger
oder Schüler in Elektronik-Arbeitsgemeinschaften haben es dadurch leichter,
sich in diese Technik einzuarbeiten.
Das in Kürze erscheinende Buch von Rainer Müller, DM2CMB, und Andreas
Lindenau, DL4JAL, zum FA-NWT2 folgt ebenfalls diesem Ansatz. Es bietet
für viele in der Amateurpraxis anfallende Messaufgaben eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung. Das parallel dazu vermittelte Grundlagenwissen ermöglicht
es dem Leser, den Messaufbau zu verstehen und das Ergebnis sachkundig zu
beurteilen. Nicht zuletzt ziehen zudem jene einen Nutzen aus der Lektüre, die
intensiv mit dem Gerät arbeiten und sein Potenzial ausschöpfen möchten.
Allen bastelnden Funkamateuren und Hobbyelektronikern wünsche ich Erfolg
bei aktuellen und geplanten Projekten sowie im genannten Sinn viele neue
und interessante Erkenntnisse. Denn schließlich lernt man nie aus.
Peter Schmücking, DL7JSP
FA-Leserservice
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Kontinuität und Wandel
Mit der vorliegenden Ausgabe 12 hoffe ich als Chefredakteur, dass unsere
vielen fleißigen Autoren daheim sowie meine Kollegen und ich hier in der
Redaktion Ihnen in diesem Jahr wieder eine geglückte Auswahl an Beiträgen
präsentiert haben.
Die wachsende Vielfalt an Themen verlangt von uns einen schwierigen
Spagat. So wollen wir Neueinsteigern Verständliches bieten und alte Hasen
nicht langweilen. Ferner muss leichte Kost hin und wieder mit Anspruchs-
vollem garniert werden. Traditionelle Technik wollen wir nicht vernachlässigen,
aber zugleich dem Trend zum Digitalen Rechnung tragen.
In Fortsetzung der jahrzehntelangen Tradition einer am Kiosk erhältlichen Zeit-
schrift bedient der FUNKAMATEUR von jeher ein sehr breites Themenspektrum.
Wer sich über einzelne Beiträge ärgert, die nicht in sein eigenes unmittelbares
Interessenfeld passen, möge dies bitte in seine Überlegungen einbeziehen.
So wird nicht jeder alles lesenswert finden, doch sollten übers Jahr hinweg die
meisten zu ihrem Recht gekommen sein. Ein Gesamtbild ergibt sich noch
besser beim Blick in mehrere Jahrgänge, denn der FA ist von jeher ein „Sammel-
objekt“. Um Ihnen diesen über viele Jahre zusammengetragenen Wissensschatz
bequem zugänglich zu machen, unterstützen wir Sie in vielfältiger Weise.
So sei zunächst die Jahrgangs-CDs genannt, die mit der Januarausgabe 2019
in 24. Auflage erscheint. Ich kann Sie nur erneut ermuntern, die Jahrgangs-
PDFs von Ihren vorhandenen CDs auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone zu
speichern. Eine Volltextsuche über mehrere Jahre hinweg nach Stichworten,
also nach jedem beliebigen einmal gedruckten Wort, ist dann nämlich sehr
einfach möglich.
Zusätzlich bieten wir Jahrgangs-PDFs von 1999 bis 1970 zurück auf DVD an,
und zwar jeweils in Fünfer- bzw. Zehnergruppen. Obendrein sind über 600
Testberichte aus dem FUNKAMATEUR und der „funk“ für ein geringes Entgelt
im PDF-Download-Shop zu haben. Dabei geht es nicht nur um Funkgeräte,
sondern ebenso um Antennen, Zubehör und Software.
Der frei zugängliche Download-Bereich auf www.funkamateur.de, in dem zu
jeder FA-Ausgabe zahlreiche Ergänzungen abrufbereit sind, ist sicher den
meisten Lesern bekannt. Erweitert wurde dieser um die FA-Typenblätter von
1994 bis 2018 sowie um nahezu sämtliche FA-Bauelementeinformationen −
wo sinnvoll sogar bis 1973 zurück.
Selbstverständlich halten wir für das neue Jahr wieder viele interessante
Themen für Sie bereit. So wollen wir dem in den kommenden Monaten −
wie wir alle hoffen − erfolgreich in Betrieb gehenden ersten geostationären
Amateurfunksatelliten AMSAT P4-A gebührend Raum widmen. Zu den
digitalen Sendearten haben wir mehr leicht verständliche Kost vorgesehen.
Dies jedoch wie bisher, ohne die konventionelle Elektronik und HF-Technik
zu vernachlässigen.
Ferner steht eine neue Auflage des Buches zum FA-Netzwerktester in
Aussicht, die nun speziell auf den aktuellen FA-NWT2 zugeschnitten ist.
In diesem Sinne dürfen Sie sich auf einen spannenden neuen Jahrgang des
FUNKAMATEURs in gedruckter Form sowie mit Online-Ergänzungen freuen.
Dies wird uns jedoch nur durch die Mithilfe derjenigen unter Ihnen, die hin
und wieder selbst „zur Feder“ greifen, möglich sein − angefangen von der
zweizeiligen Kritik per E-Mail bis hin zu mehrseitigen Fachbeiträgen.
An dieser Stelle daher ein herzliches Dankeschön an alle Macher und Mit-
macher sowie nicht zuletzt an unsere emsigen ständigen freien Mitarbeiter −
und ebenso natürlich an Sie, liebe Leser!
Werner Hegewald, DL2RD
Regelungen ernst nehmen
Blicken wir zwei oder drei Dekaden zurück, dann waren hierzulande die
gesetzlichen Regelungen für den Amateurfunkdienst vergleichbar mit den
heute gültigen Gesetzen und Verordnungen. Die zugewiesenen Bänder, die
Vorgaben hinsichtlich Sendearten und Sendeleistung, das alles sah schon
damals so ähnlich aus wie gegenwärtig.
Knapp über 20 Jahre ist es her, als 1997 im Zuge einer Privatisierungswelle
das damalige Ministerium für Post und Telekommunikation aufgelöst wurde.
Für unsere Belange war nun die Regulierungsbehörde für Telekommunikation
und Post zuständig, heute ist es die Bundesnetzagentur für Elektrizität,
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA). Was zuvor ein
eigenständiges Referat im Bundespostministerium mit weit ausladenden
hierarchischen Strukturen war, ist heute eine schlanke Fachabteilung bei
der Bundesnetzagentur.
Welche Folgen hatte diese Umstrukturierung für uns Funkamateure? Es
kamen eine ganze Reihe von Veränderungen, die wir teils zähneknirschend,
teils wohlwollend zur Kenntnis nahmen. Auf jeden Fall verlängerte sich die
Leine, an der uns die staatliche Aufsicht heute führt, deutlich und ist zudem
weniger straff gespannt.
So war noch vor 25 Jahren die Verbindung einer Amateurfunkstation mit
Telekommunikationseinrichtungen der damaligen Deutschen Bundespost
undenkbar. Phone-Patch − das gab es nur in anderen Ländern. Zudem löste
Ende der 1980er-Jahre schon das Wort „Funkstörungsmessdienst“ bei
Funkamateuren noch ein eher ungutes Gefühl aus, verbunden mit einem
distanzierten „Respekt vor der Behörde“. Die Prüfungsanforderungen zur
Erlangung einer Amateurfunkgenehmigung waren hoch, der Begriff
„Multiple Choice“ war hierzulande noch unbekannt.
Vieles hat sich geändert und wird heute von der BNetzA geduldet, darunter
die erwähnte Verbindung der heimischen Amateurfunkstelle mit dem Internet.
Im Gegenzug erwartete die Behörde an vielen Stellen von uns Funkamateuren
mehr Eigenverantwortung, was nicht immer so ganz funktioniert. So sind wir
aufgefordert, eine von vielen als eher unnütz eingestufte „Selbsterklärung“
gemäß BEMFV anzufertigen und diese bei der Regulierungsbehörde einzu-
reichen. Dank leistungsfähiger Software wäre dies doch für uns Techniker
eigentlich ein Klacks und problemlos zu erfüllen.
Und trotzdem hört man Tag für Tag, etwa auf 80 m, Stationen mit brachialen
Signalen, die sich damit brüsten, mit weniger als 10 W EIRP zu funken und
deshalb die „Selbstverstümmelungserklärung“ für „die da oben“ nicht erstellt
zu haben. Eine solche Herangehensweise dient unserer Sache nicht, sie
schadet allen Funkamateuren.
Ich habe auf der diesjährigen Ham Radio den Vortrag der Bandwacht von
Wolfgang Hadel, DK2OM, verfolgt und war von der engen und professionellen
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen bei der Bundesnetzagentur
beeindruckt. Ein anderes Beispiel ist die jahrelange erfolgreiche Arbeit von
Uli Müller, DK4VW. Sie hat uns nicht nur von einigen Restriktionen bei der
Nutzung des 6-m-Bands befreit, zudem wurde uns dank einer erneuten
Duldungsregelung auch in diesem Jahr die Teilnahme am Amateurfunk im
70-MHz-Bereich ermöglicht.
Derlei Dinge sind keine Selbstverständlichkeit. Dies gilt ebenso für das
Privileg, mit selbstgebauten oder modifizierten kommerziellen Geräten am
weltweiten Amateurfunkverkehr teilnehmen zu dürfen. Im Gegenzug sollten
wir die Regulierungsbehörde und ihre Vorgaben ernst nehmen; ebenso wie
wir erwarten, von der Regulierungsbehörde ernst genommen zu werden.
Peter John, DL7YS
Das süße Leben
Die diesjährige IFA feierte sich in aller Bescheidenheit selbst als „weltweit
führende Messe für Consumer Electronics und Home Appliances“ und als
„Global Innovations Show“. Sie war der Ort, an dem die internationalen
Unternehmen der Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgeräteindustrie
darum wetteiferten, dem Endverbraucher das Leben nicht nur so angenehm
wie möglich zu machen, sondern es ihm schlichtweg zu erleichtern. Dabei
stand natürlich nicht schnödes Gewinndenken im Vordergrund, sondern der
selbstlose Wunsch, dem Verbraucher komplizierteste Aufgaben abzunehmen.
Per Internet der Dinge sollen Küchengeräte miteinander kommunizieren,
der Mensch braucht nicht mehr einzugreifen, nicht einmal dann, wenn die
Kartoffeln überzukochen drohen: Das System weiß schon Bescheid und
regelt die Sache, ggf. wird die Hausdame noch per App informiert. Unter-
dessen plaudern Waschmaschine und Bügeleisen miteinander und ziehen
über ihren Hausmann her, der einfach zu doof ist.
„Google oder Nichtsein, das ist hier die Frage!“, möchte der IFA-Besucher
beim Rundgang ausrufen. Das Betriebssystem Android findet sich in
TV-Geräten aller namhaften Hersteller, um dem Zuschauer deren Bedienung
zu erleichtern, die Sprachsteuerung Google Assistant hat eine Verbreitung
gefunden, die in Verbindung mit der Datensammelwut dieses Konzerns schon
beängstigend ist. Da ist es beruhigend, dass Alexa von Amazon die persönlichen
Daten mal in eine andere Richtung lenkt und die Deutsche Telekom
erst am Anfang dieser Entwicklung steht. In jedem Falle braucht der Nutzer
dieser Technik nicht mehr selbst vielleicht eine Telefonnummer einzutippen,
die Lautstärke seines Radios durch komplizierte Handgriffe zu regeln oder
gar vom ZDF nach RTL umzuschalten, was ihn womöglich überfordern
könnte – das alles geht bequem und einfach per Zuruf, nur darf man nicht
zu doll nuscheln oder Dialekt sprechen.
Unser Innenleben offenbart sich von selbst, wir müssen es nur zulassen.
Wie in der Zukunftsschau Next („Innovation Engine“) der IFA gezeigt wurde,
kann die Technik unsere Stimmung ermitteln und die dazu passende Musik
herunterladen und abspielen. Und in der empathischen Technik sehen die
Dolby Laboratories eine Möglichkeit, ins Innere des Menschen zu blicken:
Mit Sensoren, die Atem, Körperwärme, Gestik und Mimik überwachen,
können Gefühle erfasst und technisch ausgewertet werden. Das lässt
Großes ahnen.
Was tun mit der frisch gewonnenen Zeit? Ganz einfach, wir können länger im
Sessel vor dem Fernsehgerät sitzen, dieses mit 2 m Diagonale, 4K Auflösung
und schönsten bunten HDR-Farben, und uns noch länger an den anspruchs-
vollen Unterhaltungsprogrammen der öffentlich-rechtlichen und privaten
Sendeanstalten erfreuen, fernab querulanten Denkens.
Es soll ja nichts schlechtgeredet werden: Die IFA war, ungeachtet vieler
überflüssiger und teilweise absurder Entwicklungen, der Ort, an dem viele
Neuheiten gezeigt wurden, die wirklich hilfreich und nützlich sind. Davon
hatte das Publikum auch etwas: Große neue TV-Geräte für den Weihnachts-
wunschzettel, inspirierende Kochshows mit Verkostung und vielleicht die
eine oder andere Idee, wie Internet, Smartphone und komplexe Vernetzung
wirklich so genutzt werden können, dass ein echter Mehrwert entsteht.
Und so sollte es sein.
Wolfgang E. Schlegel
Verbindendes stärken
Gemeinsame Interessen verbinden. Dem würde wohl insbesondere beim
Amateurfunk, wo es im Wesentlichen um die Kommunikation zwischen Men-
schen geht, niemand widersprechen. Ich meine dies aber hier ausdrücklich
zunächst im ursprünglichen Wortsinn.
Immer wieder habe ich auf Reisen erlebt, dass Funkamateure auf Anhieb
eine gemeinsame Basis finden. Etwa mit José, der mir während einer
fordernden Rucksacktour durchs entlegene mexikanische Hochland von
Oaxaca bei einem Zwischenstopp das örtliche 40-m-Notfunknetz vorstellte
und mich mit seiner Gastfreundschaft überwältigte. Oder mit Randy auf der
Karibikinsel Carriacou, der gerne durch die technischen Anlagen seiner
MW-Station führte und ausführlich Auskunft gab. Ebenso mit Hu in Shanghai,
wo der Gastbetrieb bei einer Klubstation unkompliziert möglich war und ich
erstmals die andere Seite eines Pile-ups kennenlernen durfte.
Eine solche positive und weltoffene Grundhaltung unter aktiven Funkama-
teuren war Mitte Juli auch in Wittenberg bei der Weltmeisterschaft der Funk-
sportler, der World Radiosport Team Championship (WRTC), allgegenwärtig.
Ein guter Teil der aus aller Welt angereisten Teilnehmer kannte sich seit
Jahren persönlich und freute sich sichtlich über das Wiedersehen, andere
waren erstmals dabei und wurden ebenso herzlich aufgenommen. Dies über
alle Länder-, Sprach- und Altersgrenzen hinweg. Der Vergleich mit einem
Familientreffen lag nicht fern und die Stimmung etwa während des von
Applaus begleiteten Einmarsches der Länderteams auf der Eröffnungsver-
anstaltung war auch für außenstehende Beobachter überwältigend.
Zudem wurde bei Gesprächen mit WRTC-Teilnehmern schnell deutlich, dass
hinter dem von Kritikern mitunter argwöhnisch beobachteten Contest-Funk-
betrieb an Wochenenden weitaus mehr steckt als eine Materialschlacht und
der Austausch von Rapporten im Eilverfahren aus dem stillen DX-Kämmerlein.
Vielmehr suchen viele Contester einander, um gemeinsam ihre Spielart
unseres vielseitigen Hobbys zu genießen. Dabei geht es um die Optimierung
der Stations- und Betriebstechnik sowie um die bestmögliche Analyse und
Nutzung der von der Natur vorgegebenen Ausbreitungsbedingungen.
Die Belegung unserer Amateurfunkbänder und damit deren Verteidigung
gegenüber Begehrlichkeiten fremder Nutzer ist ein ebenso willkommener
wie zunehmend bedeutender Nebeneffekt.
Die WRTC zeigte aber noch mehr: Fast 350 freiwillige Helfer hatten sich eine
Woche freigenommen, um gemeinsam den Gästen aus aller Welt optimale
Startbedingungen zu sichern. Ein Teil davon hat sich sogar über vier Jahre
hinweg engagiert; bei den Testtagen 2016 und 2017 waren es etwa 50 bzw.
100. Den Organisatoren war es gelungen, ihre eigene Begeisterung für das
gemeinsame Projekt auf andere Hobbykollegen zu übertragen und sie zum
Mitmachen zu motivieren. So gelang es, auch viele mitzureißen, die sich
bislang für Conteste kaum interessiert hatten. Für die gemeinsame Sache
kamen sie sogar aus allen Teilen Deutschlands und darüber hinaus; neue
Freundschaften entstanden und werden wohl Jahre überdauern.
Was ebenfalls von der WRTC 2018 bleibt, sind Erinnerungen an ein gelun-
genes internationales Fest des Amateurfunks und die Vorfreude auf die
WRTC 2022 in Italien. Darüber hinaus kann dies Ansporn und Anregung sein,
gemeinsam mit anderen selbst einmal an einem Contest teilzunehmen.
Etwa in der lokalen Klubstation oder auf einer nahen Wiese beim Fieldday.
Dabei muss es nicht primär um vordere Plätze gehen, sondern vielmehr
ums Dabeisein und um das Erlebnis der Gemeinschaft.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Stromversorgung für Portabelfunk
Sommer, Sonne, Portabelfunk − derzeit laden zahlreiche Funkwettbewerbe
im In- und Ausland sowie Fielddays dazu ein, die Funkausrüstung einzupacken
und im Freien ausgiebig Betrieb auf Kurzwelle oder UKW durchzuführen. Dies
belebt die sonst zeitweise eher ruhigen Bänder.
Für Funkamateure mit zu Hause eingeschränkten Antennenmöglichkeiten
bietet Portabelbetrieb zudem die Gelegenheit, von einem für Fernverbindun-
gen günstigen Standort aus zu funken. Hier gehöre ich selbst zu den Be-
troffenen und hatte in den vergangenen Jahren viel Spaß daran, von erhöhten
Standorten im Schwarzwald oder in der Schwäbischen Alb aus auf 2 m und
70 cm auch mit Stationen in England, Dänemark und Schweden zu funken.
Dabei hat sich speziell für DX-Verbindungen auf UKW der Dienstagabend als
ergiebiger Termin etabliert, weil dann in einigen Ländern auf wechselnden
UKW-Bändern kurze Funkwettbewerbe laufen.
Sind die Ausbreitungsbedingungen an einem solchen Abend dann doch einmal
richtig schlecht, ergeben sich oft ausführliche Gespräche mit Funkfreunden
an benachbarten Standorten, die ursprünglich ebenfalls auf DX-Verbindungen
hofften. Man unterhält sich bei solchen Gelegenheiten über besondere Funk-
verbindungen während früherer Wettbewerbe und tauscht Erfahrungen mit
Geräten, Antennen oder Sprachfiltern aus. Auch das ist Amateurfunk und be-
reichert unser Hobby.
Ein Problem haben viele für Funkaktivitäten günstig gelegene Standorte aller-
dings gemeinsam: Meist fehlt dort Strom aus dem Netz. Wer von dort funken
will, muss sich also selbst um eine ausreichende und zuverlässige Strom-
versorgung kümmern. Dafür bietet sich die Verwendung von Akkumulatoren
an, von denen es jedoch eine auf den ersten Blick unübersichtliche Vielfalt
unterschiedlicher Typen gibt.
Neue und oft immer anspruchsvollere Anforderungen in diesem Bereich
haben ständige Verbesserungen gebracht. So sollen die Energiespeicher für
Mobiltelefone und tragbare Computer nicht nur immer kleiner und leichter
werden, sondern gleichzeitig noch längere Laufzeiten bieten. In Elektroautos
müssen Akkumulatoren selbst bei tiefen Minustemperaturen noch funktionie-
ren und sich möglichst schnell wieder aufladen lassen; dies alles selbstredend
möglichst preiswert und umweltfreundlich.
Glücklicherweise haben Wissenschaft und Industrie in diesem Technikbereich
regelmäßig beeindruckende Fortschritte erzielt. So ließ sich die Kapazität von
Akkumulatoren im Format AA seit den 1980er-Jahren verfünffachen. Strom-
stärken und Kapazitäten, die früher den buchstäblich bleischweren Bleiakku-
mulatoren vorbehalten waren, liefern heute moderne, wesentlich leichtere
Stromspeicher auf Basis von Lithiumeisenphosphat. Dies ist eine großartige
Verbesserung, wenn man als Portabel funker seine Ausrüstung zum Einsatzort
tragen muss.
Zu diesem Thema erreichen die Redaktion immer wieder Leseranfragen.
Welcher Akkumulator ist für Portabelbetrieb oder das neue Selbstbauprojekt
der richtige? Wie puffert man den Solarstrom der geplanten Relaisstation am
besten? Besteht beim Laden von Lithiumionenakkumulatoren tatsächlich
immer Brandgefahr?
Antworten auf solche und ähnliche Fragen finden Sie ab dieser Ausgabe des
FUNKAMATEURs ab S. 724 in einer Beitragsreihe mit dem Titel „Auswahl,
Pflege und Einsatz von Akkumulatoren“. Dabei konzentrieren wir uns inhaltlich
auf den praktischen Einsatz.
Dr. Wolfgang Gellerich, DJ3TZ
WRTC 2018: Weltmeisterschaft für alle
Conteste beim Amateurfunk haben nur wenig mit Wettbewerben in anderen
Sportarten gemeinsam. Man funkt miteinander und für eine Teilnahme an einem
nationalen oder internationalen Vergleich ist weder eine Leistungskategorie
nachzuweisen, noch sind vorab aufwendige Qualifikationen zu durchlaufen.
Conteste sind für jeden da. Alle können mitfunken wie sie es möchten: sich
der Herausforderung stellen oder „nur“ Punkte verteilen. Im Kommentar zum
Log einer Februar-QSO-Party berichtete einmal ein Teilnehmer stolz, er habe
sogar mit einem Weltmeister gefunkt; gemeint war Lothar, DL3TD, silent key
2011. In welcher anderen Sportart ist das möglich?
So kann also Mitte Juli jeder Funkamateur an der IARU HF Championship
in Telegrafie und/oder Telefonie teilnehmen. Mit jedem QSO werden Punkte
vergeben – vielleicht sogar an spätere Sieger.
Besondere Bedingungen gelten nur für die Teilnehmer an der gleichzeitig
laufenden Weltmeisterschaft der Contester, WRTC: Diese World Radiosport
Team Championship findet im vierjährigen Abstand seit 1990 statt; jetzt in
Deutschland. 63 Zweierteams aus allen Kontinenten, sämtlich in der Contest-
Szene gut bekannte YLs und OMs, funken unter gleichen Bedingungen von
Feldern und Wiesen rund um Jessen und Wittenberg um Sieg und Plätze.
Sie haben sich während der zurückliegenden drei Jahre bei internationalen
Contesten für die Teilnahme qualifiziert. Nur für diese Teams ist eine solche
Qualifikation Bedingung.
Von den Organisatoren war eine gewaltige Arbeit zu leisten, um diese funk-
sportliche Veranstaltung personell, materiell, finanziell und organisatorisch zu
sichern. Rund 300 freiwillige Helfer sorgen am WRTC-Wochenende für einge-
richtete Zelte, Antennen und Generatoren sowie dafür, dass die Versorgung
der Teams und Schiedsrichter gesichert ist.
Am 14. Juli beginnt um 1200 UTC für 24 Stunden das große Rennen. Jeder,
wirklich jeder Funkamateur ist eingeladen, bei diesem einmaligen Ereignis
auf den Bändern dabei und so Teilnehmer dieser Weltmeisterschaft zu sein.
Es kommt auf möglichst viele Anrufe an. Contester brauchen das Pile-up und
fühlen sich erst wohl, wenn sie bis zur Leistungsgrenze gefordert sind. Dieses
Gefühl sollte ihnen vermittelt werden, auch wenn ihre Signale nicht besonders
stark sind. Denn den Teams stehen nur 100 Watt Sendeleistung zur Verfügung.
Die Organisatoren haben ein Programm vorbereitet, das es allen ermöglicht,
zusätzlich zum Erreichen individueller Ziele besondere Auszeichnungen zu
erhalten. Darüber wird in dieser Ausgabe des FUNKAMATEURs berichtet.
Außer dem Funken in CW und/oder SSB ist es wichtig, sein Log unmittelbar
nach dem Contest unter www.wrtc2018.de hochzuladen. Denn zur Auswer-
tung für die WRTC sollen so viele QSOs wie möglich verifizierbar sein.
Die WRTC ist für uns Funkamateure das größte Ereignis des Jahres. Die
Helfer erleben unmittelbar die Top-Teams und ihre Schiedsrichter. Die Contest-
Teilnehmer füllen die Bänder mit „Leben“ und die Logs mit QSOs. Alle sind
mitten drin in dieser Weltmeisterschaft und unvergessliche Eindrücke
bestimmt zu erwarten.
Auch ich bin als Helfer dabei und freue mich auf persönliche Begegnungen
mit den WRTC-Teilnehmern. Viele von ihnen sind mir während meiner
60 Amateurfunkjahre in Contesten schon vor die Taste gekommen.
Den WRTC-Teams sowie allen Teilnehmern viel Erfolg!
Hardy Zenker, DL3KWF
Im eigenen Interesse
Die Ham Radio 2018 steht unter keinem guten Stern, denn Europas größtes
Amateurfunktreffen findet zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt statt.
Zwar wird sich wohl nie ein Termin wählen lassen, der für alle optimal passt.
Doch fällt die Veranstaltung dieses Mal mit dem IARU-Region-1-Fieldday
zusammen, nicht nur in Deutschland für viele Ortsverbände und Klubs das
Großereignis des Amateurfunkjahrs schlechthin. Damit nicht genug, läuft
noch zeitgleich der DARC-Mikrowellen-Contest.
Von der Friedrichshafener Messegesellschaft angebotene Ausweichtermine
waren auch nicht besser: So wäre es zur Kollision mit der WRTC, der dieses
Mal in Deutschland ausgetragenen Weltmeisterschaft der Funkamateure, ge-
kommen, deren erfolgreiche Durchführung mit den vielen unabdingbaren
freiwilligen Helfern steht und fällt.
Da die Messe Friedrichshafen den gewohnten Termin an eine für sie profi-
tablere Veranstaltung vergeben hatte, stand der DARC e.V. als ideeller Träger
der Ham Radio nun vor der Wahl zwischen „Pest und Cholera“. Dies hätte
allerdings offener und ausführlicher kommuniziert werden können.
Auf der anderen Seite müssen wir uns vor Augen halten, dass die Ham Radio
unter den vielen in Friedrichshafen veranstalteten Messen sowohl hinsichtlich
der Besucherzahl als auch insbesondere von der Anzahl der zahlenden Aus-
steller her ein kleines Rädchen im kommerziellen Messegetriebe ist. So ärger-
lich es für uns war, ist es aus diesem Blickwinkel doch nachvollziehbar, dass
die Messegesellschaft im vorigen Jahr einer anderen Veranstaltung den
Vorzug gab und uns vom angestammten Termin verdrängte. Dass diese
Rechnung nicht aufging und die ebenso prestigeträchtige wie wirtschaftlich
hochinteressante Outdoor-Messe jetzt nach München abwandert, hat sich
inzwischen herumgesprochen.
Für dieses Jahr ließ sich am Ham-Radio-Termin dennoch nichts mehr ändern,
doch immerhin kehrt Europas wichtigste Amateurfunk-Ausstellung 2019 in
die letzte Junidekade zurück. Zwar ist dies immer noch nicht der gewohnte
Termin, wie verschiedentlich zu lesen war; denn der lag immer am letzten
zusammenhängenden Wochenende im Juni. Doch ist es wohl als Zeichen
des guten Willens seitens der Messeleitung zu sehen.
Schon deshalb wäre es sowohl für Besucher als auch für Aussteller keine gu-
te Idee, am ersten Juni-Wochenende 2018 nicht zur Ham Radio zu fahren.
Weniger Besucher könnten unseren Stellenwert innerhalb des Messegefüges
weiter nach hinten rücken. Gleichzeitig würden unsere Chancen auf die Bei-
behaltung des Termins Ende Juni weiter schwinden und ein Teufelskreis mit
immer weniger Besuchern nähme Fahrt auf.
Zudem geht es nicht allein um eine Verkaufsmesse, sondern um die Erhaltung
des parallel verlaufenden Bodenseetreffens mit zahlreichen Vorträgen, per-
sönlichen Treffen, der Software Defined Radio Academy sowie vielen weite-
ren Aktionen. Das sich dieses Jahr zum 69. Mal jährende Treffen steht unter
dem Motto „Radio Scouting − Abenteuer Jugend Amateur Funk“.
Zwar gäbe es genügend andere Standorte in Deutschland, wo eine solche
Messe stattfinden könnte; nicht zuletzt in Kassel. Doch so hohe Besucherzah-
len, wie sie im Dreiländereck am Bodensee möglich sind, wären anderswo
nie mehr zu erreichen.
Weil wir vom FUNKAMATEUR uns unserer Verantwortung bewusst sind, werden
Sie uns am angestammten Platz A1-102 finden. Wir würden uns freuen,
dort möglichst viele von Ihnen wiederzusehen!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Vorsicht: Schöne neue Welt?
Was seit Jahrzehnten in utopischer Literatur und Science-Fiction-Filmen in
Perfektion zu sehen ist, hat längst Einzug in die reale Technik gehalten: die
Sprachsteuerung.
Stand anfangs die Spracheingabe als Ersatz für das lästige Tippen von Texten
im Vordergrund, hat sich dieser Zweig der Signalverarbeitung dank leistungs-
starker Prozessoren schon lange vom PC ins Smartphone verlagert. Dort ist
das Eintippen von E-Mails, SMS oder Messenger-Botschaften mittlerweile
nahezu Vergangenheit.
Der bisherige Höhepunkt dieser Entwicklung sind die sogenannten Sprach-
assistenzsysteme verschiedener Hersteller. Haben diese das jeweilige
Schlüsselwort erkannt, können sie nahezu alles steuern: vom Einschalten der
Beleuchtung in der Wohnung bis zum Füllen der Einkaufsliste. Dies wollen
uns zumindest die geschäftstüchtigen Anbieter suggerieren. Doch in der
Praxis scheitern viele der in Werbespots gezeigten Anwendungen bislang
schlichtweg noch daran, dass die erforderlichen Verbindungen zu den zu
steuernden Geräten fehlen.
So werden wohl die meisten von Ihnen die Lampen in ihrer Wohnung weiter-
hin per altmodischem Schalter steuern, und zwar manuell. Denn die Kopplung
mit einem Sprachassistenzsystem erfordert wenigstens den Austausch
des Schalters gegen ein fernsteuerbares Exemplar; von der für anspruchs-
vollere Anwendungen zusätzlich erforderlichen weiteren Hardware als
Zwischenglied gar nicht zu reden.
Schickt man aber einen Sprachassistenten auf die Suche ins Internet, zu dem
dieser ja vom Smartphone aus sowieso bzw. als eigenständiges Gerät über
WiFi in der Regel einen ständigen Zugang hat, sind zumindest Informationen
schnell verfügbar.
Die Möglichkeiten in diesem Bereich scheinen noch lange nicht ausge-
schöpft. So verwundert es nicht, dass auf Messen wie dem World Mobile
Congress in Barcelona oder der IFA in Berlin kaum ein Anbieter von mobiler
Kommunikationstechnik um den Zauberbegriff „Künstliche Intelligenz“ herum-
kommt. Doch sollte man sich als Nutzer bewusst sein, dass diese sogenannte
Intelligenz tatsächlich weniger im eigenen Smartphone, sondern eher im
externen Datennetzwerk des Softwareanbieters beheimatet ist.
Sprachsteuerungen setzen die über das Mikrofon aufgenommenen Signale in
Worte um. Dies erfolgt zwangsläufig, denn solche Systeme warten auf die
oben erwähnten bekannten Schlüsselworte. Insbesondere bei einer Internet-
suche werden noch weitere Begriffe oder Sätze an das System übermittelt,
um im Gegenzug den Suchenden mit den gewünschten Informationen zu
versorgen.
Einige Datenschützer raten zwar, besonders die nicht in Smartphones ange-
siedelten Sprachassistenten bei Nichtverwendung abzuschalten, jedoch kann
es kaum der Sinn einer Sprachsteuerung sein, diese zunächst manuell einzu-
schalten, um danach vielleicht die Lampe per Sprachbefehl zu aktivieren.
Stattdessen bleibt das System ständig aktiv – und so sollte sich jeder Nutzer
eines Sprachassistenten immer bewusst sein, dass potenziell jemand zuhört.
Zu seinem Vorteil oder zu seinem Nachteil.
Ingo Meyer, DK3RED
Digitaltechnik und Amateurfunk
In vielen Bereichen unseres Alltags hat Digitaltechnik längst Einzug
gehalten,
ob Telefonnetze, Musik- und Videospeicher, Hörfunk oder
Fernsehen. Wir
lassen uns vom Navigationssystem im Pkw leiten und setzen
daheim zu-
nehmend Mäh-, Staubsaug- oder Fensterputzroboter ein.
Vergleichbares gilt für den Amateurfunk: Digitale Signalverarbeitung
ist seit
etwa 20 Jahren verbreitet und softwaredefinierte Radios werden
mit jeder
Hard- oder Softwaregeneration leistungsfähiger. Den grafischen
Antennen-
analysator möchten viele Anwender gleichfalls nicht mehr
missen.
Ebenso gesellten sich zu RTTY, Packet-Radio − heute APRS − und PSK
weitere
digitale Sendearten. So läutete das 2001 von Joe Taylor, K1JT,
erstmals ver-
öffentlichte WSJT in diesem Segment geradezu eine Revolution
ein.
Fand das neue Verfahren anfangs hauptsächlich bei EME- und
Meteorscatter-
Freunden Anklang, ist es heute in Form von FT8 zunehmend
auf KW verbreitet.
Die bislang als Testversion 1.90 rc2 verfügbare
Variante verspricht im Pile-up
einer DXpedition QSO-Raten bis zu acht Verbindungen in der Minute.
Im Bereich der Sprachkommunikation auf UKW haben sich seit APCO P25
und D-STAR weitere Digital-Voice-Modi wie DMR und C4FM-Fusion etabliert.
Da sich damit bei normalen Ausbreitungsbedingungen größere Entfernungen
schwer überbrücken lassen, verwenden wir Relaisfunkstellen; diese sind
heute
häufig digital per Internet vernetzt. Zwar zählen solche
Verbindungen oft nicht
für Diplomprogramme wie etwa das DXCC, doch ist
dies für die tägliche
Kommunikation per Funk ohnehin bedeutungslos.
Funkamateure wollen eben ihre eigenen digitalen Netze aufbauen und
betreiben.
Was die Kommerziellen mit ihren Telefon- und
Betriebsfunknetzen können,
realisieren wir mit unseren
problemorientierten Lösungen. Erneut besteht
dabei eine Vielfalt von
Möglichkeiten: Die einen haben einfach Freude daran,
die neue Technik
auszuprobieren und sich den Umgang mit digitalen Amateur-
funknetzen
anzueignen. Andere, mit Programmierkenntnissen ausgestattete
Tüftler, arbeiten mit Begeisterung an der Weiterentwicklung dieser Systeme.
Doch machen wir uns bei aller Euphorie nichts vor: So wie im
Straßenverkehr
Leute bei Rot über die Kreuzung fahren, gibt es
Funkamateure, die ihren
eigenen Regeln folgen. Die einen betreiben
digitalen Sprechfunk nur noch
mit Headset am Computer oder gleich per
Smartphone im mobilen Internet,
obwohl sich dies vom eigentlichen
Amateurfunk entfernt. Andere nehmen
am DX-Verkehr mit Remote-Stationen
aus südlichen Gefilden unter ihrem
heimatlichen Rufzeichen teil, ohne
den Präfix des Gastlandes voranzustellen.
Und sicher finden sich eines
Tages clevere Programmierer, die dann Funk-
verbindungen etwa in FT8
vollautomatisch ablaufen lassen – obwohl dies dem
erklärten Willen des Nobelpreisträgers und Programmentwicklers Joe Taylor
entgegensteht.
Letztlich liegt es in unserer Hand, sich an solchen Aktivitäten nicht
zu beteiligen.
Dabei gilt es zu unterscheiden, ob es sich lediglich um
andere Sichtweisen oder
um zu kritisierende Rechtsbrüche handelt.
Amateurfunk und technischer Fort-
schritt – hier Digitalisierung – gehören
untrennbar zusammen. Erfreuen wir uns
also an den Vorteilen der
Digitaltechnik und zeigen Toleranz gegenüber den
Experimentierfreudigen,
ohne Regelwidrigkeiten zu akzeptieren.
In diesem Sinne werden wir uns im FUNKAMATEUR weiterhin mit moderner
Technik und innovativen Sendearten befassen. Dies jedoch unter Beachtung
vorgenannter Grenzen und ohne diejenigen auf der Strecke zu lassen, die
dem
allzu „fortschrittlichen Zeug“ wenig abgewinnen können.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
DXpeditionen – keine Erfolgsgarantie
Der Verlauf bzw. Abbruch der Bouvet-DXpedition, 3Y0Z, führt der Amateur-
funkgemeinschaft vor Augen, mit welchen Risiken ein solches Vorhaben
verbunden ist. Die von den Teilnehmern einer DXpedition auf sich genom-
menen Belastungen sind oft enorm und bedeuten zunächst ein erhebliches
finanzielles und zeitliches Engagement. Allein die Vorbereitungen bean-
spruchen viele Monate oder sogar Jahre, um formale Anforderungen zu
erfüllen, eine Transportlogistik zu organisieren sowie die Bedingungen
vor Ort zu recherchieren und einzubeziehen. Letztere können von strengen
Naturschutzvorgaben wie im Fall von Juan de Nova, FT4JA, bis zu konkreten
Gefahren durch Giftschlangen und Krokodile auf australischen Inseln reichen.
Hinzu kommen mitunter extreme klimatische Bedingungen, die bereits die
Anreise zu einem Abenteuer machen. So zeigt das Beispiel 3Y0Z, wie starke
Winde, schlechte Sicht und eine raue See die Landung auf einer Insel trotz
gründlicher Planung und professioneller Ausrüstung verhindern. Hinzu kamen
in diesem Fall Probleme mit einem defekten Schiffsmotor. Dies führte nicht
nur zum Abbruch der DXpedition noch vor der Landung, sondern ließ zudem
für den Kapitän die Rückfahrt zum Heimathafen Punta Arenas in Chile als so
gefährlich erscheinen, dass er stattdessen Kapstadt in Südafrika ansteuerte.
Ein weiteres Risiko musste ausgeschlossen werden.
Leider gehen unvorhergesehene Entwicklungen nicht immer so glimpflich
aus: So endete 1983 eine DXpedition nach Spratly in einer Katastrophe.
Diese Inseln liegen in einem Gebiet, auf das bis heute mehrere Nationen
aufgrund vermuteter Erdölvorkommen Anspruch erheben. Nach dem Beschuss
durch ein Militärboot sank das Schiff mit vier deutschen DXpeditionären.
Diethelm Müller, DJ4EI, stürzte ins Meer und starb. Die drei anderen Funk-
amateure trieben zehn Tage in einem kleinen Beiboot auf dem Meer, Gero
Band, DJ3NG, verdurstete, bevor eine Rettung erfolgte. Für die Teilnehmer
einer DXpedition können also Unwägbarkeiten bestehen, die sich selbst bei
sorgfältiger Planung nicht ausschließen lassen. Eine Erfolgsgarantie kann es
daher nie geben.
Dass das 3Y0Z-Projekt abgebrochen wurde, ist selbstverständlich bedauer-
lich. Doch obwohl viele Funkfreunde nun auf ein ATNO (All Time New One)
mit Bouvet vorerst verzichten müssen, sollte unsere Anerkennung allen
Teilnehmern gelten. Nicht nur, weil auf deren Seite die Enttäuschung noch
viel größer sein dürfte als bei den DXern, die in ihrem heimischen Shack
auf Verbindungen hofften. Sondern auch, weil die DXpeditionäre Wagnisse
eingehen, die mit unserer täglichen Lebenswirklichkeit wenig zu tun haben.
Das Bouvet-Team schrieb hierzu: „Wir reisten 2700 nautische Meilen nach
Bouvet, aber die letzte Meile erwies sich als die schwierigste.“
Der für das Wohl seiner Mannschaft und Passagiere verantwortliche Kapitän
der MV Betanzos musste die Entscheidung zum Abbruch treffen. Dem Team
um Bob, K4UEE, Ralph, K0IR, und Erling, LA6VM, bleibt zu wünschen,
dass der bereits ins Auge gefassten Organisation eines weiteren Versuchs
Erfolg beschieden sei.
Willi Paßmann, DJ6JZ
Mehr als zehn Millionen Hefte
Es ist jetzt 25 Jahre her, seit mit dem Heft 2/1993 − nach zähen Verhandlungen
mit der Treuhandanstalt − die erste Ausgabe unter meiner verlegerischen Ver-
antwortung erschien. Damals war ich voller Optimismus, dass die Zeitschrift
im wiedervereinigten Deutschland eine reale Chance hat. Gut 70 000 Funk-
amateure als potenzielle Leser, ein Team aus erfahrenen Redakteuren und
Autoren sowie meine Begeisterung für den Amateurfunk sollten eine solide
Basis für das Überleben des FUNKAMATEURs sein.
Die ersten Monate jedoch waren ernüchternd: Der Rückgang der Abonnenten-
zahl setzte sich fort und es bedurfte eines Kraftaktes, um die Zeitschrift in den
alten Bundesländern bekannt zu machen, bevor die Finanzreserven des jungen
Verlags aufgebraucht waren. Gelegenheit dazu bot sich auf der Ham Radio
1993, während der wir 8000 Hefte kostenlos verteilten und so dem Verkauf im
Zeitschriftenhandel im Altbundesgebiet, in Österreich sowie in der Schweiz
den Weg ebneten. Fortan wurden wir nicht mehr von oben herab belächelt −
der FUNKAMATEUR war jetzt Konkurrent, zumal schon damals vielen Funk-
amateuren das breit gefächerte Konzept der Zeitschrift sehr gut gefiel.
Von Anfang an war mir klar, dass wir eine anspruchsvolle und informative Zeitschrift
produzieren müssen, wenn wir am Markt bestehen wollen. Wenn wir
heute die letzte große vereinsunabhängige Amateurfunkzeitschrift wahrscheinlich
der ganzen Welt sind, basiert auf einer konsequenten Orientierung an
den Bedürfnissen unserer am Amateurfunk, aber auch an der Funktechnik im
Allgemeinen und der Hobbyelektronik interessierten Leser sowie am hohen
technischen Niveau. Dies geht einher mit einer bis heute geübten preislichen
Zurückhaltung, damit sich jeder den FUNKAMATEUR leisten kann − ob im
Abonnement oder über den Zeitschriftenhandel.
Ein außergewöhnlicher Service für eine überschaubare Kundschaft stand immer
im Mittelpunkt − angefangen 1993 mit dem Druck qualitativ hochwertiger
QSL-Karten, später mit dem Aufbau eines sehr speziellen Handelssortiments,
der Produktion von Bausätzen bis zur Eröffnung unseres PDF-Download-
Shops im Jahr 2017. Diese Kombination ist unser Alleinstellungsmerkmal.
Publizistisch fühlt sich die Redaktion dem Amateurfunk in seiner ganzen
Vielfalt wie auch weiterhin Elektronik und Funktechnik verpflichtet. Im Rahmen
unserer Möglichkeiten fördern wir den Selbstbau genauso wie die Einführung
fortschrittlicher Kommunikationstechnologien, während polarisierende und
destruktive Bestrebungen im FUNKAMATEUR keine Plattform erhalten.
Nach 300 seit Februar 1993 produzierten Ausgaben und über zehn Millionen
Heften bin ich außerordentlich froh, dass es gelungen ist, eine kompetente
Mannschaft um mich zu versammeln. Zu dieser gehören der Chefredakteur
und seine Redaktionskollegen, die Aboverwaltung, die Mitarbeiter aus Satz
und Grafik, des Verkaufs sowie des Leserservice, unsere engagierten Autoren
und kreativen Entwickler. Ihnen, Tausenden treuen Lesern und der Toleranz
meiner Frau ist es zu verdanken, dass es den FUNKAMATEUR heute noch
gibt und das Abenteuer meines Lebens nicht im Desaster geendet hat.
Was den Fortbestand unseres ureigenen Hobbys anbetrifft, so bin ich trotz
immer neuer Widrigkeiten zuversichtlich. Private Kommunikation jenseits der
IP-Infrastruktur, neue digitale Übertragungsverfahren, der Spaß am Selbstbau
und am Contestbetrieb, DXpeditionen und das einzigartige Gemeinschafts-
gefühl der Funkamateure sind heute einige der Eckpfeiler des Amateurfunks,
für den ich mich auch weiterhin mit ganzer Kraft engagieren werde.
Ihr Knut Theurich, DG0ZB
Gute Nachrichten für Selbstbauer
In vielen Bereichen unseres Alltags hat Digitaltechnik längst Einzug gehalten,
ob Telefonnetze, Musik- und Videospeicher, Hörfunk oder Fernsehen. Wir
lassen uns vom Navigationssystem im Pkw leiten und setzen daheim zu-
nehmend Mäh-, Staubsaug- oder Fensterputzroboter ein.
Vergleichbares gilt für den Amateurfunk: Digitale Signalverarbeitung ist seit
etwa 20 Jahren verbreitet und softwaredefinierte Radios werden mit jeder
Hard- oder Softwaregeneration leistungsfähiger. Den grafischen Antennen-
analysator möchten viele Anwender gleichfalls nicht mehr missen.
Ebenso gesellten sich zu RTTY, Packet-Radio − heute APRS − und PSK weitere
digitale Sendearten. So läutete das 2001 von Joe Taylor, K1JT, erstmals ver-
öffentlichte WSJT in diesem Segment geradezu eine Revolution ein.
Fand das neue Verfahren anfangs hauptsächlich bei EME- und Meteorscatter-
Freunden Anklang, ist es heute in Form von FT8 zunehmend auf KW verbreitet.
Die bislang als Testversion 1.90 rc2 verfügbare Variante verspricht im Pile-up
einer DXpedition QSO-Raten bis zu acht Verbindungen in der Minute.
Im Bereich der Sprachkommunikation auf UKW haben sich seit APCO P25
und D-STAR weitere Digital-Voice-Modi wie DMR und C4FM-Fusion etabliert.
Da sich damit bei normalen Ausbreitungsbedingungen größere Entfernungen
schwer überbrücken lassen, verwenden wir Relaisfunkstellen; diese sind heute
häufig digital per Internet vernetzt. Zwar zählen solche Verbindungen oft nicht
für Diplomprogramme wie etwa das DXCC, doch ist dies für die tägliche
Kommunikation per Funk ohnehin bedeutungslos.
Funkamateure wollen eben ihre eigenen digitalen Netze aufbauen und betreiben.
Was die Kommerziellen mit ihren Telefon- und Betriebsfunknetzen können,
realisieren wir mit unseren problemorientierten Lösungen. Erneut besteht
dabei eine Vielfalt von Möglichkeiten: Die einen haben einfach Freude daran,
die neue Technik auszuprobieren und sich den Umgang mit digitalen Amateur-
funknetzen anzueignen. Andere, mit Programmierkenntnissen ausgestattete
Tüftler, arbeiten mit Begeisterung an der Weiterentwicklung dieser Systeme.
Doch machen wir uns bei aller Euphorie nichts vor: So wie im Straßenverkehr
Leute bei Rot über die Kreuzung fahren, gibt es Funkamateure, die ihren
eigenen Regeln folgen. Die einen betreiben digitalen Sprechfunk nur noch
mit Headset am Computer oder gleich per Smartphone im mobilen Internet,
obwohl sich dies vom eigentlichen Amateurfunk entfernt. Andere nehmen
am DX-Verkehr mit Remote-Stationen aus südlichen Gefilden unter ihrem
heimatlichen Rufzeichen teil, ohne den Präfix des Gastlandes voranzustellen.
Und sicher finden sich eines Tages clevere Programmierer, die dann Funk-
verbindungen etwa in FT8 vollautomatisch ablaufen lassen − obwohl dies dem
erklärten Willen des Nobelpreisträgers und Programmentwicklers Joe Taylor
entgegensteht.
Letztlich liegt es in unserer Hand, sich an solchen Aktivitäten nicht zu beteiligen.
Dabei gilt es zu unterscheiden, ob es sich lediglich um andere Sichtweisen oder
um zu kritisierende Rechtsbrüche handelt. Amateurfunk und technischer Fort-
schritt − hier Digitalisierung − gehören untrennbar zusammen. Erfreuen wir uns
also an den Vorteilen der Digitaltechnik und zeigen Toleranz gegenüber den
Experimentierfreudigen, ohne Regelwidrigkeiten zu akzeptieren.
In diesem Sinne werden wir uns im FUNKAMATEUR weiterhin mit moderner
Technik und innovativen Sendearten befassen. Dies jedoch unter Beachtung
vorgenannter Grenzen und ohne diejenigen auf der Strecke zu lassen, die dem
allzu „fortschrittlichen Zeug“ wenig abgewinnen können.
Peter Schmücking, DL7JSP, FA-Leserservice
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Es bleibt spannend
Liebe Leser, mit der Dezemberausgabe abschließend hoffen wir, Ihnen auch
2017 wieder genügend interessante Themen geboten zu haben. Gemäß
unserem Untertitel Magazin für Amateurfunk, Elektronik, Funktechnik sprechen
wir ja traditionell einen breitgefächerten Leserkreis an. Hinzu kommt die
Herausforderung, von Ausgabe zu Ausgabe immer wieder den Spagat zu
meistern zwischen anspruchsvollen Themen, die sich Ingenieure wünschen,
und eher leichtverdaulicher Kost für in manchen fachlichen Bereichen nicht
so Bewanderte. Angesichts unserer großen Seitenzahl und Themenvielfalt
sollte dennoch übers Jahr hinweg für jeden genügend Lesestoff dabei
gewesen sein.
An dieser Stelle meinen Kollegen in Redaktion und Satzabteilung, den freien
Mitarbeitern sowie unseren zahlreichen Hobbyautoren ein Dankeschön für
ihre Mitwirkung an den zwölf Ausgaben dieses Jahres!
Funk- und Elektronikamateure, die etwas Interessantes ausgetüftelt haben,
eine gedruckte Veröffentlichung aber vielleicht noch scheuen, kann ich nur
ermuntern, uns ihre Ideen zukommen zu lassen. Beim Feinschliff der Texte
helfen die versierten Redakteure ohnehin, und zur Abrundung eines Beitrags
entwerfen wir sogar gelegentlich eine kleine Platine oder ein Berechnungs-
Tool.
Für das kommende Jahr stehen wieder aufregende Ereignisse ins Haus. Vor
Hunderten Freiwilligen, die die Amateurfunk-Team-Weltmeisterschaft WRTC
in Jessen/Wittenberg ausrichten, steht eine immense Aufgabe, die trotz
erfolgreicher Testtage und einer grandiosen Teilnahme an der Ham Radio 2017
in diesem Umfang ein Novum darstellt. Als einer der Sponsoren werden wir
diesen Mega-Event des Amateurfunks nachhaltig unterstützen und Sie
umfassend informieren − auch topaktuell über unsere Website.
Ein Leckerbissen für VHF/UHF-Fans sowie ATV-Liebhaber dürfte der Satellit
Es'hail-2 mit dem von der AMSAT-DL entwickelten P4A-Transponder werden.
Hierzu gab es bereits etliche Beiträge mit Bauanleitungen im FA – weitere
folgen zeitnah.
Auf die DXer wartet bereits im Januar die lang ersehnte DXpedition eines
multinationalen Teams zum äußerst gefragten DXCC-Gebiet Bouvet. Wegen
der großen Bedeutung dieser Aktion bringen wir dazu bereits auf Seite 1116
einige Vorabinformationen.
Mit dieser Ausgabe geht das Digital-QTC, anfangs D-STAR-QTC, ins elfte Jahr!
Erstaunlich, wie sich über die Jahre unser Relaisfunkstellen-Netz gewandelt
hat und welche Vielzahl an neuen Repeatern für Digital-Voice-Sendearten
hinzugekommen ist bzw. von analog auf digital umgerüstet wurde. Diesem
Trend wollen wir uns über das Digital-QTC hinaus stärker zuwenden, um den
vielen Einsteigern Hilfestellung zu bieten.
Für die Website www.funkamateur.de haben wir uns ebenfalls einiges vorge-
nommen, ohne Bewährtes über Bord zu werfen. So ist zur Lösung häufiger
Aufgabenstellungen beim Funk- und Elektronikbasteln eine Sammlung von
Online-Rechnern vorgesehen, die sich in jedem Browser, ebenso auf Smart-
phones oder Tablets, nutzen lässt.
Es bleibt also rundherum spannend. Lassen Sie sich überraschen, was wir
Ihnen weiterhin an Lesenswertem bieten, und halten Sie mit Kritik und
Wünschen nicht hinterm Berg!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
CQ
Das bekannte Kürzel steht per Definition als „Allgemeiner Anruf“ und Einladung
an alle, die diesen Ruf hören, darauf zu antworten.
Ich denke einmal zurück an die Anfänge meiner Amateurfunkaktivität in der
zweiten Hälfte der 1970er-Jahre. Da saß ich abends an einer geborgten röhren-
bestückten Kurzwellenstation, die eine W3DZZ in 7 m Höhe im Garten speiste.
Auf 80 m hatte ich Schwierigkeiten, eine freie Frequenz zu finden, um den
oben zitierten CQ-Ruf abzusetzen. Das Band war voll von CQ rufenden und
QSO fahrenden Stationen, selbst im CW-Bereich.
In welche Richtung hat sich unser Tun auf den Bändern seitdem verändert?
Ich finde eigentlich immer „freie“ Frequenzen auf 80 m oder 40 m. Gleich,
ob am Wochenende oder unter der Woche. Nur in den Abendstunden ist es
im SSB-Bereich auf 80 m etwas komplizierter, weil es eine Spezies unter uns
Funkamateuren gibt, die „feste Kanäle“ als ihr Eigentum betrachten, aber das
ist ein anderes Thema. Zwischen diesen Kanälen gibt es viel Platz für einen
CQ-Ruf, doch der findet immer seltener statt.
Das klassische CQ scheint auszusterben. An den Bandenden wird CQ-DX
gerufen, aber das einfache CQ, das zu normalen QSOs führt, bei denen man
sich über Technik, Wetter, Funkwetter oder Antennen austauscht, ist selten
geworden. Wer Bandpunkte sucht und sammelt, der fragt das DX-Cluster.
Das sagt ihm, auf welcher Frequenz er den nächsten seltenen Vogel fangen
kann.
Sammelt noch jemand „normale“ QSL-Karten (also nicht KH8 auf 160 m oder
VK auf 6 m)? Denn das wäre ja dann die Bestätigung für ein herkömmliches
QSO? Da winken viele ab. Mit dem Hinweis, dass man schon alles gearbeitet,
schon alles bestätigt und alles in Schuhkartons auf dem Dachboden gebunkert
habe, wird die angebotene QSL dankend abgelehnt. Gut, also auch dafür muss
man nicht CQ rufen.
Bleiben die UKW-Enthusiasten. Die jagen ja immer nach neuen Mittelfeldern
oder DXCC-Gebieten, die müssen ja CQ rufen. Das tun sie − zu den großen
Contesten. Da findet sich keine freie Frequenz. Die Klubstation DA0FF hat im
Marconi-Contest 2015 auf 2 m in CW 121 Mittelfelder gearbeitet. Das schaffen
Sie mit einer durchschnittlichen 2-m-Station nicht in einem Kalenderjahr, wenn
Sie es mit normalen CQ-Rufen versuchen. Viele Amateure, die mit ihrer Fest-
station täglich QRV sein könnten, schalten einfach nicht ein.
Da das alles aussichtslos scheint, versuchen Sie doch Ihr Glück im Reverse-
Beacon-Network (RBN). Oder gleich ganz digital mit WSPR auf wsprnet.org.
In beiden Fällen ist man nicht darauf angewiesen, dass ein aktiver OM den
CQ-Ruf belauscht und antwortet − nein, man findet sich selbst wieder und
erkennt, wie weit das eigene Signal reicht. Das ist, wie ich finde, eine durch-
aus nützliche Einrichtung, obwohl ein Bakenbummel bei offenem, aber
scheinbar totem 10-m- oder 12-m-Band ein spannendes Erlebnis sein kann.
Wie auch immer, lesen Sie sich doch einmal unter www.reversebeacon.net
in die Materie ein und nutzen Sie das RBN, um zu beobachten, wo Ihr Signal
wahrzunehmen ist. Dabei rufen Sie wirklich CQ und nicht „test“ und hören
zusätzlich zum Blick ins RBN auf eine eventuelle Antwort! So werden sich
über kurz oder lang bestimmt QSO-Partner melden und Sie finden zu
normalen QSOs zurück!
Peter John, DL7YS
Amateurfunk – von gestern oder zeitgemäß?
Berichte ich im Bekanntenkreis über unser Hobby, den Amateurfunk, begegnet
mir manchmal zögerliches Interesse; überwiegend jedoch eher Unverständnis
bis hin zu Ablehnung. Eine typische Haltung: „Amateurfunk? Das ist doch von
gestern, warum nutzt ihr nicht einfach das Internet?“
Es passt offenbar nicht in die heutige Erfahrungswelt vieler Menschen, den
Reiz und die Besonderheit direkter internationaler Funkverbindungen zu
erkennen. Mit jedem Smartphone sind längst weltweite Kontakte möglich
und Entfernungen spielen dank der Möglichkeiten des Internets scheinbar
keine Rolle mehr.
Doch wir Funkamateure wissen es besser. Wir nutzen sehr wohl das Internet,
jedoch nicht allein zum bequemen Konsumieren, sondern als Werkzeug.
Zur Wissensvermittlung, als ergänzendes Medium zur Vorbereitung von
Funkkontakten sowie zum Erfahrungsaustausch, der unmittelbar einfließt
in die Weiterentwicklung moderner Technologien und Funkverfahren.
Ein aktuelles Beispiel ist die neue digitale Sendeart FT8: Dieser sogenannte
Weak Signal Mode ermöglicht es, in einem scheinbar ungenutzten Band
mit für das Ohr nicht wahrnehmbaren Funksignalen Informationen zwischen
Kontinenten zu übertragen. Hinzu kommt als wohl wichtigstes Merkmal von
FT8 im Vergleich zum etablierten JT65 eine Vervierfachung der Übertragungs-
geschwindigkeit. Entwickelt von keinem Geringeren als dem Nobelpreisträger
für Physik, Professor Joseph Hooton Taylor, K1JT, hat dieses Verfahren als
Bestandteil der Software WSJT-X in Rekordzeit bei Funkamateuren weltweite
Verbreitung gefunden.
Das Internet dient in diesem Zusammenhang keineswegs allein zum Herunter-
laden der aktuellsten Software-Version. Vielmehr bringen sich viele Funk-
amateure aktiv ein, um etwa mithilfe von weltweit verfügbaren sowie optisch
ansprechenden Kartendarstellungen aktueller Empfangs- und Verbindungs-
meldungen das Interesse am Amateurfunkbetrieb in Digimodes weiter zu
steigern. Zudem ermöglichen solche Informationen Ausbreitungsanalysen
und regen dazu an, das eigene Wissen in diesem Bereich zu erweitern.
Im Zentrum stehen bei alledem immer der Spaß an weltweiter Kommunikation
sowie das Ausloten von Verbindungsmöglichkeiten angesichts schwieriger
Ausbreitungsbedingungen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen finden ihren
Weg zurück zu den Entwicklern, hauptsächlich über Mailinglisten. Amateurfunk
und Internet sind also keineswegs ein Widerspruch. Dafür gibt es viele
Beispiele und die derzeitige Entwicklung in Zusammenhang mit FT8 zeigt
deutlich, wie gut sich beide Medien zum Vorteil des Amateurfunks ergänzen −
die Bereitschaft zur kollegialen Kooperation vorausgesetzt.
Festzuhalten bleibt ferner, dass Hochtechnologie weiterhin ein wichtiger
Bestandteil des Amateurfunks ist. Welche Möglichkeiten neue Sendearten
eröffnen und unter welchen Bedingungen diese Vorteile bringen, darüber
berichten wir in dieser Ausgabe ab Seite 960: Der Beitrag „Neue Digi-Modes
FT8 und T10 in der Praxis“ informiert über aktuelle Entwicklungen auf dem
Gebiet der digitalen Kommunikation per Funk.
Willi Paßmann, DJ6JZ
Rückenwind für die WRTC
Die Amateurfunk Weltmeisterschaft 2018 in Deutschland rückt näher und zwei
große Aktionen liegen hinter dem Organisationsteam: Ende Juni kamen bei
einem Testtag in der Region südlich von Berlin 100 Amateurfunkbegeisterte
zusammen, um Logistik, Aufbau sowie Zusammenarbeit zu trainieren.
Anschließend war die WRTC eines der Hauptthemen auf der Ham Radio in
Friedrichshafen. Beide Aktionen erwiesen sich als ebenso aufwendig wie
erfolgreich.
Dabei ging es jeweils um Menschen, Material und Planung. Der Testtag hatte
zum Ziel, 15 gleiche Stationen zu errichten, wofür die benötigten Helfer ge-
schult und eingeteilt werden mussten. Manches eingespielte OV-Team hat
dabei in bewährter Weise zusammengearbeitet. Andere Teams fanden sich
erst aus den aus allen Himmelsrichtungen angereisten Helfern zusammen.
Dieses Kennenlernen und Zusammenarbeiten war der Beginn vieler Freund-
schaften.
Eine kurze Umfrage ergab: Alle Helfer sind stolz und glücklich, haben Ideen,
was sich verbessern lässt. Und alle wollen 2018 unbedingt mit dabei sein.
Hier zeigte sich Ham Spirit in hoher Konzentration.
Viele Helfer haben sich ebenso während der Ham Radio eingebracht. Dieses
zweite Großereignis hatte einen anderen Charakter als der Testtag: Es ging
dort nicht darum, nach „Schema F“ fünfzehnmal den Standard abzuliefern,
sondern viele verschiedene Aktionen zu planen und durchzuführen.
Der DARC e.V. hatte uns bereits 2016 angesprochen und die WRTC als Leit-
thema der Messe vorgeschlagen. Dankbar haben wir diese Gelegenheit zur
Präsentation angenommen; einschließlich der Ausrichtung der Tombola,
denn unsere Sponsoren hatten attraktive Preise zugesagt.
Die fünf Verlosungen leiteten wir jeweils mit einem WRTC-Informationsblock
ein. So erfuhren die Tombola-Teilnehmer vom Testtag, waren bei der Auf-
führung des Testtags-Films dabei und schauten begeistert dem Ausscheid
um den WRTC-2018-„Strong Man“ zu − Näheres dazu im Messebericht
ab S. 814. Ein Höhepunkt war das Treffen der WRTC-Teilnehmer aus drei
Jahrzehnten, denn dafür kamen etliche Legenden auf der Aktionsbühne
zusammen.
Der Erlös aus der Tombola übertraf alle Erwartungen, selbst wenn nicht jeder
den Hauptpreis gewinnen konnte. Diese Einnahmen kommen vollständig der
Organisation der WRTC 2018 zugute.
Fast noch wichtiger als Geld war es, weitere Helfer für die WRTC-Woche im
Juli 2018 zu gewinnen. Als Blickfang und Sammelpunkt diente dafür eine
komplette WRTC-Station im Innenbereich des Messegeländes – für mich der
kritischste und zugleich erfolgreichste Teil unserer Messepräsenz.
Dafür hatten wir vorab vieles aus 700 km Entfernung zu organisieren. So
mussten Spiderbeam und Mast sowie alle weiteren Komponenten rechtzeitig
nach Friedrichshafen gelangen, um die Station bereits am Donnerstag auf-
zubauen. Für alles haben sich Lösungen gefunden – dank eines starken Teams
von Mitdenkern und Machern, „Ham Spirit Rules!“
Mich erfüllen der Testtag sowie unser Messeauftritt mit großer Dankbarkeit
und Zuversicht in Hinblick auf 2018: Wir Funkamateure sind in der Lage,
zusammenzuarbeiten und große Projekte zu stemmen. Der erlebte Rücken-
wind tut gut, doch müssen wir konzentriert unseren Kurs halten.
Dann erwarten uns unvergessliche Tage im Sommer 2018.
Dr.-Ing. Michael Höding, DL6MHW
Leiterplatten einfacher herstellen
Wohl kaum ein elektronisches Gerät kommt heutzutage ohne Leiterplatten
aus, dienen diese doch zur mechanischen Befestigung und elektrischen
Verbindung der elektronischen Bauteile. Erst deren Einsatz ermöglichte
der Industrie die Produktion elektronischer Schaltungen in hoher Stückzahl
bei gleichbleibender Qualität. Längst sind Leiterplatten auch aus der Praxis
des Hobbyelektronikers nicht mehr wegzudenken.
Der Vorläufer unserer heutigen Leiterplatte stammt aus den 1920er-Jahren.
Damals wurden gestanzte Leiterzüge auf ein Trägermaterial, meist Hartpapier,
genietet. Doch diese Technik führte lange ein Schattendasein und erst mit
der Miniaturisierung der Bauelemente sowie einem veränderten Herstellungs-
prozess nahm deren Bedeutung zu. Aus dieser Zeit stammt auch die beson-
ders im englischen Sprachraum anzutreffende Bezeichnung printed circuit
board (PCB), also gedruckte Schaltungsplatine. Anfang der 1950er-Jahre
begann letztlich ihr Siegeszug.
So wie sich in den folgenden Jahrzehnten die Trägermaterialien veränderten
und die realisierbare Anzahl der Kupferlagen stieg, vollzog sich beim Herstel-
lungsprozess ebenfalls ein Wandel. Dabei ist das fotochemische Verfahren
wohl das bekannteste. Spätestens, als und ein- zweiseitig kupferkaschiertes
Basismaterial mit einer bei UV-Strahlung aushärtenden Lackbeschichtung zur
Verfügung stand, hatte die Leiterplatte das Amateurlabor endgültig erobert.
Es fehlte allerdings nicht an Versuchen, die hierbei notwendigen Arbeits-
schritte der Belichtung und Entwicklung zu umgehen. So nutzen einige Hobby-
elektroniker mit manchmal mäßigem Erfolg vermeintlich flächendeckend
wasserfeste Materialien, wie Tusche, Lack, Abreibesymbole oder Edding-Tinte,
um die für den Ätzprozess erforderliche Abdeckung der späteren Leiterbahnen
und Lötaugen zu erreichen.
Mit dem Einzug von preiswerten Laserdruckern eröffnete sich im Hobbybereich
ein weiteres Verfahren zur Abdeckung der nicht zu ätzenden Flächen. Da der
in diesen Druckern verwendete Toner aus sehr kleinen Kunststoffteilchen
besteht, lässt er sich auch als wasserfeste und der Ätzlösung trotzende Schicht
auf die blanke Kupferschicht auftragen. Dafür muss man lediglich das auf
einem möglichst glatten Stück Papier oder einer Folie gedruckte Layout auf
die blanke Kupferfläche übertragen − die Tonertransfer-Methode war geboren.
Kamen hierfür anfangs noch Bügeleisen mit wechselndem Erfolg zum Einsatz,
bedienen sich einige Amateure seit Jahren eines anderen Hilfsmittels, das
ebenfalls nicht dafür erfunden wurde: des Laminiergeräts. Dieses erzeugt
sowohl Hitze als auch Druck, ist also prädestiniert, bei der Leiterplattenher-
stellung das Bügeleisen zu ersetzen. Wie dieses Verfahren funktioniert, zeigt
unser Beitrag ab Seite 730.
Zwar lassen sich heutzutage Leiterplatten relativ preiswert bei kommerziellen
Herstellern in Auftrag geben. Geht es aber darum, schnell eine Idee auszu-
probieren oder einen Prototyp herzustellen, hat das gute alte Heimlabor
immer noch unbestrittene Vorteile und daher weiterhin seine Daseins-
berechtigung.
Ingo Meyer, DK3RED
Antennengeschädigt?
Neulich traf ich durch Zufall jemanden, von dem sich herausstellte, dass er
ebenfalls Funkamateur ist. Stolz nannte er sein Rufzeichen der Zeugnisklasse A
und betonte sogleich, dass er KW-DXer sei.
Das trifft sich ja gut, dachte ich. Doch stellte sich im Fortgang des Gesprächs
bald heraus, dass er zu diesem Thema aktuell gar nichts beitragen kann.
Nanu, wie das? Ja, er habe eben seit Ewigkeiten nicht mehr gefunkt, denn
er sei doch antennengeschädigt. Mit Verständnis heischendem Blick kam ein
„Du weißt schon“ hinterher. Das weiß ich aber anders!
Freilich ist es schön, zu Hause eine Antenne zu haben und einfach nur vom
Sofa oder dem Basteltisch aufspringen zu müssen, weil gerade eine gefragte
DXpedition auf dem Band auftaucht. Aber muss man denn als Bewohner einer
Mietwohnung ohne Antennengenehmigung gleich die Flinte ins Korn werfen?
Einen Dipol für 20 m oder im Sommer für 6 m, auch abgewinkelt, wird allerdings
nicht jeder unerlaubt auf dem Balkon unterbringen können oder wollen.
Und die UKW-Antenne, an einem Contest-Nachmittag auf dem Balkon montiert,
hat zwar schon manche schöne DX-Verbindung auf VHF oder UHF
beschert, erfordert indes eine Lage mit halbwegs freier Sicht.
Selbst eine Magnetantenne mag es lieber hoch und frei; sie wird in einer Erd-
geschosswohnung inmitten des Häusermeers selten zu DX-Erfolgen führen.
Eine halbwegs „sozialverträgliche“ Balkonantenne kann dennoch zu manchem
Gelegenheits-QSO verhelfen − Beispiele haben wir öfters im FA gebracht.
Die Nutzung von Remote-Stationen dürfte für viele allerdings keine Lösung
darstellen, obwohl wir uns wohl angesichts wachsendem Elektrosmog zu-
nehmend mit solchen Varianten werden anfreunden müssen.
Doch wie wäre es denn mit Portabelbetrieb? Ging dies früher lediglich mit ein
paar Watt, so sind 100-W-Transceiver im Autoradioformat heute gang und
gäbe. Ein ebenso kleiner 20-Ah-Lithiumakkumulator wiegt kaum mehr als eine
gefüllte Anderthalbliter-Flasche. Ergänzt um einen GFK-Mast und eine leichte
Antenne ist solch eine Portabelausrüstung, gleich ob für KW oder UKW, von
einer Person problemlos zu transportieren.
Bei einem Fieldday in geselliger Runde sind überdies ein wuchtiger Beam und
Kilowatt-Endstufe samt Benzinaggregat oft Stand der Technik. Apropos:
Wenn auch bedauerlicherweise nicht mehr jeder Ortsverband des DARC e.V.
oder VFDB e.V. eine Klubstation betreiben kann, so gibt es davon glücklicher-
weise noch sehr viele. Es gibt sogar zahlreiche namhafte DXer, die noch nie von
zu Hause aus, sondern immer nur an Klubstationen gefunkt haben. Vielleicht
findet unser „antennengeschädigter“ OM eine in vertretbarer Entfernung, an
deren Aktivitäten er sich beteiligen kann.
Selbst wenn dies zunächst nicht gelingt: Auch für 2017 haben die Organisa-
toren des WAG-Contests wieder eine „WAG-Börse für OPs und Multi-OPs“
ins Leben gerufen. Da können Contest-Stationen Operatoren suchen und
umgekehrt. Eine tolle Idee, die sich auf andere Conteste ausdehnen ließe!
Es gibt also der Möglichkeiten viele, man muss nur wollen. Vermutlich haben
Sie doch ohnehin bald Urlaub…
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Mitdenken beim Konsumieren
Neulich suchte ich im Internet längere Zeit nach einer bestimmten Formel.
Es gab alle möglichen Fundstellen, darunter zahlreiche PDF-Dateien mit
hochtrabenden Abhandlungen, nur das Gesuchte war nicht dabei. Letzten
Endes gab ich auf und kramte im Bücherregal nach einem Formelbuch –
und da stand die Gleichung.
Selbst beim Online-Einkauf ist es trotz Suchmaske, Online-Blätterkatalog und
weiterer Hilfen manchmal besser, zusätzlich den gedruckten Katalog vor sich
zu haben − gleichgültig, ob es um Kleidungsstücke, Fahrradersatzteile oder
elektronische Bauelemente geht. Hier ergänzen sich „analoge Technik“ und
„Digitalisierung“.
DX-Verkehr erscheint heute im KW-Bereich ohne Cluster-Unterstützung kaum
noch denkbar, und viele Telegrafisten wollen obendrein das Reverse Beacon
Network (RBN) nicht mehr missen. Aber ist das allein selig machend? Wir
sind trotz solcher Hilfen weiterhin gut beraten, hin und wieder selbst übers
Band zu drehen. Mir gingen jedenfalls dadurch auf allen Bändern schon
wertvolle Bandpunkte ins Netz, vielleicht gerade weil die betreffende Station
eben noch nicht überall auf dem Bildschirm zu sehen war.
Und immer helfen Cluster und RBN sowieso nicht. So kürzlich gegen 2000 UTC
während der W7-QSO-Party auf Kurzwelle. Eine europäische Skimmerstation
− also ein SDR, das automatisch das Band absucht und CW-Stationen iden-
tifiziert – meldete im RBN den Empfang von W7DMH aus dem fernen und
seltenen US-Bundesstaat Utah. Ein Leckerbissen, noch dazu auf 40 m!
Dumm nur, dass bei uns gerade erst die Sonne untergegangen war und sie
in Utah noch fast im Zenit stand. Keine Chance auf eine Verbindung mit dem
Mittleren Westen der USA zu dieser Zeit auf dieser Frequenz… In Wirklichkeit
war es IW7DMH und der Skimmer hatte sich ganz einfach „verhört“, vielleicht
war das Signal bei ihm schwundbehaftet oder gestört. Das ist kein Einzellfall.
Wir alle nutzen im täglichen Leben wie im Hobby die Vorzüge der Digital-
technik. Gleichwohl sind wir gut beraten, den Segnungen der Digitalisierung
nicht blindlings zu vertrauen. Die schönen Helferlein können versagen, warum
auch immer. Es ist mehr denn je unverzichtbar, mitzudenken, Ergebnisse auf
Plausibilität zu prüfen, Dinge zu hinterfragen. Das ist eigentlich nicht neu.
Beim seit etwa 40 Jahren überall präsenten Taschenrechner, einem der ersten
digitalen Alltagsprodukte, machen wir dies doch schon immer, um Tippfehler
zu erkennen.
Dies bedingt selbstredend, über die entsprechenden Kenntnisse sowie Fähig-
keiten zu verfügen, sie zu hüten und zu nutzen, damit sie nicht in Vergessen-
heit geraten. Liebe CW-Fans, Hand aufs Herz: Können Sie mit einer Handtaste
noch genauso sauber und flott geben, wie sie es mit der Elbug oder einer
PC-Tastatur tun? Und wie war das doch gleich mit der Thomsonschen
Schwingungsgleichung?
Wer ist noch in der Lage, sich zielsicher mit einer guten Landkarte in einer
fremden Gegend zu orientieren? Nicht wenige standen schon mit ihrem Pkw
vor einem Sumpf oder einer Hafenkante, weil sie ihrem Navigationsgerät zu
sehr vertraut hatten. In einem solchen Fall kann das angemahnte Mitdenken
also sogar Unheil abwenden.
Die Bewahrung unserer Fähigkeiten als Funkamateure und Hobbyelektroniker,
Dinge tun zu können, die uns sonst Automaten abnehmen, oder Geräte und
Einrichtungen selbst herzustellen, die andere fertig kaufen, könnte zudem in
Notsituationen außerordentlich hilfreich sein.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Funkamateure finden Wege
Amateurfunk ist ein vielfältiges technisches Hobby. Dabei kann sich jeder
Funkamateur aus dem breiten Themenspektrum die für ihn interessanten
Bereiche heraussuchen und diesen nachgehen.
So gibt es in unserem örtlichen Funkklub insbesondere unter den Neuein-
steigern leidenschaftliche Selbstbauer, die sich intensiv mit Schaltungen
befassen und regelmäßig zum Lötkolben greifen. Andere Mitglieder haben
Spaß daran, sich der Firmware etwa von DMR-Funkgeräten anzunehmen und
diese mit eigenen Ideen zu verfeinern. Wieder andere sind leidenschaftliche
DXer und jagen mit geschultem Gehör sowie geübter Betriebstechnik jedem
noch so schwachen Signal einer seltenen Station hinterher.
Alle gemeinsam haben wir einen Fieldday erlebt, mehrere portable Stationen
sowie Antennen − darunter selbst gebaute Richtstrahler für Kurzwelle −
errichtet und uns über erstaunlich störungsarme Empfangsbedingungen
gefreut. Es war seit Langem unser erster Feldtag und sicher nicht der letzte,
denn die Planungen für den nächsten laufen schon.
Bei alledem eignen wir uns in der Praxis Kenntnisse und Fertigkeiten an, über
die in ihrer Summe wohl nur Funkamateure verfügen: Wir wählen Sendearten,
Frequenzen sowie Antennen nach Bedarf, um die gewünschte Funkverbin-
dung herzustellen.
Professionelle Funkdienste sind oft weniger flexibel und wenn dort eine Ver-
bindung nicht funktioniert, dann kommt diese eben nicht zustande. Ich
erinnere mich an vergebliche SSB-Funkversuche einer kommerziellen Land-
funkstelle von Fehmarn nach Sylt bei 2 MHz mit 1 kW Sendeleistung über
einen kurzen Vertikalstrahler, die zu nichts führten. Gegen Mittag und mangels
einer Alternativfrequenz auf einem höheren Band kam dieses Scheitern nicht
überraschend.
Bei einer späteren Großübung professioneller Hilfsdienste waren es an-
wesende Funkamateure, die mit ihren VHF-Handfunkgeräten eine wichtige
Meldung doch noch übermitteln konnten. Den BOS-Funkern gelang dies –
in hügeliger Umgebung außerhalb der Relais-Reichweite − mit professionellen
Geräten nicht.
Solche Erfahrungen sind kein Anlass für Hochmut unsererseits, das wäre
ein falscher Weg; doch unter den Scheffel stellen brauchen wir unser Licht
ebenso nicht.
Zwar bestehen bei manchen Behörden mitunter noch immer Vorbehalte
gegenüber den Angeboten des Amateurfunks, doch lässt dies erkennbar nach.
So unterstützen nun Funkamateure in Bayern das THW bei der Wiedereinfüh-
rung von Kurzwellenfunk für innerdeutsche Verbindungen.
Anderswo sind lange verwehrte wichtige Standorte zum Ausbau des vom
Internet unabhängigen HAMNET nun doch verfügbar. Offenbar setzt sich bei
den entsprechenden Stellen die Erkenntnis durch, dass Funkamateure kom-
petente Partner sein können, sollten die gewohnten Kommunikationswege
doch einmal ausfallen.
Wie Felix Riess, DL5XL, in seinem Vortrag während der Ham Radio 2016
berichtete, hat sich dies bis in die Antarktis herumgesprochen. DL5XL hatte
schon als Schüler zum Amateurfunk und darüber später zu seinem Studien-
fach, der Elektrotechnik, gefunden. Dann bekam er die Gelegenheit, als Elek-
troniker und Funker in der deutschen Forschungsstation Neumayer in der
Antarktis zu arbeiten.
Auch dort sind neben den fachlichen Kenntnissen aus Studium und Beruf
die zusätzlichen praktischen Erfahrungen der Funkamateure, die (fast) immer
einen Weg für eine Funkverbindung finden, sehr willkommen.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Lieber José,
wir hatten ein QSO. Am 9. Februar 2013 um 0451 UTC auf 1821 kHz.
Ein schönes, komplettes, eindeutiges CW-QSO. Kuba auf 160 m!
Für mich zum ersten und bisher einzigen Mal.
Leider hast Du auf meine QSL im Direktversand mit selbstadressiertem
Rückumschlag und den obligaten zwei Dollarnoten nicht reagiert. Obwohl
in Deinem QRZ.com-Eintrag Deine QSL zu sehen ist, nebst dem Hinweis,
dass Du Sachspenden nicht abgeneigt bist. Kann ich verstehen. Ich war
schon einmal in Kuba, auch in Santa Clara, wo Du zu Hause bist, und habe
bei den Kollegen vom Rundfunk ein paar dringend benötigte Bauteile hinter-
lassen; bei uns Massenware.
Ich habe Dir also noch einmal geschrieben, dann ein drittes Mal, und Dir
E-Mails getippt. Einmal hast Du sogar geantwortet und versprochen, die QSL
zu senden. Daraufhin schickte ich Dir einen vierten Dollarbrief. Es kam wieder
nichts. So ist das eben, jetzt geb’ ich’s auf.
Man ist ja rasch verlockt zu Vorurteilen: Briefboten, die sich selbst bedienen,
das Postsystem überhaupt in „so einem“ Land. Dazu die permanente
„Mañana-Mentalität“ der eher lebensfrohen als pflichtbewussten Menschen…
Und so weiter. Selbst wenn man das alles rasch wieder wegdenkt:
Letztlich stehst Du ja doch da, lieber José, als funkender Repräsentant
Deines Landes.
Lieber Hans-Jürgen, Peter, Dieter, liebe Bärbel etc. − wie steht es denn bei
Dir mit der QSL-Moral? Wartest auch Du nach jedem DX-Fang auf die QSL,
direkt und rasch-rasch? Bist Du enttäuscht, wenn sie ausbleibt? Oder gehörst
Du zur „Demnächst“-Gilde? Demnächst setzt Du Dich hin und arbeitest den
Log-Rückstand auf?
Schrecklich, wie viel da zusammengekommen ist! Na, zu den Feiertagen aber…
Demnächst bringst Du den Packen zum OV-Abend. Schade nur, dass Dir
immer etwas dazwischen kommt. Vielleicht dauert es auch, bis demnächst
die Karten vom OV zur QSL-Vermittlung wandern. Ich will diesen Faden gar
nicht weiterspinnen. Und deshalb wartet womöglich nun irgendwo ein José
endlos auf Deine Karte.
Na ja, überhaupt: die QSL-Karte. Die galt ursprünglich als Trophäe, weil
überhaupt jede geglückte Funkverbindung ein Abenteuer war. Wer alte
Karten in die Hand bekommt („Spark forever!“), mit Bleistiftskizzen der Schal-
tung, erahnt, welche Pionierzeiten das waren, vor neunzig, achtzig Jahren.
Und wie die Funkamateure nicht nur neue Sendearten oder neue Bänder
erschlossen haben: Noch vor siebzig Jahren war Funk gleichbedeutend
mit Selbstbau, jedes QSO daher ein technischer Leistungsnachweis.
Da steht dann schon AM oder TEN (28 MHz!) auf der Karte. Zudem der
brüchige holzhaltige Karton der QSLs vor sechzig Jahren, mit den illegalen
Rufzeichen… Doch nun Schluss mit der Nostalgie.
Ob wir heute mit einem Freund auf 80 m plaudern oder nach Stunden den
fehlenden Bandpunkt einer DXpedition erobern: Die eine QSL ist der
freund liche Gruß, die andere eine Trophäe wie vor zig Jahren. Dass mit
dem grandiosen LoTW der „Papierkram“ reduziert wurde: schön und gut.
Aber es bleibt dabei, wenn es wirklich darauf ankommt: The final courtesy
of a QSO is the QSL.
Wolf Harranth, OE1WHC
Früher war alles besser – oder doch nicht?
Meine Großmutter sagte oft „früher war alles besser“ und sprach von der
„guten alten Zeit“. Als Jahrgang 1906 erlebte sie allerdings zwei Weltkriege,
so gut waren die „alten Zeiten“ also sicher doch nicht.
Auf den DX-Verkehr im Kurzwellenbereich bezogen, ist die jetzige Zeit
zumindest extrem spannend: Computer sowie Internet sind heute auch
im Amateurfunk nicht mehr wegzudenken und erleichtern uns das Hobby
ungemein.
Wer führt noch sein Logbuch in Papierform oder hat das DX-Cluster nicht
mitlaufen? Größere DXpeditionen stellen oft ihr aktuelles Log in Echtzeit
oder zumindest einmal täglich ins Netz. QSL-Karten lassen sich bequem
mittels OQRS und Clublog oder anderer Systeme anfordern, etliche Diplome
beantragt man heute online.
Wohl so mancher DX-Aktive hätte ohne Logbook of the World seine Funk-
verbindungen niemals für das DXCC-Diplomprogramm eingereicht. Digitale
Sendearten wie PSK sowie insbesondere WSJT ermöglichen es, selbst mit
geringer Sendeleistung und/oder bescheidenen Antennen auf Kurzwelle
erfolgreich zu sein.
Das DX-Hobby war niemals einfacher als jetzt – und gleichzeitig wohl niemals
schwieriger. Vollautomatische Endstufen, neuartige innovative Antennen-
systeme, Funkgeräte mit dank SDR-Technologie nie da gewesenen Funktionen
stehen uns ebenso zur Verfügung wie die Option, eine komplette Station per
Internet fernzusteuern.
Nicht zu vergessen die Erleichterungen durch den Einsatz von Antennen-
analysatoren und sonstigen Messwerkzeugen, die wir heute dank der tech-
nischen Entwicklung zu günstigen Preisen bekommen.
Dies sind nur einige der vielfältigen Möglichkeiten, die früher so einfach nicht
bestanden und uns Funkamateure quasi in eine neue Ära versetzt haben.
Doch wo Licht ist, gibt es bekanntlich ebenso Schatten. Die Umgangsformen
werden rauer, auch auf den Bändern. Die technische Aufrüstung ist bei einigen
Funkamateuren in vollem Gange. Egoismus bei der DX-Jagd nimmt zu, so zu
beobachten bei fast jeder größeren DXpedition.
Da kann es schon einmal vorkommen, dass bewusst Rufzeichenmissbrauch
beim Betrieb von Remote-Stationen begangen wird, um sicher ins Log der
DXpedition zu kommen. Denn die Welt würde ja einstürzen, wenn man diesen
einen Bandslot verpasst!
Ebenso kann es vorkommen, dass die gesetzlichen Leistungsgrenzen nicht
nur geringfügig überschritten werden und so manche Funkfreunde sich
gegenseitig − wieder durch bewussten Rufzeichenmissbrauch − beim „Band-
slotting“ unterstützen. Denn ein oberster Platz in den Ranglisten von Clublog
ist schließlich unbezahlbar.
Gier und Neid sind nur allzu menschliche Eigenschaften, denen auch der eine
oder andere Funkamateur gelegentlich erliegt. Dagegen helfen selbst der
„DX Code of Conduct“ und die Schaffung von neuen Begriffen wie DQRM
leider wenig.
Hatte meine Großmutter also doch recht und waren die Zeiten früher wirklich
besser? Vielleicht; auf jeden Fall waren sie anders. Genau so anders, wie sie
in zehn Jahren anders sein werden.
Es liegt an uns, ob die Zeiten besser werden oder nicht. Zudem bleibt es abzu-
warten, ob sich das Zitat von Sir Peter Ustinov bewahrheitet: „Jetzt sind die
guten alten Zeiten, nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen.“
Hannes Gruensteidl, OE3SGU
Bausätze und Ersatzteile
Der Selbstbau von Geräten oder Baugruppen der Elektronik und Funktechnik
ist ein wichtiger Teil unseres Hobbys. Es macht nicht nur Spaß, sondern
vermittelt zudem praktische Erfahrungen und Fachkompetenz.
Als FA-Leserservice fördern wir dies mit unserem Angebot an Bauelementen
sowie Bausätzen und die positiven Reaktionen unserer Leser und Kunden
bestärken uns darin, diesen Weg fortzusetzen.
Bausatzgeräte bieten übrigens neben der Freude am Löten und Schrauben
noch einen weiteren Vorteil gegenüber fertigen „Steckdosengeräten“, der
oft erst auf den zweiten Blick sichtbar wird: Sie sind durch die mitgelieferte
Bauanleitung gut dokumentiert. Spätestens dann, wenn einmal etwas nicht
(mehr) funktioniert, lernt man dies zu schätzen.
Schaltplan sowie Montage- und ggf. Abgleichanleitung machen nicht nur
Aufbau und Funktion transparent, sondern bieten außerdem eine gute Grund-
lage für qualifizierte Fehlersuche und Reparatur. Der sachkundige Funk-
amateur oder Hobbyelektroniker kann somit die Instandsetzung in Eigenregie
durchführen. Das spart nicht nur Zeit und Geld, sondern bringt oft auch den
einen oder anderen Erkenntnisgewinn.
Auf die Nachfrage nach Ersatzteilen sind wir als Bausatzanbieter eingestellt.
Wir halten eine gewisse Menge an Spezialteilen als Reserve vor oder können
diese in überschaubarer Zeit beschaffen.
Nun ist es der Gang der Dinge, dass der eine oder andere Bausatz „in die
Jahre“ kommt: Die Nachfrage danach sinkt, ein wesentliches Teil ist nicht
mehr beschaffbar oder ein Nachfolgebausatz wurde aufgelegt. Dies ist für
uns dann der Moment, den „betagten“ Bausatz aus dem Angebot zu nehmen.
Wir sehen uns aber auch danach noch in der Pflicht, eine gewisse Zeit lang
Ersatzteile vorzuhalten und Reparaturservice anzubieten. Nicht zuletzt aus
ökonomischen Gründen endet jedoch selbst diese Phase spätestens dann,
wenn wir Platz für neue Bausätze benötigen.
Geht es um Ersatzteile, gibt es bislang nur den Weg der konkreten Anfrage
bei uns. So erreichen uns immer wieder Zuschriften von Funkamateuren und
Bastlern, die ihren vor vielen Jahren gekauften FA-Bausatz zwar gern wieder
auf Vordermann bringen möchten, jedoch das passende Teil im Fachhandel
nicht (mehr) bekommen. Daher haben wir uns entschlossen, in unserem
Online-Shop eine entsprechend benannte neue Rubrik einzurichten und
Schritt für Schritt auszubauen. Dort sind dann Spezialteile von aktuellen
sowie von jenen Bausätzen zu finden, die wir nicht mehr im Sortiment haben
und deren Reparatur wir daher nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr
anbieten können. Soweit noch vorhanden, werden Gehäuseteile ebenfalls
dazugehören.
Selbstverständlich gilt das jeweilige Angebot, solange der Vorrat reicht, bei
einigen Artikeln wird es sich nur noch um wenige Einzelstücke handeln.
Wir kommen damit auch denjenigen entgegen, die ihren FA-Bausatz noch
möglichst lange nutzen und deshalb ein bestimmtes „Verschleißteil“ vorsichts-
halber in der Schublade haben möchten.
Ganz nebenbei fördern wir damit einen weiteren Aspekt des Selbstbaus, denn
die Reparatur ist oft mindestens ebenso anspruchsvoll wie der Aufbau eines
neuen Geräts.
Peter Schmücking, DL7JSP
FUNKAMATEUR-Leserservice
Gedanken zum Jahreswechsel
Das nunmehr vorliegende Heft 1 ist mir Anlass, über die zwölf FA-Ausgaben
des Jahres 2016 zu resümieren. Als Chefredakteur hoffe ich, dass meine
Kollegen und ich Ihnen wieder eine geglückte Themenauswahl präsentieren
konnten.
Die wachsende Vielfalt an Themen, die den Amateurfunk betreffen, verlangt von
uns einen schwierigen Spagat. So wollen wir Neueinsteigern Verständliches
bieten und alte Hasen nicht langweilen. Ferner muss leichte Kost hin und
wieder mit Anspruchsvollem garniert werden. Traditionelle Technik wollen wir
nicht vernachlässigen, auch wenn der Trend zum Digitalen unverkennbar ist.
Dessen nicht genug, sind wir − wie der Titel der Zeitschrift eher nicht, wohl
aber der Untertitel verlauten lässt − zudem Lesern gegenüber in der Pflicht,
die lediglich allgemein an Funk bzw. Hobbyelektronik interessiert sind und
mit Hardcore-Amateurfunk wenig am Hut haben. Wer sich über die Garagentür-
Fernsteuerung, das PMR-Funkgerät oder die BC-DX-Seiten ärgert, möge
dies bitte in seine Überlegungen einbeziehen.
So wird nicht jeder alles lesenswert finden, übers Jahr hinweg sollten jedoch
die meisten zu ihrem Recht gekommen sein. Das Gesamtbild ergibt sich noch
besser beim Blick in mehrere Jahrgänge.
Um Ihnen diesen von Autoren und Redakteuren über viele Jahre zusammen-
getragenen Wissensschatz bequem zugänglich zu machen, unterstützen wir
Sie in vielfältiger Weise. Für die schnelle Suche nach Stichwörtern in den
Überschriften sei an die auf unserer Website unter Downloads/Archiv zugäng-
liche Suchmaschine erinnert.
Einzelne Beiträge sind jedoch − zumindest bisher − erst über die Jahrgangs-
CDs verfügbar, die es inzwischen bis 1990 zurück gibt. Ich kann Sie nur immer
wieder ermuntern, wenigstens die Jahrgangs-PDFs aus den vorhandenen
CDs auf Ihrem PC, Tablet oder gar Smartphone zu speichern. Eine Volltext-
suche nach Stichworten über mehrere Jahre hinweg, also nach jedem beliebigen
einmal gedruckten Wort, ist dann nämlich sehr einfach.
Außerdem gehen wir zunehmend dazu über, Inhalte zusätzlich per Internet
verfügbar zu machen. Begonnen haben wir mit über 400 Testberichten aus
dem FUNKAMATEUR und der „funk“, die jeweils für ein geringes Entgelt im
PDF-Download-Shop zu haben sind. Dabei geht es nicht nur um Funkgeräte,
sondern ebenso um Antennen, Zubehör und Software.
Hingewiesen sei ferner auf den frei zugänglichen Download-Bereich auf
www.funkamateur.de, in dem zu jeder einzelnen Ausgabe zahlreiche Ergän-
zungen zu den gedruckten Beiträgen untergebracht sind − über die Jahre
hinweg eine ansehnliche Sammlung. Die betreffenden Dateien sind außerdem
Bestandteil der Jahrgangs-CD − eingeordnet unter Zugaben.
In diesem Sinne dürfen Sie sich auf ein spannendes neues Jahr mit dem
FUNKAMATEUR in gedruckter Form sowie mit digitalen Ergänzungen freuen.
Dies wird uns jedoch nur durch die Mithilfe derjenigen unter Ihnen, die hin und
wieder selbst „zur Feder“ greifen, möglich sein – angefangen von der zwei-
zeiligen Kritik per E-Mail bis hin zu mehrseitigen Fachbeiträgen.
An dieser Stelle daher ein herzliches Dankeschön an alle Macher und Mit-
macher sowie nicht zuletzt an unsere emsigen ständigen freien Mitarbeiter −
und ebenso natürlich an Sie, liebe Leser!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Ich weiß, dass ich nichts weiß
Dieser demütige Satz stammt vom Philosophen Sokrates und wurde von
Platon, einem seiner Schüler, für die Nachwelt festgehalten. An solcher
Bescheidenheit mangelt es in der Moderne in vielen Bereichen, zumal diese
Tugend heute für den persönlichen Erfolg nicht immer zuträglich ist.
Sokrates’ Erkenntnis kam mir in den Sinn, als ich das Auswendiglernen eines
Newcomers beobachtete, der sich mithilfe dieser Methode auf die Erlangung
der „großen“ Amateurfunkgenehmigung vorbereitete. Wohlgemerkt, es
geht mir hier um den überhöhten Anspruch des Fragenkatalogs Teil A zur
Technik, der eigentlich jeden selbstkritischen Laien davon abhalten müsste,
sich ernsthaft mit dem Gedanken zum Vorstoß in die höhere Zeugnisklasse
zu befassen.
Sind diese Fragen von professionellen Nachrichtentechnikern zusammen-
gestellt worden, die schlichtweg vergessen haben, dass es nicht um das
richtige Kreuz bei A, B, C oder D in diesem zweifelhaften Multiple-Choice-
Verfahren geht, sondern um den Nachweis des Verständnisses der jeweiligen
Aussage?
Es überfordert meine Vorstellung, dass das Auswendiglernen der richtigen
Antworten zum Techniktest auch nur annähernd zu einem Transfer der dort
abgefragten Kenntnisse führt. Transfer bedeutet hierbei, dass Erlerntes als
Werkzeug zur Erschließung neuer eigener Ideen und Vorhaben führt.
Dies war doch aber die Grundidee des Amateurfunks, der der einzige Funk-
„Dienst“ ist, bei dem der Teilnehmer selbst als Experimentator tätig wird.
Es kann demnach nicht sein, dass der angehende Funkamateur, wie inzwi-
schen bei vielen anderen Prüfungen ebenfalls, am Tage des Tests auf dem
Zenit seines Wissens ist und sein vermeintliches Technikverständnis an-
schließend wieder verkümmern lässt.
Man muss allerdings kein Nestbeschmutzer sein, um zuzugeben, dass das
Verständnis der hochkomplexen Technik heutiger industriell hergestellter
Amateurfunkgeräte die meisten Anwender überfordert und der Ausdruck
„Steckdosenamateur“ in seinem negativen Sinne inzwischen anachronistisch
ist. Daher ist es nicht mehr zeitgemäß, zu fordern, dass der Nutzer jener
Geräte diese bis ins Detail verstehen oder gar reparieren können muss.
Der ursprüngliche Selbstbau wird sich bei der Masse der Funkamateure
inzwischen wohl eher auf beherrschbare Zusatzgeräte und Antennen er-
strecken.
Das Interessenfeld junger Leute, wenn sie denn überhaupt technikaffin sind,
erstreckt sich heute mehr in den Bereich der Computertechnik. Soll der
Amateurfunk weiterhin erhalten bleiben, dann muss man den Zugang zeit-
gemäß öffnen und vor allem überzogene, sogar aus der Sicht erfahrener
Amateure nicht mehr nachvollziehbare Forderungen an das Technikwissen
abbauen. Fachkompetenz erwirbt man erst durch vielfältige Erfahrung.
Die Prüfung selbst ist lediglich der Einstieg in den Amateurfunk.
Zudem ist der Charakter eines Funkamateurs nicht nur durch seine beson-
deren Fachkenntnisse zu beschreiben, sondern auch durch sein vorzeigbares
Betriebsverhalten. Gerade dieser Aspekt scheint im gegenwärtigen Multiple-
Choice-Verfahren völlig außer Acht gelassen zu sein.
Die auf der Ham Radio 2016 erkennbar gewordenen Bemühungen des Runden
Tisches Amateurfunk um Einflussnahme auf das geplante neue Amateurfunk-
gesetz sind in dieser Hinsicht ausdrücklich zu begrüßen.
Hans-Joachim Pietsch, DJ6HP
Neues EMVG: ein Armutszeugnis
„Der Berg kreißte und gebar eine Maus.“ Dem römischen Dichter Horaz ent-
lehnt, könnte man so etwas flapsig die am 28. September 2016 vom Bundestag
verabschiedete Neufassung des „Gesetzes über die Elektro magnetische
Verträglichkeit“ kommentieren.
Die Bundesnetzagentur ist demnach weiterhin nicht verpflichtet, bei Funk-
störungen für Abhilfe zu sorgen. Einen verbindlichen und umfassenden
Funk schutz gibt es jetzt nur noch für Sicherheitsfunkdienste wie die von
Polizei und Feuerwehr.
„Normalbürger“, sprich alle Radiohörer sowie Fernsehzuschauer haben
ebenso wie wir Funkamateure das Nachsehen und müssen sich künftig mit
der „Verhältnismäßigkeit der Mittel“ bei der Störbeseitigung zufriedengeben.
Soll heißen: Die „Interessen“ beim Betrieb von störenden Betriebsmitteln,
darunter PLC, LED-Lampen oder Schaltnetzteilen, werden gegen das Recht
auf störfreien Empfang abgewogen.
Damit hat „die Politik“ vor einer immer weiter um sich greifenden Verschmut-
zung des elektromagnetischen Spektrums kapituliert. Anstatt endlich durch-
zugreifen, weicht man das Gesetz weiter auf.
Bemerkenswert sind zudem die Vorgänge im Vorfeld: Das zuständige Bundes-
ministerium für Verkehr bat vergangenes Jahr offiziell alle Interessenverbände
um Stellungnahmen. Der „Runde Tisch Amateurfunk“ (RTA) gab sich alle nur
erdenkliche Mühe und kommentierte detailliert − so wie ich meine − äußerst
professionell die entscheidenden Schwachpunkte der Novellierung.
Monatelang folgten umfangreiche Stellungnahmen von HF-Experten, Ge-
spräche mit Fraktionen, Abgeordneten und Berichterstattern, etliche Briefe
hochrangiger Wissenschaftler und eine Petition engagierter Funkamateure.
Doch war alle Mühe umsonst: In der maßgeblichen Sitzung des Wirtschafts-
ausschusses wurden alle Änderungsvorschläge und Eingaben schlicht
ignoriert, ja noch nicht einmal angesprochen. Anträge aus der Opposition
zu gunsten einer Anhörung hierzu im Bundestag wurden von den Regierungs-
parteien überstimmt.
Dies alles wirft Fragen darüber auf, wie unser Gesetzgeber eigentlich vorgeht
und warum das Interesse der Bevölkerung am Schutz einer natürlichen
Ressource mit Füßen getreten wird. Ist es Unwissenheit, Ignoranz oder etwa
die Lobbyarbeit der Wirtschaft, die ihren „HF-Schrott“ weiterhin ungehindert
verkaufen will?
In jedem Fall ist diese Entwicklung eine Ohrfeige für alle diejenigen, die sich
hier mit großem Engagement eingebracht haben und ein Armutszeugnis für
unsere politischen Entscheidungsträger.
Dabei erscheint es absehbar, dass das neue EMVG gegen übergeordnetes
europäisches Recht verstößt. So definiert der „Erwägungsgrund Nr. 4“ der
maßgeblichen EU-Richtlinie 2014/30/EU ganz klar und eindeutig, dass für alle
Funkdienste sowie alle technischen Betriebsmittel gleichrangiger und bedin-
gungsloser Funkschutz vorzusehen ist. In der nun vorliegenden Überführung
in nationales Recht durch den Beschluss des Bundestags findet sich nichts
dergleichen.
Möglicherweise haben nun die Juristen und Gerichte das Wort, wie so oft
müssen sie dann die Versäumnisse der Politik korrigieren. Der RTA jedenfalls
erwägt, wie bereits durch eine Pressemeldung bekannt, entsprechende
Schritte. Mehr dazu auch auf S. 1096.
Rainer Englert, DF2NU
Engagement für den Zivilschutz
Öffentliche Aufregung bewirkte kürzlich ein überarbeiteter Notfallplan zum
Schutz der Bevölkerung, betitelt „Konzeption Zivile Verteidigung“ (KZV),
des Bundesministeriums des Innern (BMI). Besonders die Empfehlung, einen
privaten Vorrat an Nahrungsmitteln anzulegen, sorgte unter der Überschrift
„Hamsterkäufe“ für Schlagzeilen − obwohl eine solche Empfehlung bereits
seit Jahrzehnten besteht und davon kaum jemand Notiz nahm.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière beeilte sich zu betonen, dass dies
keineswegs die Reaktion auf eine konkrete aktuelle Bedrohungslage sei.
Vielmehr gehe es um die Vorsorge für den Katastrophenfall sowie „um die
Fortschreibung und Anpassung an veränderte sicherheitspolitische sowie
technologische Bedingungen.“
Derzeit, so im KZV formuliert, stütze sich ein Großteil des ehrenamtlichen
Enga gements im Zivil- und Katastrophenschutz auf öffentliche Einrichtungen
und private Organisationen. Gemeint sind ausgebildete Helferinnen und
Helfer etwa im Technischen Hilfswerk (THW), in freiwilligen Feuerwehren
sowie in den großen Hilfsorganisationen.
Durch das steigende Durchschnittsalter sei ein künftiger Rückgang der
verfügbaren freiwilligen Einsatzkräfte und damit der Leistungsfähigkeit des
ehrenamtlich getragenen Systems nicht auszuschließen. Daher solle die
Bevölkerung künftig auch außerhalb der genannten Organisationen vermehrt
einbezogen und für das Thema sensibilisiert werden.
Für den Zivilschutz werde möglichst die auch sonst von Behörden genutzte
Infrastruktur zur Krisenbewältigung eingesetzt und der Aufbau von Doppel-
strukturen vermieden. Der anschließende Satz lässt aber aufmerken: „Auf der
anderen Seite ist eine Rückfallorganisation für die Krise mit ausreichenden
Redundanzen (z. B. autarke Kommunikationsmittel) vorzuhalten.“ Fallen also
die etablierten Funknetze der Behörden und Hilfsorganisationen aus, sollen
Alternativen zum Einsatz kommen.
Im BMI-Dokument wird in diesem Zusammenhang das THW erwähnt: Diese
Bundesorganisation ist deutschlandweit flexibel einsetzbar und soll zur Füh-
rungsunterstützung bei Bedarf temporäre IT- und Telekommunikationssysteme
einrichten und betreiben. Die berichtete Übergabe professioneller Kurzwellen-
Funkanlagen an THW-Standorte mag damit zusammenhängen.
Ein eigenes Funknetz, das bereits vorhanden ist und im Krisenfall nicht erst
aufzubauen wäre, halten bekanntlich wir Funkamateure vor. Das Netz analoger
und digitaler Umsetzer erreicht einen Großteil der Fläche Deutschlands und
ist das Ergebnis ehrenamtlichen Engagements technikbegeisterter Tüftler.
Mit dem HAMNET verfügen wir sogar über eine zunehmend leistungsfähige
Alternative zum Internet, deren Aufbau gute Fortschritte macht. Hier gilt es
jetzt, diese Unabhängigkeit durch Notstromversorgung und Ergänzung bislang
fehlender Funkstrecken noch konsequenter voranzutreiben.
Hinzu kommen unsere netzunabhängigen Möglichkeiten, vor Ort Nachrichten
zu übertragen: Funkamateuren reichen oft bereits ein Handfunkgerät sowie
praktizierte Betriebstechnik, um innerhalb einer Stadt ausgefallene Kommuni-
kationsverbindungen zu ersetzen und damit auf Anforderung die Hilfsdienste
effektiv zu unterstützen.
Das vom Bund erwünschte Bürgerengagement für den Zivilschutz können wir
dank unserer Kenntnisse und Aktivitäten als Funkamateure also längst erfüllen.
Vor diesem Hintergrund sollten wir uns und unsere Möglichkeiten noch mehr
bekannt machen − auch vor Ort bei den zuständigen Ansprechpartnern in der
Verwaltung unserer Stadt.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Verschlüsselung bei E-Mails
Vor dem Aufkommen der E-Mail wurden Nachrichten als Brief oder Telegramm
übermittelt. Später kamen die ersten digitalen Übertragungsverfahren hinzu:
Teletex und Telefax. Ende der 1980er-Jahre begann dann der Erfolgsweg der
E-Mail.
Ray Tomlinson, der Erfinder der heutigen E-Mail, hätte es sich vor nunmehr fast
45 Jahren bestimmt nicht träumen lassen, welche Verbreitung seine Variante
des Austauschs von Botschaften über ein Rechnernetz erlangen würde. Das
genutzte Verfahren entstand aus der Anpassung eines bereits bestehenden
Programms, welches schon seit den frühen 1960er-Jahren das Hinzufügen
von Texten zu den Nachrichten einer nur vom Nutzer auslesbaren Mailbox
ermöglichte.
Eine nicht so kleine Einschränkung gab es damals jedoch: Die Adressaten
mussten denselben oder direkt miteinander verbundene Rechner nutzen −
und das waren in der Regel nur die Wissenschaftler, die mit den damals
üblichen Großrechnern arbeiteten.
Laut Tomlinson war daher die erste Anwendung eine Nachricht an seine
Kollegen im Forschungsunternehmen Bolt, Beranek and Newman (BBN),
in der er Ende 1971 mitteilte, dass man nun Nachrichten übers Netzwerk
senden konnte, indem man dem Benutzernamen des Adressaten das
@-Zeichen und den Hostnamen des Computers anfügte.
Im elektronischen Zeitalter eine relativ lange Zeit wurden daher Nachrichten
nur via Mailbox-Systemen, X.25, Novell, BTX usw. übertragen. Erst Mitte
der 1990er verdrängte die heutige E-Mail durch die starke Verbreitung des
Internets diese Systeme. Heute werden E-Mails meist per SMTP, zu Deutsch
etwa „Einfaches E-Mail-Transportprotokoll“, verschickt. Zum Abrufen der
E-Mails vom Zielserver existieren verschiedene Abrufmöglichkeiten, etwa
das POP3- oder IMAP-Protokoll oder Webmail.
Im Großen und Ganzen hat sich selbst über Jahrzehnte hinweg die E-Mail-
Form aber kaum verändert, auch wenn nun Formatierungen und Anhänge
möglich sind.
Jeder Rechnerknoten, der die Nachricht weiterleitet, wertet die Kopfzeilen
aus und fügt entsprechend seiner Aktion eigene hinzu. Doch wer Zugriff
auf die Knoten hat, kann auch den Inhalt samt Anhängen mitlesen. Das ist
vergleichbar mit einer Postkarte aus Papier, die der Postbote auch unbeab-
sichtigt überfliegen könnte. E-Mails mit gefälschten Inhalten oder Absendern
in Umlauf zu bringen, ist relativ einfach. Wenn ein nicht aufmerksamer Emp-
fänger entsprechend präparierte Anhänge öffnet, lassen sich bei ihm zum
Beispiel Passwörter ausspähen – wir haben schon mehrfach im FA auf Viren
und Würmer in E-Mails hingewiesen.
Nicht erst seit dem Bekanntwerden der Tätigkeitsfelder von Geheimdiensten
existieren Bestrebungen, die Inhalte von E-Mails nicht für jeden einsehbar
zu übertragen. Verschlüsselung ist schon lange das passende Stichwort,
wurde aber nur von den wenigsten genutzt. Zwar bieten erste Provider seit
Kurzem die Möglichkeit an, E-Mails verschlüsselt zu übertragen, doch die
Schlüssel behalten sie selbst. Ab S. 814 zeigen wir, wie selbst Nicht-Spezialisten
mit relativ wenig Aufwand eine sichere Übertragung realisieren können,
sodass die elektronische Postkarte zum elektronischen Einschreibbrief wird
und sich hoffentlich noch viele Jahre einer großen Beliebtheit erfreut.
Ingo Meyer, DK3RED
Intelligenz kontrolliert Künstliche Intelligenz
Manchmal habe ich den Eindruck, als würden sich Science-Fiction und Realität
einander unaufhaltsam annähern: Tablet-Computer kannte ich − wenn auch
nicht unter dieser Bezeichnung − schon lange vor deren Siegeszug, selbst
fahrende Autos und andere eigenständig entscheidende Maschinen ebenfalls.
Da behaupte noch jemand, der Konsum von TV-Serien und Actionfilmen sei
grundsätzlich bildungsfern…
Ob sich die Entwickler von Lösungen für die sogenannte Virtuelle Realität,
Künstliche Intelligenz (KI) und Industrie 4.0 ebenfalls bei Autoren von Zukunfts-
romanen die eine oder andere Inspiration geholt haben? Bei Besuchen der
CeBIT und der Hannover Messe drängte sich jedenfalls in diesem Jahr mehr
denn je dieser Eindruck auf.
Dort zu sehen waren etwa Arbeitsanzüge, deren integrierte Sensoren Körper-
haltung sowie Bewegungen seines − menschlichen − Trägers zur Analyse und
anschließender Optimierung an eine Software melden. Roboter der jüngsten
Generation erkennen die für die Produktion relevanten Bauteile, versorgen
ihren eigenen Arbeitsplatz selbst mit dem benötigten Nachschub, können aber
bei Bedarf auch noch eng mit einem menschlichen „Kollegen“ kooperieren.
Und mithilfe von weitreichenden Funksignalen lassen sich Sensorsysteme
zur Steuerung und Automatisierung ganzer Fabriken drahtlos vernetzen. Der
Mensch greift dort allenfalls noch korrigierend ein, wenn einmal etwas nicht
wie gewünscht funktioniert oder ein Defekt auftritt.
Solche sogenannten Smart Factorys, also „denkende Fabriken“, mit autonom
untereinander kommunizierenden Maschinen sind das Ziel von Industrie 4.0.
In diesen Produktionsstätten werden wir Menschen immer weniger gebraucht.
Vergleichbar dem automatischen Börsenhandel, bei dem bereits Maschinen
bzw. Algorithmen und nicht mehr Menschen über Kauf und Verkauf entscheiden
− dies mit rasender Geschwindigkeit, daher die Bezeichnung Hochfrequenzhandel.
Neben der Frage, wie sich das von Forschung und Wirtschaft vorangetriebene
Projekt Industrie 4.0 künftig auf den Arbeitsmarkt auswirkt, wird derzeit die
nach der Sicherheit solcher Systeme gestellt. Etwa vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie, das in einer jüngst veröffentlichten Studie im Zu-
sammenhang mit der zunehmend eigenständigen Gerätekommunikation auf
bestehende Sicherheitslücken und somit Angriffsmöglichkeiten für Hacker
hinweist.
IT-Sicherheit ist demnach eine elementare Voraussetzung für den Erfolg von
Industrie 4.0, doch stehen die Unternehmen den Bedrohungen derzeit noch
orientierungslos gegenüber. Ein technisches Gesamtkonzept oder verbindliche
Standards zum Schutz der vernetzten Industrie fehlen bislang.
Vordenker wie der Astrophysiker Stephen Hawking warnen überdies vor möglichen
negativen Auswirkungen, sollte sich KI künftig schneller weiterentwickeln
als der Mensch selbst und dieser die Kontrolle über sein Werk verlieren.
Ob also die sogenannten Entscheider an den Schaltstellen unserer Gesellschaft
intelligent – im Sinne von weitblickend − genug sind, angesichts einer zunehmend
rasant vorangetriebenen Künstlichen Intelligenz zu unser aller Wohl
die richtigen Entscheidungen zu treffen? Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass
Fehlentwicklungen gegebenenfalls rechtzeitig erkannt werden und sich diese
in Grenzen halten lassen.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Ein Hauch von Olympia an der Elbe
In fast genau zwei Jahren findet die World Radiosport Team Championship
(WRTC) statt − erstmals in Deutschland. Einer fast dreißigjährigen Tradition
folgend, ermitteln Funkamateure unter identischen technischen Startbedin-
gungen die besten Operateure.
Wie zu Olympia treffen sich hierfür im Vierjahresrhythmus Teilnehmer aus aller
Welt in einem Land zum sportlichen Wettkampf − im Amateurfunk kennt man
sich oft nur von den Bändern. Die WRTC ist damit auch ein großes Ham-Fest.
Schon jetzt läuft die weltweite Qualifikation, denn ein Startplatz bei diesen
„olympischen Spielen der Funkamateure“ ist das große Ziel vieler Funksportler.
Als Organisatoren und Helfer sind wir diesmal mittendrin und nicht nur dabei:
Seit über einem Jahr plant der Verein WRTC 2018 e.V. diese Weltmeisterschaft.
Als Verantwortlicher für die Mittelaquisition bin ich vor allem stolz auf die
Spendenbereitschaft deutscher Funkamateure. Viele Individualspender und
Klubs haben schon einen guten Anteil zum benötigten Budget beigetragen.
Zudem hat uns bereits dieses erste Jahr der Vorbereitung international viel
Anerkennung gebracht, wie wir kürzlich während der Hamvention in Dayton
(s. Bericht ab S. 612) von vielen WRTC-Freunden erfahren konnten.
Die Erwartungen sind also hoch und die Unterstützung ist groß. So finden sich
zunehmend weitere Sponsoren auch aus dem kommerziellen Bereich. Nachdem
Frank Dathe und die Box 73 GmbH schon Mitte 2015 ihre unkomplizierte
Unterstützung angeboten haben, sind nun mit Spiderbeam und WiMo weitere
namhafte Unternehmen dabei.
Etwa 63 Teams gehen also am zweiten Juli-Wochenende 2018 in der Region
um Jessen/Wittenberg, gelegen zwischen Elbe und Elster, an den Start.
Damit die Ausrüstung rechtzeitig und zuverlässig verfügbar ist, müssen an
65 Standorten Antennen, Zelte und Aggregate aufgebaut werden. Viele Funk-
amateure haben bereits ihre Hilfe zugesagt, bei diesem wohl größten bislang
in Deutschland zu erlebenden Fieldday-Contest dabei zu sein und die Teil-
nehmer zu unterstützen.
Während des Wettkampfs führen jeweils Zweierteams 24 Stunden lang inten-
sivsten Funkbetrieb durch. Mit zwei Signalen gleichzeitig in der Luft werden
die besten Teilnehmer mit Spiderbeam, Dipol und moderaten 100 W Sender-
ausgangsleistung sicher über 3000 Funkverbindungen in ihre Logs schreiben.
Dafür gilt es, keine Bandöffnung zu verpassen, denn wie in jedem Contest
entscheiden die Multiplikatoren über den Sieg. Den gesamten Funkbetrieb
eines Teams beobachtet jeweils ein Schiedsrichter und nach dem Contest
nimmt ein Auswerteteam die Logs akribisch unter die Lupe, damit neben
Quantität ebenso Qualität garantiert ist. Am Montagabend folgt in einer
feierlichen Zeremonie die Ehrung der neuen Weltmeister des Amateurfunks.
Ich würde mich freuen, dann die deutsche Nationalhymne zu hören.
Doch noch sind wir am Planen, Testen und Lernen. Um uns auf die große
logistische Herausforderung vorzubereiten, veranstalten wir im Juli 2016
einen Testtag: quasi eine Mini-WRTC, bei der etwa 40 Helfer fünf Stationen
in die Luft bringen werden.
Es bleibt viel zu tun, damit wir 2018 ein Sommermärchen für Funkamateure
erleben können. Dafür brauchen wir weitere Unterstützung.
Dr.-Ing. Michael Höding, DL6MHW
Der Bodensee ruft
Bewusst habe ich als Titel für dieses Editorial nicht „Auf zur 41. Ham Radio“
oder dergleichen gewählt. Nehmen Sie sich doch einmal Zeit, den Besuch
auf der Ham Radio als „ganzheitliches Event“ für die gesamte Familie zu
organisieren. Nicht dieses hektische „Freitag-600-km-Autobahn-hin-nach-
Friedrichshafen“ und am Samstag nach dem Flohmarkt wieder ab nach
Hause. Ich habe 2015 meinen Besuch auf der Ham Radio in einen 14-tägigen
Sommerurlaub am Bodensee eingebettet.
Ein tolles Hotel auf der Halbinsel von Wasserburg, auf halber Höhe zwischen
Friedrichshafen und Lindau, endlose Radtouren nach Österreich und in die
Schweiz, Bergwandern in Vorarlberg … Das war sowohl für meine bessere
Hälfte als auch für mich ein entspannender Urlaub. Und so waren denn auch
die drei Tage auf der Ham Radio viel stressfreier und weniger belastend als
in den Jahren zuvor. Glauben Sie mir: Auch dem Familienfrieden ist diese Art
des Messe besuchs bestimmt zuträglich.
Doch nun doch zur Messe selbst. Eine solche Veranstaltung ist eine Summe
von Empfehlungen! Es sind nicht die besonders günstigen Angebote auf der
Messe, es ist die Offerte des kompletten Produktportfolios rund um den
Amateurfunk. Bedenken Sie stets, dass die Händler (Ihres Vertrauens) Ihnen
Ihre Angebote präsentieren. Das hat etwas mit Aufwand und Kosten zu tun.
Wer nur nach besonders „günstigen“ Messeangeboten giert, tut den Anbietern
Unrecht.
Eine weitere Möglichkeit sind die zahlreichen Fachvorträge, die unter dem
organisatorischen Dach des DARC e.V. angeboten werden. Gleich, ob
Antennentechnik, Satellitenfunk, Gesetze und Normen oder DX, es ist für
jeden etwas dabei.
Ich selbst war allerdings im vergangenen Jahr etwas schockiert, als sich zum
Vortrag von Uli Müller, DK4VW (Referat Frequenz management im DARC), nur
zehn (10 !) Zuhörer verirrt hatten. Selten konnte man so viele Informationen
über die komplizierte (Lobby-)Arbeit zum Erhalt und zur Erweiterung unserer
Bänder so konzentriert vorgetragen bekommen wie auf dieser Veranstaltung.
Und Baustellen gibt es genug, wie beispielsweise das 60-m-Band, 6 m, 4 m
und die Harmonisierung des 160-m-Bandes. Die nächste WRC findet 2019
statt, und die Weichen für unsere Frequenz zuweisungen werden jetzt gestellt.
Wen all dies nicht interessiert, ist auf dem Flohmarkt gut aufgehoben. Mein
persönlicher Eindruck 2015 war, dass sich das Angebot an echtem „Schrott“
in Grenzen hielt. Nun gut, der Surplus-Kram in Olivgrün durfte nicht fehlen,
und den werden Sie auch in diesem Jahr wieder vorfinden.
Andererseits werden Sie bei genauerem Hinsehen vielleicht exakt den
Leistungstransistor für wenig Geld finden, der in Ihrer 70-cm-Endstufe beim
vorigen Fieldday abgebrannt ist und den Sie selbst bei Ebay nicht gefunden
haben. Auch beim Besuch des Flohmarkts gilt: Nehmen Sie sich Zeit, um
das Angebot zu studieren. Und jeder Flohmarktanbieter wird es Ihnen danken,
wenn Sie die Verkaufsverhandlungen nicht sofort mit dem ultimativen Wunsch
nach einem Preisnachlass auf einen normalen PL-Stecker beginnen.
Auf Wiedersehen entweder auf der Ham Radio oder dem Bodensee-
Radwanderweg
Peter John, DL7YS
DX-Stiftungen ermöglichen DXpeditionen
Das DXen, also der Funkverkehr mit fernen und seltenen Stationen, ist eine
besonders interessante Facette des Amateurfunks, die sich im Laufe der
Jahre sehr gewandelt hat. Waren wir früher zufrieden, wenn ein neues
Funkziel mit unserem Signal überhaupt erreichbar war − egal auf welchem
Band und in welcher Sendeart − versuchen heute viele DXer, ein DXCC-
Gebiet auf möglichst allen KW-Bändern und in vielen Modi zu arbeiten.
Dabei wird wohl ein Urbedürfnis des Menschen befriedigt, alles zu sammeln
und sich mit anderen zu vergleichen.
Darüber hinaus möchte der DX-Jäger möglichst schnell wissen, ob eine
Funkverbindung tatsächlich geklappt hat, was in der Hektik des Pile-ups
und angesichts der heute oft hohen Störpegel nicht immer so sicher ist.
Solche kurzfristigen Bestätigungen sucht man unter anderem bei Clublog
oder auf den Websites der DXpeditionen.
Diese Entwicklung hat deutliche Auswirkungen: Um das gestiegene Interesse
an QSOs befriedigen zu können, brauchen DXpeditionen sehr viel mehr
Operateure, Geräte und Antennen. Dies bedeutet gleichzeitig einen erheblich
höheren logistischen Aufwand für Anreise und Unterbringung der Personen
sowie für den Transport der Ausrüstung − teilweise bis hin zu gecharterten
Schiffen oder Hubschraubern. Bei entlegenen Regionen, wie zuletzt VK0EK,
muss zudem eine Satellitenverbindung für den Internetzugang zum Einsatz
kommen. Berichte über bedeutende Unternehmungen dieser Art lesen Sie
in fast jeder Ausgabe des FUNKAMATEURs.
Den dafür notwendigen enormen finanziellen Aufwand können die beteiligten
Funkamateure nicht mehr alleine bewältigen − auch wenn diese immer mit
einem hohen persönlichen Beitrag an der DXpedition beteiligt sind. Die von
individuellen Sponsoren oder Spendenbeilagen bei QSL-Anfragen kommenden
finanziellen Mittel sind im Vorfeld schwer kalkulierbar. Für eine solide Planung
braucht man aber eine zuverlässige Abschätzung der Kosten und der Finan-
zierung.
An dieser Stelle kommen die diversen DX-Stiftungen ins Spiel, die auf Anfrage
ihre finanziellen Beiträge im Voraus leisten oder zumindest verbindlich zusagen.
Dies individuell abgestimmt auf das jeweilige Projekt, dessen Durchführung
sowie die zu erwartenden Berichte und Bilder. Je mehr Mitglieder eine solche
Stiftung hat, umso mehr Finanzmittel stehen zur Verfügung und umso deut-
licher kann ihre Unterstützung zum Gelingen einer DXpedition beitragen.
Neben der 1986 gegründeten European DX Foundation, EUDXF, hat fast jedes
europäische Land eine nationale DX-Foundation von nicht überragender Größe.
Zur größten DX-Stiftung in Europa etablierte sich indes die vor 20 Jahren
ins Leben gerufene German DX Foundation mit derzeit über 700 Mitgliedern.
Die GDXF und ihre Mitglieder leisten regelmäßig wichtige Beiträge bei vielen
bedeutenden DXpeditionen.
Lassen Sie uns daher ab S. 422 das Jubiläum dieser Organi sation gemeinsam
mit einem mehrseitigen Beitrag feiern!
Uwe Jäger, DJ9HX
50 Jahre beim FUNKAMATEUR
Beim Erscheinen dieses Editorials bin ich fast 50 Jahre lang ununterbrochen
beim FUNKAMATEUR redaktionell tätig, inzwischen als Senior. Das ist heut-
zutage wohl eine sehr seltene berufliche Linie. Bedingung dazu war selbst-
verständlich die Entwicklung der Zeitschrift selbst.
Die Tätigkeit für den FUNKAMATEUR begann allerdings mit einem gehörigen
Schwenk meiner beruflichen Erwartungen. Nach fast beendetem Studium
der HF-Technik boten (Ost-)Berliner Betriebe zunächst keine interessanten
Tätigkeiten auf diesem oder ähnlichen Gebieten. So wurde ein Preisaus-
schreiben im ersten Elektronischen Jahrbuch von 1965 zum unerwarteten
Wendepunkt: Eine fehlerbehaftete Schaltung war zu korrigieren und ihr Zweck
zu nennen (s. Preisfrage in dieser Ausgabe auf S. 307).
Ich gehörte zu den wenigen Einsendern mit vollständiger Lösung und durfte
den 1. Preis im Verlag abholen. Da saß dann der Herausgeber des „Eljabu“
und verantwortliche Redakteur des FUNKAMATEURs, Karl-Heinz Schubert,
DM2AXE. Ein Wort gab das andere und plötzlich eröffnete sich mir eine ganz
neue Perspektive: seit 1958 Funkamateur − nun diese Begeisterung in den
Beruf einzubringen zu können. Da gab es nicht viel zu überlegen. Wenig
später, am 1. April 1966, saß ich auf meinem Technik-Redakteursstuhl.
Die Arbeit begann mit Röhrentechnik, fast nur Amateurfunk, mit Tusche auf
Transparentpapier gezeichneten Schaltbildern, mit Schreibmaschine oft
mehrfach getippten Manuskripten, Bleisatz in schwarz/weiß, Handretusche,
geätzten Klischees, endlosen Herstellungszeiträumen, unzuverlässigem Telefon,
ausschließlich Briefpost sowie einer Betonung vorgegebener politischer Ziel-
setzungen, was andererseits recht viel Freiheit im fachlichen Bereich erlaubte.
Mit der Zeit verbreiterte sich nicht nur unsere Thematik, sondern der
Amateurfunk selbst erhielt unzählige neue Facetten. Wer sich über den
Werdegang unserer Zeitschrift ausführlich informieren möchte, findet auf
www.funkamateur.de → Über uns → Zeitschrift entsprechende Links.
So wurde es nie langweilig, dafür aber oft genug stressig. Insbesondere
in der Wendezeit, als die Zukunft des FA über Jahre hinaus ungewiss schien.
Und es galt stets, sich neues Wissen anzueignen − auf der inhaltlichen Seite
wie auf der redaktions-technologischen.
Mein Rufzeichen änderte sich von DM2BTO über Y22TO und DL7UUU in
mittlerweile mehr als 20 Jahren DJ1TO; das unserer Klubstation von DM0FA
über Y63Z auf DF0FA. Eines aber änderte sich nie: Urlaubszeit war immer
irgendwie vor- und nachzuarbeiten, denn Terminpläne der jeweiligen Druckerei
standen und stehen stets als ehernes Gesetz – und so war ich wohl nie länger
als 14 Tage zusammenhängend in Urlaub.
Inzwischen bin ich im Rentenalter, aber seit Jahren weiter für den FUNK-
AMATEUR tätig – wenn auch am Redaktionsort nur noch zwei Tage im Monat.
Dazu kommen Gerätetests und ein reger E-Mail-Verkehr. Zudem erscheint
auf dem Display meines Telefons immer wieder ein Kopf aus der Redaktion.
Schließlich firmiere ich ja im Impressum unter Fachberatung.
Und es macht immer noch Spaß. Mal schauen, wie lange ich Ihnen und
meinen Kollegen noch erhalten bleibe…
Bernd Petermann, DJ1TO
Fürs Pile-up zu unerfahren?
Mit VP8STI und VP8SGI ist eine grandiose DXpedition zu Ende gegangen.
Die 14 Teilnehmer tätigten insgesamt 137 500 Verbindungen und wir dürfen
noch auf ein paar weitere von den Falkland-Inseln unter VP8IDX hoffen.
Das Team war bestens ausgerüstet und die Funkstrecke ist für Mitteleuropa
sehr günstig, sodass selbst Stationen mit 100 W und Drahtantennen insbe-
sondere auf den beiden oberen WARC-Bändern Chancen hatten, ins Log
zu kommen.
Dementsprechend groß war der Andrang von deutschen Stationen, doch
leider glänzten auch sie nicht immer mit vorbildlichem Auftreten. Dabei
meine ich ausdrücklich nicht albernes bis rüpelhaftes Benehmen, wie es
bereits Wolf Harranth, OE1WHC, seinerzeit bezüglich PT0S und K1N an
dieser Stelle thematisierte.
Vielmehr geht es mir um fehlendes betriebstechnisches Können im Allge-
meinen: Es gibt unzählige Stationen, die gar nicht merken, dass die DX-
Station längst selbst sendet, sondern unentwegt weiterrufen.
Eine zweite Erscheinung ist, dass der DXpeditionär eine einmal herausge-
fischte Station deutlich mehr als zweimal anrufen muss, bis derjenige über-
haupt merkt, dass er längst an der Reihe ist. Beides fiel nicht nur mir in
jüngster Zeit häufiger auf − und nicht allein bei VP8.
Was zusätzlich Zeit kostet: wenn man dran ist und die DX-Station das eigene
Rufzeichen richtig aufgenommen hat, dieses nochmals zu wiederholen
und statt „5nn tu“ etwa „cfm 599 5nn tu 73 gl“ oder noch ausführlicher zu
antworten!
Nun ist es mir in Einzelfällen selbst schon passiert, dass ich mein Rufzeichen
einmal zu viel morste oder ein zweites Mal aufgerufen werden musste −
und es war mir peinlich. Wenn die DX-Station erst nach einer gewissen Zeit
jemanden herausgefischt hat, ist solches Doppeln ohnehin durchaus möglich.
Doch die Häufigkeit, mit der dies jetzt auftritt, gibt arg zu denken. Dieses
Editorial bezieht sich zwar vordergründig auf Telegrafiebetrieb, aber bei Tele-
fonie gibt es ähnliches Verhalten.
Man muss sich einmal vor Augen halten, dass diese 14 DX-Enthusiasten nicht
nur jeweils einen fünfstelligen Dollarbetrag investiert haben und über sechs
Wochen von ihrer Familie getrennt sind. Obendrein nehmen sie enorme
Strapazen unter widrigsten Witterungsbedingungen auf sich und riskieren
sogar Leib und Leben.
Auf der anderen Seite wird einfach darauf losgefunkt, als ob „nur“ OH0 oder
SV9 zu arbeiten wäre. Dabei ist die Pile-up-Situation bei einer Nummer 3 oder
8 auf der Most-wanted-DXCC-Liste eben eine ganz andere. Da helfen weder
Beam noch PA, wenn es an Wissen und Können mangelt.
Das kann man erlernen, doch dies geht nur Schritt für Schritt. Wer dagegen
ohne entsprechendes Training bei so einem Extrem-Pile-up einfach irgendwie
mitruft, muss sich darüber im Klaren sein, dass er möglicherweise nicht nur
sich selbst, sondern dazu Tausende fähiger deutscher Funkamateure gleich
mit blamiert…
Mit den Expertentipps vom K1N-Teilnehmer W0GJ in der Juniausgabe 2015
oder den durchaus tiefsinnigen „Regeln“ zum Arbeiten von DX im November
des Vorjahres hatten wir nützliche Hinweise in geballter Form gegeben,
weitere werden folgen. Allerdings müssten dies auch die Richtigen lesen
und befolgen…
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
HAMNET − Lizenz zum Selbermachen
Die Eltern des HAMNET sind geeignete handelsübliche WLAN-Komponenten
und der Forschergeist einiger Funkamateure, die in der Anwendung dieser
Technik eine Herausforderung sahen. Die ersten „Schreie dieses Babys“ sind
mittlerweile rund zehn Jahre her. Es ist erstaunlich, was in dieser Zeit alles
entstand. Mein Kompliment an die Macher.
Allerdings konzentrieren sich die HAMNET-Aktivitäten immer noch überwiegend
auf die Infrastruktur. Entsprechend sehen die meisten Veröffentlichungen,
in denen der Begriff auftaucht, etwa so aus: Relais per HAMNET verbunden,
HAMNET-Linkstrecke von DB0ABC nach DB0XYZ eröffnet. Damit spricht
man aber nur eine recht kleine Gruppe von Funkamateuren an, nämlich die
HAMNET-Macher selbst. Diese sind noch auf Jahre hinaus damit beschäftigt,
eine flächendeckende technische Infrastruktur für das eigene Datennetz der
Funk amateure aufzubauen.
Der FUNKAMATEUR versucht seit einigen Monaten, zusätzlich neue Gruppen
von Interessenten an das Thema heranzuführen: Funkamateure, die das HAM-
NET vorzugsweise als ein verfügbares, vom Internet unabhängiges Datennetz
begreifen und damit völlig neue Ideen verwirklichen. Denn dieses zeitgemäße
Datenfunksystem ist deutlich mehr als nur ein schnelleres Packet-Radio-Netz.
Unsere Zeitschrift möchte auch das Bewusstsein verbreiten, dass man in
diesem Funkbereich schon mit geringem Aufwand oder selbst unter bislang
ungünstigen Standortbedingungen etwas erreichen kann. Das beginnt bei
der Erkenntnis, dass ein HAMNET-Zugang nur recht wenige Antennen- und
EMV-Probleme aufwirft – die optische Sicht zum Zugangspunkt oder einen
VPN-Zugang über das Internet einmal vorausgesetzt.
Zudem kann das HAMNET den Amateurfunk näher an die audiovisuelle Welt
heranführen. So gibt es bereits Videoserver, die ATV-Relais ins HAMNET
„verlängern“ oder ganz ersetzen. Jeden Morgen um 8 Uhr ist auf dieser Basis
eine ATV-Morgenrunde aktiv, an der man nicht nur von Norddeutschland aus
teilnehmen kann.
Lösungen, um Kurzwellentransceiver über das Internet zu steuern, gibt es
schon länger. Es wäre aber noch eine lohnende Aufgabe, die entsprechende
Steuersoftware für die kurzen Reaktionszeiten im HAMNET zu optimieren.
Dieser Tage erreichte ich über ein Dutzend Zwischenstationen durchschnitt-
liche Ping-Zeiten von 40 ms (DB0TVM–DF0LBG); lokal geht das noch deutlich
schneller. In diesem Zusammenhang werden sich Contest-Veranstalter wohl
künftig vermehrt Gedanken darüber machen müssen, wie weit abgesetzte
Empfänger vom Standort der teilnehmenden Station entfernt sein dürfen.
Die HAMNET-Technik hat ebenfalls großes Potenzial im Notfunkbereich: Wir
können ein universell kompatibles Übertragungsmedium mit großer Bandbreite
anbieten. Vielleicht würde uns das so manche Tür bei Hilfsdiensten oder Feuer-
wehren öffnen − und wenn wir nur einen Schlauch-Trockenturm als HAMNET-
Standort nutzen dürfen.
Einen weiteren Schub könnte das HAMNET durch Benutzerzugänge auf 70 cm
bekommen. Sucht man im Internet nach Stichworten wie „internet of things“,
„mesh networks“ und „backhaul“, findet man Anregungen, wie der Amateurfunk
sich einmal mehr aktiv am technischen Fortschritt beteiligen könnte.
Die Chancen stehen überdies gut, dass das HAMNET manchen aus der so-
genannten Maker-Szene eher zum Amateurfunk lockt als der Geruch flüssigen
Kolophoniums. Wohl nicht nur in München klappt es inzwischen, dass Inte -
ressenten auf Maker-Veranstaltungen die Termine für zeitnah stattfindende
Amateurfunkkurse erfahren.
Wer kann existierende Funktechnik besser ausreizen als wir? Die nötige Hard-
ware gibt es für ein paar Euro zu kaufen. Grenzen setzen uns nur unsere
Fantasie und das Amateurfunkgesetz.
Alexander von Obert, DL4NO
Gedanken zum Jubiläum: unsere zehn Jahre mit der „funk“
Seit der Integration der „funk“ im Januar 2006 ist der FUNKAMATEUR
die letzte im Handel erhältliche deutschsprachige Amateurfunkzeitschrift.
An die einstige Vielfalt am Kiosk – beginnend mit der „beam“, die schon
1995 in der „funk“ aufging, über „Radio hören“, „CB-Funk“ bis zu „Radio-
hören & Scannen“ − erinnern sich wahrscheinlich nur noch wenige.
Vor zehn Jahren haben wir aber nicht nur die Leser der „funk“ in unseren
Abonnentenstamm integriert, sondern auch viele ihrer Autoren als Mitarbeiter
gewinnen können. Stellvertretend seien Alfred Klüß, Harald Kuhl, Bernd
Mischlewski, Hans Nussbaum, Jürgen Weigl und Michael Wöste genannt,
die heute den FUNKAMATEUR entscheidend mit prägen.
Durch die gestiegene Auflage verbesserten sich die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, sodass wir zusätzliche Mitarbeiter einstellen und unsere
Angebote deutlich ausbauen konnten. Davon zeugen einerseits das große
Sortiment an Bauteilen und Bausätzen sowie andererseits der im Vergleich
zu anderen Fachzeitschriften sehr günstige Abo-Preis. Kostete ein „funk“-
Jahresabonnement vor zehn Jahren schon 43,20€, so liegen wir mit 42,90€
heute immer noch darunter!
Inzwischen gehört der FUNKAMATEUR zu den wichtigsten Amateurfunk-
Magazinen weltweit. Dabei schätzen unsere in- und ausländischen Leser
neben der fachlichen Kompetenz vor allem die thematische Breite von der
Elektronik bis hin zum Jedermannfunk. Neben vielen Tausend Exemplaren
für deutsche Abonnenten gehen monatlich fast 5000 Hefte in die Nachbar-
länder, aber z. B. auch nach Alaska und Neuseeland.
Gern nutze ich die Gelegenheit, um mich bei allen zu bedanken, die an dieser
Erfolgsgeschichte – im wahrsten Sinne des Wortes − mitgeschrieben haben:
bei den Autoren, die über unsere Zeitschrift ihr Wissen an andere Amateure
weitergeben, und bei den FA-Redakteuren, die ihre Leidenschaft für den
Amateurfunk zum Beruf gemacht haben, jeden Monat interessante Themen
aufspüren und die Kontakte zu den Autoren pflegen.
Selbstverständlich haben auch die Verlagsmitarbeiter, die in der zweiten Reihe
wirken, ihren Anteil am Gelingen: die Grafiker und Layouter, unsere freund-
liche Abo-Verwaltung sowie die fleißigen Kollegen des FA-Leserservice, die die
Entwicklung der Bausätze koordinieren, sie sorgfältig zusammenstellen und
schnellst möglich in alle Welt versenden.
Für die Zukunft stehen wir vor der Aufgabe, die Zahl der Abonnenten weiter-
hin stabil zu halten. Verluste aus Altersgründen, wegen Hobbyaufgabe usw.
müssen mit neuen Verträgen kompensiert werden, was angesichts der heut-
zutage allgemeinen Abneigung gegen Abonnements* nicht ganz einfach ist.
„Treue Altleser“ haben für unsere Abo-Werbeaktionen nicht immer Verständnis,
obwohl sie davon letztlich ebenfalls profitieren: Denn je mehr Leser wir haben,
desto geringer ist der Anteil des Einzelnen an den ständig steigenden Fixkosten,
die mit der Herstellung und dem Vertrieb einer Zeitschrift verbunden sind.
Solange das DARC-Magazin CQDL im Zeitschriftenhandel nicht erhältlich ist,
tragen wir mit dem FUNKAMATEUR als gedrucktem Werbemedium für unser
sehr spezielles Hobby eine enorme Verantwortung. Dieser Herausforderung
stellen wir uns auch in den nächsten zehn Jahren.
Ich wünsche allen unseren Lesern und Autoren ein glückliches neues Jahr.
Ihr
Knut Theurich, DG0ZB
* Für Leser, die sich nicht mit einem Vertrag binden wollen, bieten wir seit Längerem
den jederzeit zu beendenden „Monatskauf“ an, bei dem keine Vorauszahlung nötig ist.
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Messen – aber wie?
Mit unseren Bausätzen vom FA-Leserservice verfolgen wir das gleiche Ziel
wie mit unserer Zeitschrift: Neben der Freude an der Beschäftigung mit
Funktechnik und Elektronik im Allgemeinen möchten wir vor allem praxis-
nahes Wissen und Kompetenz vermitteln − nicht zuletzt im Umgang mit der
Messtechnik.
Der Selbstbau eines Geräts bietet dafür eine sehr gute Grundlage; auch dann,
wenn man es nicht entwickelt hat und „nur“ nach Anleitung lötet, aufbaut
und ggf. abgleicht. Dabei besteht dann ab und zu schon die Notwendigkeit,
ein einfaches Messgerät qualifiziert einzusetzen. Wirklich spannend wird es
aber, wenn irgendetwas nicht so funktioniert, wie es soll…
Obwohl unsere Bausätze grundsätzlich so konzipiert sind, dass zur Inbetrieb-
nahme und zum Abgleich keine speziellen Messgeräte nötig sind, kommt man
bei einer eventuell notwendigen Fehlersuche oder Reparatur beispielsweise
ohne die Messung nieder- oder hochfrequenter Signalpegel nicht weiter.
Hier ist derjenige klar im Vorteil, der nicht nur die Schaltung verstanden hat,
sondern zudem über die nötige Sachkenntnis und Erfahrung im Umgang mit
Messgeräten verfügt.
Selbst das Deuten der Anzeige des Multimeters ist nicht immer trivial, wenn
man nicht genau weiß, was man eigentlich misst und mit welchen Effekten zu
rechnen ist. Ganz zu schweigen von anspruchsvoller Messtechnik, die außer-
dem richtig angeschlossen und bedient werden will. Hier lernt wohl jeder
Funkamateur oder Hobbyelektroniker sein Leben lang hinzu.
Eine gute Unterstützung könnte entsprechende Fachliteratur sein. Die ist leider
heutzutage selten geworden. Das Internet eignet sich zwar grundsätzlich als
Ersatz-Informationsquelle; die Suche nach Antworten oder Lösungen ist aber
oft mühevoll. Nicht selten sind die Ergebnisse unsystematisch aufbereitet,
schwer verständlich, fragwürdig oder sogar falsch! Das macht es besonders
Einsteigern schwer, sich das theoretische Rüstzeug anzueignen.
Der FA-Leserservice ist daher immer bemüht, das derzeit Verfügbare an spezi-
fischer Fachliteratur zu finden und anzubieten. Auch der FUNKAMATEUR trägt
jeden Monat mit Fachbeiträgen dazu bei, Wissenslücken zu schließen.
Einer der inhaltlichen Schwerpunkte ist stets die Messtechnik. Neben der Ver-
mittlung von Grundlagenwissen geht es dabei um Verfahren, Methoden und
Praxistipps, die zeigen, wie man mit möglichst überschaubarem Aufwand
zu akzeptablen Ergebnissen gelangt und sie richtig interpretiert. Als Beispiel
seien hier nur die jüngst veröffentlichten Beiträge von Werner Schnorrenberg,
DC4KU, zu SWV-/Leistungsmessgeräten und Intermodulationsmessungen
genannt.
Interessantes ist zudem technischen Beiträgen zu entnehmen, in denen der
jeweilige Autor seine Projektentwicklung beschreibt und dabei ebenfalls auf
messtechnische Belange eingeht.
Sicher werden wir in absehbarer Zeit keinen Bausatz für ein Oszilloskop an-
bieten. Trotzdem haben wir immer wieder gute Ideen entwickelt und aufge-
griffen, die den Messgerätepark der Hobbywerkstatt ergänzten und bereicher-
ten, ohne das Budget übermäßig zu belasten. So gibt es jetzt mit dem Bau-
satz zum Bauteiltester FA-BT2 die Neuauflage eines kleinen universellen Test-
geräts, das den Vergleich mit Konkurrenzprodukten nicht zu scheuen braucht.
Einige weitere Messtechnikprojekte sind in Planung.
Es lohnt sich also, den FA weiterhin aufmerksam zu lesen und von Zeit zu Zeit
unseren Online-Shop zu besuchen.
Peter Schmücking, DL7JSP
Stromversorgung im Notfall
Im August 2005 raste der Hurrikan Katrina auf die Südostküste der USA zu
und verwüstete unter anderem die Stadt New Orleans. Als Folge brach flächen-
deckend die Stromversorgung zusammen. Wer nun denkt, dass so etwas bei
uns nicht vorkommen kann, sollte sich die Naturkatastrophen der vergangenen
Jahre hierzulande ansehen.
Selbst beim Hochwasser an der Oder von 2010 oder beim sieben Länder
betreffenden Hochwasser in Mitteleuropa im Jahr 2013 blieben die gewohnten
Kommunikationswege in großen Teilen für Tage oder Wochen unterbrochen.
Zum Glück waren die Gebiete relativ klein, sodass die Hilfskräfte schnell alle
Betroffenen erreichen konnten.
Doch müssen nicht immer Überflutungen oder Stürme der Auslöser für Strom-
ausfälle sein. Selbst bei der in Deutschland nur partiell wirkenden Sonnen-
finsternis im März 2015 bangten die Netzbetreiber, ob aufgrund der heute
einen nicht unerheblichen Anteil an der Stromversorgung ausmachenden
Solaranlagen mit Netzanschluss als Folge der erwarteten Ab- und Zuschalt-
vorgänge ein sogenannter Blackout ausgelöst werden könnte. Das Risiko war
am Ende gering, doch es bestand.
Um die Stromversorgung dreht sich selbst im privaten Haushalt letztlich vieles,
angefangen von der Beleuchtung über den Kühlschrank bis hin zur Gas- oder
Ölheizung. Doch sehen Sie sich Ihre elektronischen Kommunikationswege ein-
mal genauer an:
Das gute alte Analog-Telefon, das dank Amtsbatterie auch noch nach vielen
Stunden oder gar einigen Tagen nutzbar ist, stirbt aufgrund der sich immer
weiter verbreitenden IP-Anschlüsse langsam aus. Selbst wenn bei Ihnen die
Datenvermittlung „im Amt“ bei einem Stromausfall noch einige Zeit weiterhin
funktioniert, werden Zwischenstationen und nicht zuletzt der heimische DSL-
Router sofort den Dienst versagen, weil ihnen schlichtweg das örtliche Strom-
netz fehlt.
ISDN-Telefone funktionieren nur noch, sofern diese eine eigene Stromversor-
gung haben. Und das Mobilfunknetz ist nach wenigen Stunden „platt“, selbst
wenn vereinzelt Betreiber zunehmend auf autarke Systeme mit Photovoltaik,
Windkraft und Brennstoffzellen setzen. Mobiltelefone lassen sich mithilfe
zusätzlicher Powerbänke noch weiter betreiben, haben jedoch keinen Netz -
zugang mehr.
Ja, wir sind Funkamateure und verfügen über andere Technik. Doch die heimi-
sche große Funkstation funktioniert nicht mehr, weil dafür ebenfalls der Strom
aus der Dose fehlt. Und das Handfunkgerät versagt nach ein paar Stunden den
Dienst, wenn es nicht wieder aufgeladen wird oder eine alternative Energie-
quelle vorhanden ist.
Gut dran ist derjenige, der über einen sofort einsetzbaren Stromgenerator ver-
fügt und zudem den nötigen Treibstoff für mehr als die Dauer eines Fielddays
parat hat und ihn sicher lagern kann. Solarpaneele und Windgeneratoren mit
Akkumulatoren sind weitere Alternativen.
Haben Sie sich schon selbst einmal die Frage gestellt, ob Sie für einen längeren
Stromausfall gerüstet sind, um sich zum Beispiel bei Funkfreunden oder den
hoffentlich näher rückenden Hilfskräften bemerkbar zu machen?
Wenn auch nur leise Zweifel bestehen, sollten wir die uns zur Verfügung
stehende Technik nutzen, um möglichst lange in Notsituationen erreichbar
zu sein − auch als Vorbereitung auf dem Weg zu einem jederzeit verfügbaren
Notfunk.
Wir werden Ihnen hier im FUNKAMATEUR immer wieder Möglichkeiten dazu
aufzeigen. Doch anwenden müssen Sie diese schon selbst!
Ingo Meyer, DK3RED
Keine Angst vor SMD!
Unter Hobbyelektronikern und Funkamateuren ist immer noch die Auffassung
weit verbreitet, dass sich Bauelemente ohne Anschlussdrähte in der heimischen
Werkstatt nicht verarbeiten lassen. Es sei denn, man verfügt über außerge-
wöhnliche individuelle Fertigkeiten und eine teure Spezialausrüstung. Dieses
Vorurteil hält sich derart hartnäckig, dass Bausatzanbieter bislang dazu neigen,
Produkte als unverkäuflich einzustufen, bei denen der Kunde SMD-Bauelemente
einlöten muss.
Warum ist das eigentlich so? Der Skeptiker sieht wahrscheinlich winzige,
mohnkorngroße Teile vor seinem geistigen Auge und kann sich beim besten
Willen nicht vorstellen, wie er diese löten soll. Er weiß noch nicht, dass SMD-
Bauelemente im Hobbybereich weitaus größer als Mohnkörner und mit einer
geeigneten Pinzette problemlos zu fassen und zu halten sind. So hat ein
SMD-Widerstand der Bauform 1206 eine Länge von etwa 3 mm. Was sich
aber festhalten lässt, das kann man auch löten. Wer es probiert hat, wird
dies bestätigen.
Ich frage mich, was gegen Teile spricht, bei denen man sich das Durchstecken
der Anschlussdrähte durch Platinenbohrungen und das lästige Abzwicken
spart? Wer sich einmal ernsthaft damit beschäftigt, unbedrahtete Widerstände,
Kondensatoren, Transistoren und selbst ICs auf eine Platine zu löten, stellt fest,
dass so etwas überhaupt nicht schwer ist.
Es gelten die gleichen Regeln wie beim Löten bedrahteter Bauteile, allerdings
sollte man sie wirklich beherzigen: Das Lot muss immer gut fließen, zu viel
davon ist genauso schlecht wie zu wenig. Man braucht eine sehr gute Beleuch-
tung und sollte sorgfältig arbeiten, damit das Resultat zufriedenstellend
ausfällt. Bleifreies Lot ist hier unter Hobbybedingungen ebenso wenig zu
empfehlen wie beim Löten bedrahteter Bauteile.
Auch beim SMD-Löten macht die Übung den Meister. Selbst das Entlöten
von SMD-Bauelementen ist in den meisten Fällen unkomplizierter als das von
bedrahteten Teilen aus heutzutage üblichen durchkontaktierten Leiterplatten.
Zum Thema „Löten und Entlöten“ ist übrigens die Lektüre der Beitragsfolge in
den FA-Ausgaben 1/14 bis 5/14 zu empfehlen. Darin fasste Norbert Graubner,
DL1SNG, seine langjährigen Erfahrungen als Entwickler zusammen.
Wer nun ausreichend motiviert ist und gleich mit einem passenden SMD-
Bausatz loslegen will, wird erst einmal ernüchtert feststellen, dass die Ange-
bots palette aus dem eingangs angedeuteten Grund sehr überschaubar ist.
Es gibt aber unter anderem den Vorverstärker für eine Portabel-Aktivantenne
nach DJ8IL (FA-Leserservice, BX-081), der für SMD-Lötübungen geeignet
und anschließend gut zu gebrauchen ist.
Der in der vorliegenden FA-Ausgabe ab S. 1090 vorgestellte mcHF-Transceiver
ist da schon zwei Nummern anspruchsvoller und beschert Übungspotenzial
für etliche Stunden. Als Ergebnis der Mühe winken ein vorzeigbarer KW-SDR-
Transceiver und die Erkenntnis, dass SMD-Löten gar nicht schwer ist.
Hat man erst einmal diese Sperre im Kopf überwunden und einige Übungs-
runden erfolgreich absolviert, steht einem die Welt der kleinen HF-optimalen
Bauelemente offen. Diese verkörpern den heutigen Stand der Technik und
verfügen daher nicht selten über weitaus bessere Parameter als ihre alt-
bekannten bedrahteten Vorgänger.
Die moderne Elektronik und HF-Technik kommen ohne SMD-Bauelemente
nicht mehr aus. Gehen wir also mit der Zeit und schränken unsere Möglich-
keiten nicht unnötig ein, indem wir um solche Teile einen Bogen machen!
Peter Schmücking, DL7JSP
Veränderungen bieten Chancen
So ähnlich muss es 1954 gewesen sein, als alle Welt die Spiele der Fußball-WM
am Radio verfolgte: Jeder saß wie gebannt und voller Konzentration vor seinem
Gerät, um kein Detail der Übertragung, keine Aussage des Kommentators zu
verpassen. Funkwellen überbrückten die Distanz, brachten dank Technik die
Menschen zusammen.
Vergleichbares konnte ich nun kürzlich während unseres Urlaubs auf der
Kanareninsel Fuerteventura täglich im Eingangsbereich der Hotelanlage
beobachten. Im Katalog hatte gestanden, es würde dort per WLAN einen
kostenlosen Internetzugang geben.
Dieser existierte tatsächlich und wurde unübersehbar ausgiebig genutzt:
Von morgens bis abends versammelten sich in der Eingangshalle wechselnde
Smartphone-Träger sowie eine Minderheit von Tablet-Nutzern. Die meiste
Zeit dort starrten sie aufs Display und warteten auf Rückmeldung, denn der
Internetzugang war quälend langsam und die große Zahl der gleichzeitigen
Zugriffe verbesserte die Lage eher nicht.
Einige der manchmal über 20 Nutzer hatten gar sowohl Smartphone als auch
Tablet in Betrieb und hoffte wohl, auf dem einen oder anderen Weg etwas
schneller durchs virtuelle Nadelöhr zu schlüpfen. Vertreten waren dort gleich-
berechtigt alle Altersgruppen, vom Grundschüler bis zum Pensionär.
Dieses weltweite Warten erinnerte an die Frühzeit des Internets, als ich mich
noch zum Abruf und Verschicken von E-Mails per Modem einwählte und
auf der Abrechnung des Anbieters jede Verbindungsminute bzw. Datenüber-
tragung erschien. Auf Reisen zählt heute wieder jedes Kilobyte und, so die
wohl nachvollziehbare Überlegung, im Urlaub ist ein kostenloser langsamer
Zugang allemal besser als eine überhöhte Rechnung.
Die beschriebene Szene verdeutlicht allerdings ebenfalls, welchen hohen
Stellenwert Smartphone & Co. heute haben − auch außerhalb von WM oder
ähnlichen Ereignissen von Weltrang. Radio hat dort vermutlich niemand
vermisst, aber aufs Internet wollten viele Urlauber nicht verzichten − ob jung
oder alt. Mein Sohn hört übrigens selbst zu Hause kein Radio mehr, sondern,
wenn nicht gerade ein Hörspiel läuft, ist er begeisterter Nutzer eines bekannten
Musik-Streaming-Dienstes.
Nun kann man beklagen, dass das Internet bzw. die darüber zugänglichen
Dienste anscheinend alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und unseren
Themen kaum noch Raum lassen. Doch, wie ich meine, führt das zu nichts.
Vielmehr sollten wir das Web noch konsequenter und unvoreingenommener
für unsere Interessen einsetzen.
Dazu gehören die Vernetzung von analogen wie digitalen Relaisfunkstellen
sowie die tatsächliche Anwendung solcher Technologien im täglichen Betrieb,
um auch ohne große Antennenanlage über Kontinente hinweg als Funkama-
teure zu wirken.
Ferner bereiten per Internet zugängliche abgesetzte Empfangsstellen für von
einem hohen elektrischen Störpegel ausgebremste Kurzwellenhörer sowie
Funkamateure einen Weg, das Hobby nicht komplett aufgeben zu müssen. Und
wenn sich zu Hause nicht einmal eine Balkonantenne zum Senden realisieren
lässt, ist der komplette Remote-Betrieb ein Ausweg. Mit dem HAMNET haben
wir dafür sogar unser eigenes schnelles Datennetz.
Die technischen Möglichkeiten für dies und mehr sind also greifbar, wir müssen
sie nur nutzen.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Schnelligkeit ist keine Hexerei
In Gesprächen mit Funkamateuren, die nicht gerade zur Gilde der Top-DXer
zählen, höre ich häufig, dass man wegen örtlicher Gegebenheiten nur mit
100 W und einfachen Antennen funken könne. Dadurch würde auf CQ-Rufe,
zumal von einem der vielen deutschen Funkamateure, kaum jemand reagieren
und beim Anrufen von DX-Stationen ginge man leer aus.
Eine Situation, die ich gut nachvollziehen kann, und mit mir sicher viele Leser.
Den Portabelbetrieb, mit dem man sich sehr wohl in eine weitaus günstigere
Position bringen kann − und sei es nur durch urlaubsbedingtes Voranstellen
eines „IS0/“ − lasse ich hier außen vor. Denn schließlich möchte man ja auch
gern von zu Hause aus funken.
Dann bleibt eben das möglichst geschickte Reagieren auf die CQ-Rufe der
anderen. Dazu ist es angeraten, sein funkerisches Können zu verbessern,
die Telegrafiefähigkeiten zu trainieren und zu schauen, wie erfolgreiche DXer
vorgehen. Dabei hilft zunächst hören, hören und nochmals hören. Aber auch
lesen − wie etwa die wertvollen Hinweise, die Glenn Johnson, W0GJ, im
FA 6/15 auf S. 680 f. gegeben hat.
Das geht damit weiter, die vorhandenen Möglichkeiten der Errichtung von
Antennen wirklich auszureizen, auf vielen Bändern QRV zu sein und min-
destens genau so schnell wie die anderen zwischen den einzelnen Bändern
umschalten zu können.
Hat man vor 30 Jahren mühsam die Bänder abgesucht und sich vor 20 Jahren
auf dem OV-Kanal DX-Tipps zugerufen, so war vor zehn Jahren das DXCluster
das wichtigste Informationsmittel. Heute ist es kurz nach dem Auftauchen
von DX im Cluster für einen eher mäßig gut ausgestatteten Funkamateur
bereits oft zu spät. Nur wer die Meldung sofort erkennt und dank PC-Kopp-
lung ganz fix auf die Frequenz des begehrten Funkpartners springen kann,
hat noch eine Chance, vor der wild gewordenen „Meute“ zum Zuge zu kommen.
Selbst das Band abzusuchen, wie von mir im Editorial des FA 1/2011 ange-
mahnt, hilft bisweilen heute noch − aber selten … Eher ist zumindest in CW
das Reverse-Beacon-Network ein probates Mittel, um schneller als die „Nur-
Cluster-Nutzer“ vom Auftauchen einer begehrten Station zu erfahren.
Des Weiteren kann eine Spektrumdarstellung interessierender Bandbereiche,
wie sie die neuesten Funkgeräte, SDR-Transceiver, sowie zum konventionellen
Empfangsteil parallelgeschaltete SDRs ermöglichen, in Pile-up-Situationen
sehr aufschlussreich sein. In Telegrafie lässt sich dies durch CW-Skimmer
weiter perfektionieren.
All diese Dinge haben wir im FUNKAMATEUR oft genug beschrieben, seien
es Zusatzbaugruppen wie CAT-Interfaces oder Stationsmanager ebenso wie
Log- und Contestprogramme. In dieser Ausgabe folgt mit dem Multifunktions-
Keyer von DL6ER ab S. 868 ein weiterer Baustein. Lassen wir uns also durch
die Technik unterstützen und konzentrieren uns aufs Funken − zu tun bleibt
da für uns allemal genug!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Der weite Weg lohnt
Vom 26. bis 28. Juni öffnet die Ham Radio ihre Tore und begeht dabei ihren
40. Jahrestag. Im 65. Jahr seines eigenen Bestehens stellt der DARC e.V.
das Thema „Raumstationen, Satelliten, Reflexionen: Amateurfunkkontakte
ins All“ in den Mittelpunkt. Das finden wir richtig, ist dies doch zum einen
eine spannende, technisch sehr anspruchsvolle und technologisch vorwärts-
weisende Sparte unseres Hobbys. Anderseits zieht dieser Themenbereich,
wie wir immer wieder anhand der Begeisterung Jugendlicher für Kontakte
mit der Raumstation ISS erkennen, den in unserem Hobby so dringend
benötigten Nachwuchs an.
Vielleicht erfährt man ja dabei Genaueres über das hochinteressante Gemein-
schaftsprojekt der AMSAT-DL und der Qatar Amateur Radio Society, den
Amateurfunk-Lineartransponder an Bord des für 2016 geplanten geostatio-
nären Satelliten Es'hailSat 2.
Die von www.hamradio-friedrichshafen.de (Besucher → Prospektbestellung)
herunterladbare „Besucherinfo“ verzeichnet indes Veranstaltungen des messe-
begleitenden 66. Bodenseetreffens zu so vielen weiteren Themen, dass für
jeden Besucher − auch für eher „bodenständig“ interessierte − etwas dabei
sein dürfte.
Nun zum zweiten Mal läuft am Samstag und Sonntag parallel die Maker-World,
„Das Event rund ums Machen, Tüfteln und Gestalten“. Besucher können mit
einmal gekauften Eintrittskarten beide Messen besichtigen. Das empfanden
wir bereits 2014 als wirkliche Bereicherung des Messegeschehens und
begrüßen es in diesem Jahr wieder − selbst wenn über das gegenseitige
„Beschnuppern“ hinaus erkennbare Synergieeffekte bisher ausgeblieben sind
− zu unterschiedlich sind wohl die Erwartungen und Interessen der jeweiligen
Klientel.
Die Zusammenlegung beider Veranstaltungen ist ferner unter dem Gesichts-
punkt eine geschickte Entscheidung, dass sich eine Messe nun einmal
finanziell tragen muss. Am traurigen Schicksal der traditionsreichen Inter-
radio, die wegen zu geringer Einnahmen und schwindendem ehrenamtlichen
Engagement wahrscheinlich 2015 zum letzten Mal stattfindet, sehen wir,
wie wichtig es ist, solche Amateurfunk-Großveranstaltungen − auch durch
gelegentliche persönliche Teilnahme – am Leben zu erhalten.
Der Weg bis an Deutschlands Südgrenze mag zwar für Funkamateure aus dem
Norden ziemlich weit erscheinen. Doch ist der europäisch zentral gelegene
Standort Friedrichshafen im Hinblick auf die enorme internationale Beteiligung
an Europas größter und seit Jahrzehnten renommierter Amateurfunkmesse
nahezu perfekt. Und nicht zuletzt ist die Bodenseelandschaft auch für Mit-
reisende reizvoll.
Wer schon einmal zur Hamvention in Daytons sanierungsbedürftiger Hara
Arena war oder Berichte darüber liest, wird es beim Sitzen in einem der
wohlklima tisierten Vortragsräume besonders zu schätzen wissen, welch
komfortable Infrastruktur uns Friedrichshafen bietet.
Den weiten Weg wird jedenfalls das Team des FUNKAMATEURs auch in
diesem Jahr nicht scheuen − wir freuen uns auf Sie wie immer am Stand 102
in der Halle A1!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Überzeugungsarbeit leisten
Als am 25. April ein schweres Erdbeben Nepal erschüttert und neben der
Existenz zahlreicher Menschen auch große Teile der Infrastruktur zerstört,
unterstützen umgehend ortsansässige Funkamateure die Ersthelfer nach
Kräften mit Notfunk. Mittels Amateurfunk lassen sich so schon unmittelbar
nach der Katastrophe unabhängig von zusammengebrochenen öffentlichen
und staatlichen Kommunikationsnetzen wichtige Informationen übermitteln.
Jedoch ist der Amateurfunk in Nepal noch jung: Die dortige Regierung lässt
unseren Funkdienst erst seit 2011 zu und die knapp 50 überwiegend jungen
Funkamateure im Land sind nur für den örtlichen Funkbetrieb auf UKW aus-
gestattet. Ein geplantes UKW-Notfunknetz besteht zum Zeitpunkt des Erd-
bebens lediglich aus einer Relaisstation in Kathmandu. Kurzwellen-Transceiver
für direkte Funkkontakte zwischen verschiedenen Landesteilen oder mit
dem Ausland sind anfangs kaum vorhanden, sodass das Potenzial des
Amateurfunks für den Notfunk zunächst nur eingeschränkt nutzbar ist.
Naturkatastrophen vom Ausmaße eines Erdbebens wie jetzt in Nepal sind
hierzulande zum Glück wohl nicht zu befürchten, da wir zufällig nicht auf der
Grenze zweier tektonischer Platten leben. Gefeit vor Unglücken mit schlimmen
Auswirkungen sind wir allerdings bekanntlich ebenfalls nicht, ob großflächige
Überschwemmungen oder Unwetter. Jüngstes Beispiel ist ein Tornado, der
Anfang Mai die Stadt Bützow in Mecklenburg-Vorpommern traf.
Um hierzulande die betroffene Bevölkerung künftig vor solchen Ereignissen
oder anderen sogenannten Großschadenlagen zeitnah zu warnen, hat unter
anderem die Göttinger Stadtverwaltung die Einführung eines neuen Kommuni-
kationskanals beschlossen: Warnungen und Verhaltenstipps kommen künftig
übers Mobilfunknetz aufs Smartphone, per SMS aufs Mobiltelefon oder als
E-Mail. Über die Eingabe von Postleitzahlen lässt sich die gewünschte Warn-
region festlegen.
Der für viele Leser offensichtliche Haken eines solchen Systems ist die Abhän-
gigkeit von einer funktionierenden Infrastruktur, was ja gerade im Katastrophen-
fall oft nicht gegeben ist: Mobilfunknetze neigen zur Überlastung, wenn alle
gleichzeitig ihre Familienangehörigen erreichen wollen.
Zudem brauchen die meisten Akkumulatoren in den energiehungrigen Smart-
phones ihre fast tägliche Ladephase, die bei einem längeren Stromausfall
freilich entfällt. Wobei viele Mobilfunksender ohne Netzstrom ohnehin sofort
abschalten, sofern nicht eine Notstromversorgung diese noch für wenige
Stunden am Laufen hält. Pikanterweise wirbt der Anbieter des oben genann-
ten Warnsystems sogar damit, dass man darüber auch bei Stromausfällen
warnen und informieren könne.
Der Notfunk der Funkamateure ist weitaus weniger abhängig von der örtlichen
Infrastruktur: Mit Erfahrung und Improvisationstalent, wie z. B. auf S. 603 dieser
Ausgabe nachzulesen, stellen wir auch dann noch Funkverbindungen her, wenn
die professionellen Netze ausgefallen sind. Unser HAMNET ermöglicht eine
vom Internet unabhängige Datenkommunikation und hat sich bei gemeinsamen
Übungen mit Behörden als zuverlässig erwiesen.
Umso unverständlicher ist es daher, wenn lokale Entscheider in manchen
Kommunen unseren Notfunk noch immer als Störfaktor empfinden und wichtige
Antennenstandorte zum Aufbau von Linkstrecken blockieren. Es gilt also,
vor Ort weiterhin Überzeugungsarbeit zu leisten.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Bevölkerungsschutz per Radio?
Am 27. 3. 2015 gingen nach einem Defekt einer Umspannstation bei Amster-
dam in Teilen der Niederlande die Lichter aus. Dieser sogenannte Blackout
traf die wirtschaftsstarke Region Nord-Holland, zu der die Hauptstadt Amster-
dam gehört. Die Folgen zeigten sich innerhalb kurzer Zeit: Ampeln und Notruf-
nummern fielen aus, Telefone blieben stumm. Züge wurden evakuiert und
der internationale Flughafen Schipol musste zeitweise seinen Betrieb ein-
stellen.
In den Niederlanden war zu beobachten, was passiert, wenn in einer moder-
nen Volkswirtschaft der Strom ausfällt. Schwer davon betroffen war auch
das Telekommunikationsnetz, das sofort zu 70 % nicht mehr funktionierte.
Weil die für die Notversorgung vorgesehenen Pufferbatterien nach maximal
drei Stunden leer sind, fiel nach und nach der Rest der Mobilfunkumsetzer
ebenfalls aus und schließlich brach das Mobilfunknetz komplett zusammen.
Solche Vorfälle sind zum Glück selten, aber sie häufen sich. So trennte etwa
am 13.12. 2012 der Ausfall einer Umspannstation weite Teile Münchens einen
ganzen Vormittag lang von der Stromversorgung. Und wieder brach die Tele-
kommunikation zusammen. Man mag sich nicht die Folgen ausmalen, wenn
einmal infolge einer Naturkatastrophe großflächig und tagelang nichts mehr
aus der Steckdose kommt. Dies ist beileibe keine Panikmache. Es sei nur an
die verheerende Überschwemmungskatastrophe in Ostdeutschland im Juni
2013 erinnert oder an den Eisregen, der im Dezember 2005 das Münsterland
tagelang vom Strom abschnitt.
Auf der Internetseite des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe findet man Hinweise, was der Einzelne bei einem
Blackout tun und wie sich die Bevölkerung mit Nachrichten versorgen kann.
Wörtlich steht dort: „Sie brauchen ein batteriebetriebenes Rundfunkgerät oder
ein Kurbelradio mit UKW- und Mittelwellenempfang, auch ein Solar- oder
Autoradio kann benutzt werden. Es gibt auch Kurbelradios mit USB-Anschluss
zum Aufladen von Handys. Halten Sie ausreichend Batterien bereit, denken
Sie daran, dass auch Batterien nicht unbegrenzt haltbar sind.“
Das Bundesamt rät also, ein Radiogerät mit UKW und Mittelwelle nebst Batte-
rien vorrätig zu halten. Allerdings: UKW-Sender haben bekanntlich keine große
Reichweite und fallen bei einem regionalen Stromausfall wohl aus. Was aber
wird man in einem Katastrophenfall bald auf der Mittelwelle noch hören?
Großes Schweigen!
Denn Verantwortliche aus Politik und Medien haben die Abschaltung der ana-
logen Rundfunkverbreitung in den AM-Bereichen bis Ende 2015 beschlossen.
Wir werden im Unklaren darüber gelassen, dass in einem wirklichen Notfall
keine Informationen mehr per Rundfunk verfügbar sind. Oder es fehlt an den
entscheidenden Stellen schlicht das technische Wissen darüber, dass nur die
AM-Bereiche eine überregionale Versorgung ermöglichen.
Man kann nur hoffen, dass Beiträge wie dieser die Verantwortlichen rechtzeitig
erreichen und nicht vorher schon alle AM-Sender abgerissen sind. Der Erhalt
einiger Sendeanlagen für Notfälle sollte der Gesellschaft doch in ihrem eigenen
Interesse ein paar Euro wert sein.
Ihr
Rainer Englert, DF2NU
Der QSL-Stapel
Von 1979 bis 1989 war ich in meinem DARC-Ortsverband Spandau, D06,
mit damals mehr als 300 Mitgliedern QSL-Manager. Jeden Monat habe ich
bis zu 2000 ein- und ausgehende Karten sortiert, gefächert, gebändert,
verpackt, verschickt. Jeden Monat kam ein Paket mit eingehenden QSLs
aus Baunatal. Monat für Monat Hunderte, Tausende Karten. Berufsbedingt
musste ich diesen QSL-Job dann an den Nagel hängen, aber die monatliche
Vorfreude auf den Stapel eingehender QSLs in meinem QSL-Fach im OV
blieb. Das ist bis heute so.
Unser OV hat derzeit noch etwa 130 Mitglieder, die eingehenden QSL-Liefe-
rungen aus Baunatal passen mittlerweile in einen halben Schuhkarton der
Größe 36. Von den eingehenden Karten entfallen bestimmt über die Hälfte
auf lediglich sechs oder sieben Rufzeichen, einschließlich meinem. Ein
anderer „Aktivist“ ist übrigens ein SWL! Der Mensch ist eben nicht nur Jäger,
sondern zudem Sammler.
Das Internet hat uns dankenswerterweise unter anderem das Logbuch of
The World beschert. Wir können bei den Mega-DXpeditionen in Online-Logs
gucken und wissen bereits kurze Zeit später, ob unser QSO o. k. war − so
denn die Internetverbindung auf dem entfernten Eiland zufriedenstellend
funktioniert.
Wir müssen unsere eigene Karte nicht mehr an die DXpeditionäre schicken,
das geht jetzt auch ohne Papier, einfach per OQRS oder E-Mail, siehe dazu
der Beitrag ab S. 365 in dieser Ausgabe. Vergleiche ich diese Dinge mit den
Zeiten von 1980 oder 1985, dann liegen Welten dazwischen! Trotzdem freue
ich mich über Karten aus Samoa, Malta oder Tschechien. Ja, und die meisten
farbigen Karten haben mittlerweile Fotoqualität, was die einfacheren deshalb
aber nicht abwertet.
Für viele ist die QSL eben doch die Visitenkarte des QSO-Partners. Es gibt
eine Reihe von Stationen, bei denen ich mich während des QSOs an die QSL
des Funkpartners erinnere, die ich für eine frühere Verbindung erhalten habe.
Da weiß ich vielleicht sogar, wie der Operator oder dessen Antennenmast
aussieht. Derlei Dinge machen für mich weiterhin den Unterschied zu einer
elektronischen Bestätigung aus.
Ich lese die Karten noch immer, ziehe innerlich tief den Hut, wenn ich etwa
bei der Stationsbeschreibung meines QSO-Partners lese „completely home-
brewed“ oder Fotos von selbst gebauten KW-Antennen größeren Zuschnitts
sehe. Bei wieder anderen Funkpartnern habe ich ehrliche Ehrfurcht, wenn
ich auf der QSL lese „QRV since 1948“ und mich daran erinnere, wie flott
der OM die Taste im QSO hatte klappern lassen.
Unlängst habe ich eine Bestätigung für ein FM-QSO mit einer Mobilstation
erhalten, die zu Besuch in Berlin war. Das berühmte „komme ich über das
Relais?“ war wie häufig ungehört verhallt, ich antwortete, wir hatten ein QSO.
In diesen zehn Minuten beschrieb ich dem Berlin-Besucher den Weg zum
Hotel und gab ihm ein paar Tipps zu Berlin. Für diese Verbindung hatte ich
meine Karte geschickt und jetzt eine retour erhalten. Eine Schwarz-Weiß-
Ausführung mit der Notiz: „Danke für das nette QSO und die Tipps!“ Ich habe
mich an das QSO erinnert. Tnx QSO es tnx QSL, denn auch eine Papier-QSL
gehört immer noch zum Amateurfunk.
vy 73, Ihr
Peter John, DL7YS
Wenn Idioten Idioten Idioten nennen
Eine Seuche geht um auf den KW-Bändern: die des schlechten Benehmens–
zumindest in Pile-up-Situationen. Aktuelles Beispiel ist K1N, die kostspielige
DXpedition zur ganz oben bei den meistgesuchten DXCC-Gebieten ange-
siedelten Insel Navassa in der Karibik. Im Grunde habe ich das Szenario ja
bereits im Editorial des FA 2/2013 „Das Psychopathen-Konzert“ geschildert.
Das knappe „Up-up!“ der Aufpasser kann ja durchaus nützlich sein, wenn
sich mal einer auf der Split-Taste vertippt hatte, was selbst in den besten
Kreisen vorkommen soll. Heute allerdings begnügt sich die Empörung nicht
mit einem immer noch freundlichen „Good moooorning!“ oder dem scherz-
haften „Fiveninethankyou“. Der Schimpf-Standard beginnt beim „Up-up,
Idiot!“ im Chorgesang und geht über „Pig!“ und „Stupid!“ nahtlos über ins
„Fuck You!“ Jeder Kommentar provoziert einen Gegenkommentar, und schon
setzt eine minutenlange Schimpforgie ein. Selbst die digitalen Bereiche
bleiben längst nicht verschont. Und wer befürchtet, auf dem Band nicht
erhört zu werden, verbreitet sein Vulgär-Vokabular im DX-Cluster.
Für den bislang absoluten Höhepunkt der Interventionen gibt es bereits
ein neues Kürzel: DQRM − „Deliberate QRM“, also absichtliche Störung.
Mit jeder raren DX-Station auf den Bändern verbreitet sich das Virus weiter.
In CW sind das sinnlose Textschleifen mit Fantasierufzeichen oder Punkt-
Strich-Folgen; in Fonie spielt die Musik und ätzen „Witzbolde“; in RTTY rollt
ein endloses „ryryryr“ über den Monitor und minutenlanges Trägerstellen
passt immer.
Die Störerbande rekrutiert sich offenbar aus Menschen, die es in ihrer Ersatz -
welt auf den Bändern nicht wie erhofft geschafft haben. Sie sind ausnahmslos
im Besitz einer Sendegenehmigung, gehören also ihrer Ansicht nach sogar
einer Elite an. Sie rächen sich für den ausbleibenden eigenen Erfolg in der DX-
Konkurrenz unter dem Schutz der Anonymität mit der Waffe ihrer Endstufe.
„Was ich nicht haben kann, soll auch kein anderer bekommen!“ Oder sie finden
diesen ganzen Pile-up-Rummel einfach widerlich und halten sich damit sogar
für die „Guten“. Sie bringen ihre Verachtung für das sinnlose Gewühle als Teil
des Bösen in der Welt durch Trommelfeuer dagegen zum Ausdruck.
Als Gegenmaßnahme zum DQRM haben die OPs bei K1N überwiegend auf die
Angabe von Arbeitsfrequenzen verzichtet. Des Weiteren wurde das „DQRM
Tracking Project“ weiterentwickelt, das in Echtzeit computergestützt durch
Triangulation absichtliche Störer „einkreisen“ soll. Dazu gibt es auf der Website
www.navassadx.com ein „DQRM Report Form“. In dieses Formular kann man
seine Beobachtungen eintragen: jedoch bitte nur absichtliche Störer, keine
„Polizisten“ oder versehentliche Falsch-Rufer.
Nur gut, dass kaum ein Außenstehender mitbekommt, was im Funkdienst
Amateurfunk so geschieht … Aber Vorsicht! Ehe wir mit dem Stinkefinger
auf andere zeigen, sollten wir selbst in uns gehen. Und was finden wir vor?
Einen Funkfreund, der schon einmal auf der DX-Frequenz satt abgestimmt
hat? Der die Split-Taste gelegentlich zu drücken vergisst? Der sein Rufzeichen
abgesondert hat (drum heißt es ja Ruf-Zeichen), obwohl eine andere Station
aufgerufen wurde? Der bei Bedarf den Bratofen jenseits des erlaubten Limits
anwirft? Oder tatsächlich den makellosen „Rules of conduct“-Puristen mit
der blütenweißen Weste, der jederzeit den ersten Stein werfen dürfte?
Na ja, dann…
Wolf Harranth, OE1WHC
Remote-Stationen − kein Amateurfunk?
Wer Remote-Stationen, also vom eigenen Standort abgesetzte, übers Internet
gesteuerte Amateurfunkstellen, nutzt oder betreibt, erlebt allerhand interes-
sante Reaktionen.
Vor allem Funkamateure, die das Potenzial einer solchen Station schon selbst
erlebt haben, sind von dieser Kombination von Funk und Internet begeistert.
Sie genießen den Betrieb einer Funkstation in bester Lage, mit vielleicht Top-
Equipment und ohne eigene Antennen-, EMV- und Man-made-Noise-Sorgen.
Versteht man unter Amateurfunk nicht nur den traditionellen Betrieb mit
gekauftem oder selber gebautem Equipment, sondern darüber hinaus die
intensive Auseinandersetzung mit neuer Technologie, so ist dies ein interes-
santes Thema.
Anders als etwa bei rein Web-basierenden Systemen wie Hamsphere oder
Echolink (zum Teil) ist hier das Internet nur ein Hilfsmittel zur Fernsteuerung
realer Geräte. Das „HF-Gefühl“ bleibt erhalten − vor allem dann, wenn sich
die ferngesteuerte Station in der Nähe des Nutzers befindet. Weniger sinnvoll
scheint es mir persönlich zu sein, eine Remote-Station auf einem anderen
Kontinent für den Sendebetrieb zu nutzen. Solche Stationen ermöglichen
jedoch im Empfangsbetrieb interessante Antennenvergleiche.
Für Kritiker ist die Verbindung von Amateurfunk und Internet dagegen
buchstäblich des Teufels. Remote-Betrieb via Internet wird mitunter gar als
„Telefon-Sex“ bezeichnet. Sobald solche Gegenstation davon erfährt, endet
das QSO abrupt mit dem Hinweis, dass dies kein „richtiger“ Amateurfunk sei.
Verfolgt man die entsprechenden „Jammer-Runden“ auf den Amateurfunk-
bändern, so liegt der Schluss nahe, dass Masochismus unter Funkamateuren
weit verbreitet ist: Man stöhnt lieber täglich über einen Rauschpegel von
S9+20dB am eigenen Wohnort, statt die Möglichkeiten der modernen
Technik zu nutzen.
Aufgabe der Amateurfunkverbände sollte es sein, den Remote-Betrieb etwa
durch die Erhaltung geeigneter Funkstandorte und die Schaffung gesetzlicher
Rahmenbedingungen seitens der Regulierungsbehörden zu erleichtern. In
einigen EU-Ländern, wie Österreich und Großbritannien, ist man davon leider
noch weit entfernt; der DARC e.V. plant erfreulicherweise bereits den Aufbau
eines Netzes von Remote-Stationen.
Es fehlen bislang ein geräteunabhängiges einheitliches Protokoll für den
CAT-Betrieb sowie ein verbindlicher Standard für Pegel, Impedanzen und
Anschlüsse der Audio-Schnittstellen, wie er etwa in der Studiotechnik längst
üblich ist.
Die flexible Architektur der ab S. 138 beschriebenen Remoteham-Software
könnte es durchaus ermöglichen, dass sich Nutzer künftig die gewünschten
Standorte bzw. Sende- und Empfangsgeräte über die Software zusammen-
stellen und für den Betrieb miteinander verbinden. Werden dann noch multi-
nutzerfähige SDR-Konfigurationen eingesetzt, so eröffnet dies interessante
Möglichkeiten für den simultanen Mehrfacheinsatz von Funkstandorten, vor
allem wenn am einen Ort nur gesendet und am anderen nur empfangen wird.
Damit kommt der Erhaltung geeigneter Funkstandorte für die Zukunft des
Amateurfunks große Bedeutung zu, denn die beste Technik verliert ohne gute
Standorte ihren Glanz.
Der Amateurfunk behält damit auch in diesem Bereich seinen typischen
Charakter eines experimentellen Funkdienstes. Es gibt noch vieles auszu-
probieren und zu verbessern …
Markus Schleutermann, HB9AZT
Bausätze vom FA-Leserservice
Von Anfang an besteht eines der wichtigsten Anliegen unserer Zeitschrift
darin, den Selbstbau auf dem Gebiet des Amateurfunks und der Elektronik
zu unterstützen. Angesichts allgegenwärtiger Plug-and-Play-Technik und
spottbilliger Importware aus Fernost könnte man sich inzwischen fragen,
ob dieses Ziel immer noch zeitgemäß ist. Wir meinen: ja − und die Gespräche
mit Funkamateuren auf Messen und Flohmärkten sowie die Zuschriften und
eingesandten Manuskripte bestätigen unsere Auffassung.
Selbstbau bietet die einzigartige Chance, Elektronik- sowie HF-Schaltungs-
technik im eigentlichen Wortsinn begreifbar zu machen, um dabei das Ver-
ständnis für Grundlagen und Zusammenhänge zu vertiefen. Wir Funkamateure
erhalten uns damit zudem die Fähigkeit, ein kleines technisches Problem
mal eben durch das Zusammenlöten einiger Bauelemente zu lösen. Dieses
Improvisationstalent hat uns schon immer ausgezeichnet und sollte nicht
verloren gehen.
Daher hat der FA-Leserservice auch künftig nicht vor, importierte Funkgeräte
oder anderes fertiges Stationszubehör ins Sortiment aufzunehmen, sondern
konzentriert sich weiterhin auf Spezialbauteile, Platinen und Bausätze. Letztere
haben den Vorteil, dass sie dem Bastler die oft zeitraubende Bauelemente-
logistik abnehmen und schaltungstechnisch erprobte Lösungen bieten. Der
Weg zum selbst gebauten, funktionierenden Gerät ist dann nicht mehr weit.
Trotz vereinzelter Anfragen planen wir ebenfalls nicht, unsere Bausätze als
„fertig aufgebaute“ Version anzubieten, denn dies würde dem eingangs ge-
nannten Ziel entgegenstehen. Auch wären die bürokratischen Hürden wie
RoHS-Konformität usw. wegen der relativ geringen Stückzahl unverhältnis-
mäßig hoch.
Übrigens verhält es sich bei Bausätzen nicht anders als bei Fertiggeräten:
Irgendwann ist der letzte verkauft. Wenn es dann keine Nachauflage gibt,
kann das im Wesentlichen zwei Ursachen haben: Entweder hat die Nachfrage
so stark nachgelassen, dass eine Nachauflage schon aus Kostengründen nicht
mehr lohnt oder ein wichtiges Bauteil ist nicht mehr erhältlich bzw. zu einem
akzeptablen Preis beschaffbar.
Wenn uns die Materialsituation einen Strich durch die Rechnung macht, ist
leider oft eine zeitaufwendige Neuentwicklung wesentlicher Komponenten
unumgänglich. So wollen wir beispielsweise noch vor der Ham Radio 2015
den Bauteiltester FA-BT in einer neuen Version mit einem anderen Display
anbieten. Dazu müssen jedoch Platine, Gehäuse und Stromversorgung − also
praktisch alles − grundlegend überarbeitet werden.
Darüber hinaus haben wir selbstverständlich für 2015 einige neue Projekte
geplant. Dem Wunsch vieler Leser entsprechend soll es den ferngesteuerten
symmetrischen Antennenkopplerbausatz von Norbert Graubner, DL1SNG,
künftig in der Leistungsklasse 200 W geben. Der Prototyp ist bereits fertig.
Zudem sei an dieser Stelle schon einmal das VHF-Transverterprojekt für 2 m,
4 m und 6 m von Uwe Richter, DC8RI, erwähnt. Den Prototyp hatten wir
auf der Interradio in Hannover vorgestellt, wo er auf großes Interesse stieß.
Einfache Bausätze stehen ebenfalls auf der Agenda, darunter ein Nachfolger
des seinerzeit besonders bei Einsteigern unter den Bastlern beliebten Direkt-
mischempfängers von Klaus Raban, DM2CQL, in einer überarbeiteten Zwei-
band-Variante.
Wir hoffen, dass wir damit Ihr Interesse am Selbstbau weiterhin wach halten.
Denn was gibt es Schöneres für einen Technikbegeisterten als ein gut funktio-
nierendes selbst gebautes Gerät, dessen Schaltungsdetails man genau kennt
und das man gegebenenfalls sogar ohne fremde Hilfe reparieren kann.
Peter Schmücking, DL7JSP, FA-Leserservice
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Breites Spektrum − für jeden etwas
Liebe Leser, mit der Dezemberausgabe 2014 hoffen wir, Ihnen auch in diesem
Jahr wieder genügend fesselnde Lektüre geboten zu haben. Gemäß dem
Untertitel auf der Titelseite unserer Zeitschrift sprechen wir traditionell einen
breit gefächerten Leserkreis an, der keineswegs nur Funkamateure umfasst.
Da ist es nicht einfach, von Ausgabe zu Ausgabe immer wieder den Spagat
zwischen anspruchsvollen Themen, die sich Ingenieure wünschen, und leicht
verdaulicher Kost für fachlich nicht ganz so Bewanderte auszubalancieren.
Auch Selbstbauwillige und Konsumenten fertiger Produkte, eingefleischte
Theoretiker und gestandene Praktiker, KW-Fans und UKW-Enthusiasten
haben jeweils unterschiedliche Interessenschwerpunkte. Daher bitten wir
um Verständnis, wenn Ihnen manch ein Beitrag nicht gefällt − anderen sagt
er vielleicht umso mehr zu. Angesichts der großen Seitenzahl sollte übers
Jahr hinweg für jeden genug Lesestoff dabei sein.
Aus den von unseren Hobbyautoren eingehenden Manuskripten sowie
Leseranfragen schließen wir, dass Antennen einen ganz hohen Stellenwert
einnehmen. Was den Selbstbau von Amateurfunkgeräten betrifft, erreichen
uns nicht selten Beschreibungen umfangreicher Projekte, die von OM Normal-
verbraucher schwer umsetzbar sind. Dennoch sind wir froh darüber, da sie den
Stand der Technik repräsentieren, der im FUNKAMATEUR als einer der auf-
lagenstärksten Amateurfunkzeitschriften weltweit ein Zuhause hat.
Was indes Mangelware ist − wir sehen es gleichsam an dem ebenfalls in unse-
rem Hause verlegten QRP-Report und bei fremden Druckerzeugnissen −, sind
kleine Nachmittags- oder Wochenendprojekte. Scheuen Sie sich nicht, ent-
sprechende Ideen in einem Beitrag an andere Leser weiterzugeben. Unsere
Manuskripthinweise auf www.funkamateur.de → „Schreiben für uns“ haben
wir aktualisiert, um auch weniger geübten Schreibern die Scheu zu nehmen.
Beim Feinschliff der Texte helfen unsere versierten Redakteure sowieso und
selbst eine kleine Platine entwerfen wir schon gelegentlich, um einen Beitrag
abzurunden.
Für das kommende Jahr sehe ich spannende Projekte kommen, so etwa
mit dem u. a. bei Reichelt Elektronik erhältlichen universellen Messsystem
Red Pitaya, das bis 50 MHz arbeitende ADUs und DAUs auf der Platine mit-
bringt. Zudem ist die SDR-Technologie mittlerweile so weit fortgeschritten,
dass Frequenzen bis etwa 6 GHz direkt umgesetzt werden können! Selbst
wenn das vorerst nur mit 8 Bit Auflösung (Stichwort „Hack RF“) und folglich
stark eingeschränktem Dynamikbereich geschieht, zeichnen sich Anwendun-
gen ab, die bisher kaum zu verwirklichen waren.
Apropos: Dank preisgünstiger Surplus-Baugruppen für 9 cm und 6 cm erlangt
das HAMNET als tendenziell notfunktaugliches Informationsnetzwerk zu-
nehmend bundesweite Verbreitung, sodass wir unser Augenmerk verstärkt
darauf legen werden. Für die mit PC und Mikrocontrollern weniger Vertrauten
haben wir einiges an Analogtechnik in Planung, darunter einen neuartigen
2-m-FM-Transceiver, der im Berliner Raum entwickelt wurde, und jede Menge
Antennentechnik.
Es bleibt also rundherum spannend − schauen Sie, mit welchen interessanten
Themen wir Sie im neuen Jahr überraschen.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chefredakteur
Plug-and-play im Amateurfunk?
Viele von uns erinnern sich bestimmt noch an frühere Storys von betagten
OMs, die berichteten, wie sie aus einem Päckchen Aluminiumschrott der
NVA oder der US-Army an einem Wochenende einen Beam gebastelt haben.
„Das Ding ging wie verrückt, ZS6 auf Anhieb mit 59+, da war noch nicht mal
das SWV eingestellt.“
Aber warum hat die Antenne aus dem Schrottcontainer so gut funktioniert?
Weil besagter Erfolgsfunker sich zuvor die Zeit genommen hatte, in Antennen-
büchern nachzulesen, wie es geht. Das war seinerzeit so selbstverständlich,
dass es gar nicht weiter erwähnt wurde. Damals bestand das Antennenbauen
aus Bohren, Sägen, Feilen, Lernen, Lesen, Testen. Was Außenstehenden
manchmal als Spinnerei erschien, war die praktische Umsetzung des theore-
tischen Wissens, das sich Funkamateure autodidaktisch angeeignet hatten.
Betriebsanleitungen hat allerdings auch damals schon kaum jemand gelesen.
Der viel zitierte Hinweis „RTFM!“ (deutsch: „Lies das verdammte Handbuch!“)
stammt laut Wikipedia aus dem Jahr 1979 und gilt sinngemäß schon viel länger.
Heutzutage kauft der anspruchsvolle und erfolgsverwöhnte Funkamateur etwas
Modernes, vielleicht einen Ultra- oder einen SteppIR-Beam. Im Selbstbau ist
so eine Hightech-Antenne längst nicht mehr zu realisieren. Doch wie schnell
ist bei der 48-poligen Schrittmotor-Kabelei rot-weiß mit grün-weiß oder links
mit rechts vertauscht und schon funkt es bereits bei der Inbetriebnahme ...
Nachlesen, Nachdenken und Nachschlagen waren früher und sind auch heute
keine Schande. Dennoch erwarten viele, dass dank „Plug-and-play“ alles
sofort läuft – so suggeriert es schließlich die Werbung. Und was, wenn die
Wirklichkeit anders aussieht? Der zeitgemäße Kunde fragt sich nicht etwa,
was er falsch gemacht haben könnte, sondern ruft erst einmal um Hilfe:
Auf dem Band? Da ist ja niemand ... Also wird sofort der Händler oder Bausatz-
lieferant angerufen und vorsichtshalber schon einmal auf Rückgabe und
Widerruf inklusive Hinzuziehung des Anwalts gepocht, wenn der Techniker
nicht sofort ans Telefon kommt.
Und dabei ist doch alles gar nicht so schwer, sehen wir einmal von abstrusen
Fällen ab, wo das zweiseitige, 28-sprachige Anleitungsblättchen in so winziger
Schrift daherkommt, dass nicht einmal eine starke Lupe weiterhilft. Seriöse
Anbieter legen ihren hochwertigen Produkten im Normalfall eine aussage fä hige
Anleitung bei, sei es nun in Papier- oder digitaler Form. Ein Fertig pro dukt (oder
einen Bausatz) zu kaufen bedeutet ja nicht, alles ad hoc zusam men bauen,
installieren und bedienen zu können.
Wer von seinem 20 Jahre alten Golf auf eine frisch aus dem Werk rollende
Karosse umsteigt, wird sich wohl tunlichst erst einmal mit der Bedienung
vertraut machen – warum also nicht genauso im Amateur- oder Hobbyfunk?
Andere Zeiten – andere Sitten. Doch eines bleibt: Die Götter haben vor den
Erfolg den Schweiß gesetzt. Anspruchsvolle Technik oder ein Bausatz erfordern
genauso ein tiefes Eindringen in die Materie wie früher der Eigenbau − wenn-
gleich auf einer anderen Ebene.
Bitte nutzen Sie zunächst die vom Lieferanten mitgegebenen Arbeitsmaterialien,
Fachliteratur, FAQ-Seiten im Internet usw. oder fragen Sie einen fachkundigen
befreundeten Funkamateur. Erscheint ein Anruf dennoch unumgänglich,
bedenken Sie: Am anderen Ende der Telefonleitung ist auch nur ein Mensch,
der vielleicht gerade zum zigsten Mal aus hochkonzentrierter Arbeit heraus-
gerissen wird und spontan eine Frage zu einem völlig anderen Thema beant-
worten soll.
Wolfgang Schmenger, DB6WY
Feinste Technik auf der IFA
Die diesjährige IFA ist Vergangenheit, doch die auf ihr gezeigten Neuheiten
werden bis zur nächsten (28. 8. bis 2. 9. 15) das Interesse des Konsumen-
ten finden. In diesem Jahr vergrößerte sich die Ausstellungsfläche mit
der neuen Mehrzweckhalle (City Cube) um 3 % auf 149 500 m2 und war
laut Messe Berlin mit 1538 Ausstellern (+3 % gegenüber dem Vorjahr)
voll belegt. Der Markt der Unterhaltungselektronik mit deren zahlreichen
Facetten wuchs im ersten Halbjahr 2014 um 1,9 %, der der elektrischen
Hausgeräte dagegen um 4,1 %, und das wurde auch auf dem Messe-
gelände deutlich: Die Weiße Ware dominierte.
Einen deutlichen Qualitätssprung gab es bei der Bildwiedergabe: Ultra-
hochauflösende (UHD) Displays mit über 2,5 m Diagonale, die winzigste
Strukturen der Bildinhalte sichtbar machen, sind marktreif. Sie wurden
mit Programminhalten präsentiert, die auch feinste Details enthielten:
atemberaubende Landschaften, höchstaufgelöste Großstadtpanoramen,
auch Zeitraffersequenzen, um die Reaktionsschnelligkeit der neuen Dis-
plays zu demonstrieren. Hier fehlten leider Alltags-Fernsehprogramme,
die in der Regel in Standardauflösung, bestenfalls in Full-HD, gesendet
und erst im TV-Gerät in eine höhere Auflösung hochgerechnet werden.
UHD-Programmquellen für diese schicken Geräte gibt es kaum. Geeignete
Internetvideotheken sind noch im Aufbau und die benötigen für das
Streamen von UHD-Inhalten schnelle und leistungsfähige Netze, die in
größerem Maße erst noch zu bauen sind. Blu-Ray-Discs bleiben unterhalb
der 4K-Auflösung, auch hier wird der Bildinhalt erst hochgerechnet.
Tröstlich ist, dass die Hersteller dieser schönen neuen Fernsehgeräte
unisono versichern, wie zukunftssicher ihre Produkte seien und dank der
Schnittstellen problemlos mit künftigen UHD-Receivern und -Speichern
kommunizieren würden.
Die Fraunhofer-Gesellschaft demonstrierte im TecWatch-Forum HD-, UHD-
und 3-D-Bilder synchron: 3-D (ohne Brille) war gut zu erkennen, doch die
HD- und UHD-Bilder blieben in 2 m Entfernung praktisch ununterscheidbar,
und wer sieht schon aus 30 cm Nähe auf das Fernsehbild?
Marktwirksam sind bereits Fernsehgeräte mit konkav gewölbtem Bildschirm,
selbst mit Fernsteuerung der Krümmung. Hier versprechen die Hersteller
einen erhöhten Sehkomfort, da das Bild größer erscheine, als es ist, und
jetzt − endlich − auch die Inhalte an den Bildrändern erkennbar wären.
Wie war das nur früher, als die Bildröhre eine konvexe Krümmung aufwies?
Die Bedienung der Haustechnik mithilfe des Smartphones ist, wie gezeigt
wurde, besonders für das „intelligente Haus“ von Bedeutung: Haustechnik
und Unterhaltungselektronik wachsen zusammen, was auch zu Kuriositäten
führt: Braucht man wirklich ein Smartphone mit passender App, um sich
einen Kaffee zuzubereiten oder die kleidsamste Barttracht auszuwählen?
Der technische Fortschritt, auf der IFA hör- und sichtbar präsentiert, ist
großartigen Ingenieurleistungen zu verdanken, doch fragt man sich bei
manchen Exponaten, ob der Nutzen den Aufwand wirklich rechtfertigt.
Das war jedoch in der 90-jährigen Geschichte der IFA nie anders, und
dennoch begleitet sie von jeher richtungweisende Innovationen.
Wolfgang E. Schlegel
Wir brauchen Klubstationen
Die Ham Radio 2014 ist seit knapp zwei Monaten Geschichte, doch wirken
einige der Vorträge und Veranstaltungen sicher nicht nur bei mir nach.
So haben mich neben interessanten Fachvorträgen die erfrischend offenen
Worte junger Nachwuchsfunker während der Eröffnungsveranstaltung
besonders beeindruckt.
Dass bei dieser Gelegenheit der umworbene Funkernachwuchs einmal selbst
zu Wort kam und an so prominenter Stelle ungeteilte Aufmerksamkeit fand,
hat mir gut gefallen.
Ein dabei hervorgehobener Aspekt war der Wunsch nach eigenen Klub-
räumen mit einer dort installierten Klubstation. Jugendliche Funkamateure
erleben die Faszination unseres technisch orientierten Hobbys am liebsten
in der Gemeinschaft und weniger gern als Einzelkämpfer in der stillen
Hobby ecke, wo es in aller Regel an Messmitteln, Funktechnik und Antennen
mangelt.
Ob weltweiter Funkverkehr auf Kurzwelle über eine leistungsfähige Dach-
antenne, gemeinsames Elektronikbasteln, Experimente mit HAMNET, die
Vorbereitung von Ballonstarts oder der intensive Erfahrungsaustausch
mit langjährig erfahrenen Funkamateuren: Dies sind nur einige von vielen
weiteren Argumenten für die gemeinsam betriebene Klubstation als regel-
mäßiger Treffpunkt.
Aus eigener Erfahrung weiß ich allerdings, dass die Gründung einer neuen
oder selbst das Am-Leben-Erhalten einer jahrzehntelang bestehenden Klub-
station heute nicht leicht ist. Was sich früher vielleicht noch auf dem „kleinen
Dienstweg“ vereinbaren ließ, um etwa ungenutzte Räume in einem öffent-
lichen Gebäude für unsere Zwecke belegen zu dürfen und dort u. a. eine
Amateurfunk-Arbeitsgruppe für interessierte Schüler einzurichten, scheitert
heute nicht selten an allerlei Verordnungen und Sicherheitsbedenken.
Hinzu kommen aus dem eigenen Klubbudget nicht mehr finanzierbare Mieten
und/oder vielleicht störrische „Entscheider“ in der Verwaltung, die den Wert
unserer Aktivitäten für das Wecken von jugendlichem Interesse an Technik
nicht zu erkennen vermögen − entgegen allen Erklärungen und positiven
Berichten in der Lokalpresse.
Trotz alledem heißt es, nicht aufzugeben, denn unser Amateurfunk lebt von
der Gemeinschaft. Nicht nur auf den Bändern, sondern zusätzlich bei regel-
mäßigen, auch für den Funkernachwuchs interessanten Treffen in einer Klub-
station. Und dies bitte zu möglichst jugendfreundlichen Zeiten.
Dabei gestehe ich eine gehörige Portion Eigeninteresse: Einerseits soll unser
fesselndes Hobby für Neueinsteiger − übrigens gleich, welchen Alters–
attraktiv bleiben. Eine gut ausgestattete Klubstation in eigenen Räumen
wäre ein schönes Aushängeschild. Sozusagen eine Visitenkarte unserer
Möglichkeiten − auch gegenüber einer zwar ständig mit dem mobilen
Internet verbundenen, aber dessen ungeachtet gegenüber allen Antennen
skeptischen Öffentlichkeit. Mit einer in eigenen Klubräumen betriebenen
Notfunkstation hätten wir zudem einen publikumswirksamen Trumpf in der
Hand, der für positives Interesse sorgt.
Andererseits geht es mir wohl wie vielen anderen urbanen Funkamateuren,
die mit einem hohen elektrischen Störpegel bei gleichzeitig eingeschränkten
Antennenmöglichkeiten konfrontiert sind. Neben dem verstärkten Portabel-
betrieb ist der gemeinsame Betrieb einer Klubstation abseits potenzieller
Störquellen ein Weg, der mitunter frustrierenden Störsituation am heimischen
Standort zu entgehen. Und damit nicht zuletzt ein Ansporn, dem Hobby treu
zu bleiben.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Neues Band, neues Glück
Pünktlich zur Ham Radio kam von der BNetzA die Ankündigung, dem
Amateurfunkdienst in Deutschland zunächst für einen Zeitraum von zwei
Monaten ein 30 kHz breites Segment im 4-m-Band zuzuweisen. Diese
Entwicklung ist als großes Verdienst der Mitarbeiter im Referat für
Frequenzmanagement des DARC e.V. zu würdigen.
An erster Stelle ist Uli Müller, DK4VW, für seinen Einsatz bei den mit viel
Fingerspitzengefühl geführten Verhandlungen mit den zuständigen Stellen
zu danken. Die Redaktion des FUNKAMATEURs hatte während dieser
Verhandlungsphase stets bei allen Beteiligten das Ohr auf der Schiene,
doch voreilige Veröffentlichungen hätten der Sache nur geschadet.
Und nun? Ist die DX- und Länderjagd in allen Facetten eröffnet? Jein, denn
bei aller Begeisterung und Freude sollten wir daran denken, dass uns (wie
schon auf 6 m) die Bundesnetzagentur strenge Auflagen für den Betrieb
auf 70 MHz mitgegeben hat. Und wir tun gut daran, uns an diese zu halten.
Die Details lesen Sie in dieser Ausgabe des FUNKAMATEURs. Unser
Verhalten, nicht nur auf dem „neuen“ 4-m-Band, wird von der Aufsichts-
behörde genau beobachtet. Weder DX-Cluster-Meldungen über das erste
EME-QSO auf 4 m oder Berichte über TEP-Verbindungen nach Südafrika
sind da hilfreich noch entsprechende QSO-Versuche.
Trotzdem geben uns die Perseiden in der zweiten Augustwoche die
Möglichkeit, unserem Auftrag gerecht zu werden: Nämlich Ausbreitungs-
phänomene im 70-MHz-Bereich zu erkunden, sie für Funkverbindungen zu
nutzen und zu dokumentieren. Die ausklingende Es-Saison dürfte ebenfalls
interessante Verbindungen zulassen. Insofern ist der uns zugestandene
Zeitraum für den Versuchsbetrieb ein Glücksfall.
Der uns von der Genehmigungsbehörde gewährte Freiraum hinsichtlich der
Selbstregulierung ist ebenfalls nicht außer Acht zu lassen. Obwohl prinzipiell
Aussendungen mit einer maximalen Bandbreite von 12 kHz zulässig sind,
sollten wir uns auf die Schmalbandsendearten beschränken.
Selbst wenn Ihr Transceiver auf 70 MHz FM „kann“, ist im Interesse anderer
Nutzer des neuen Bandes der Verzicht auf FM-Verbindungen angebracht.
Zudem ist es kaum sinnvoll, darüber zu streiten oder sich zu beschweren,
ob nun ausschließlich horizontale Polarisation und 25 W EIRP bei uns
Begeisterung hervorrufen. De jure stehen diese Vorgaben in einem Gesetz,
an das wir uns zu halten haben.
Im Zusammenhang mit der neuen Zuweisung an unseren Funkdienst sollten
wir eine, wie ich finde, sehr erfreuliche Nachricht in den Vordergrund rücken:
Es ist gelungen, für die kommende WRC 2015 in Genf Zuteilungen im
6-m- und 4-m-Band im Frequenzzuweisungsplan als Sekundärzuweisung
an den Amateurfunkdienst in einem Arbeitspapier zu beantragen.
Den dies unterstützenden Fernmeldeverwaltungen sei an dieser Stelle
ausdrücklich dafür gedankt. Denn es ebnet uns den Weg zu großzügigeren
Rahmenbedingungen bei der Nutzung dieser Frequenzbereiche. Erneut
ist das Engagement von DK4VW als einem der für diese Initiative feder-
führenden Wegbereiter hervorzuheben.
Der FUNKAMATEUR erweitert nun die Topliste im UKW-QTC um das
4-m-Band. Gewertet werden QSOs aus dem geophysikalischen Jahr 1956,
als es schon einmal Zuweisungen an den Amateurfunkdienst auf 6 m und
4 m gab, sowie für 4 m seit dem 2. Juli 2014.
Die Redaktion wünscht allen Experimentalfunkern auf 70 MHz gl es gd dx!
Peter John, DL7YS
Amateurfunk und Selbermachen
Wenn diese Ausgabe erscheint, sind es nur noch wenige Tage bis zur
Ham Radio und Maker World in Friedrichshafen. Dagegen ist die welt-
größte Amateurfunkmesse 2014 − Hamvention in Dayton/Ohio − bereits
Geschichte und wir vermitteln Ihnen auf unseren Marktseiten sowie im
QRP-QTC einige Eindrücke.
Das Leitmotiv jener Veranstaltung lautete „Makers…The Future of Ham
Radio“. Hoppla, fehlt da nicht etwas? Freilich sehen auch wir im Selber-
machen für die Zukunft eine tragende Säule des Amateurfunkdienstes.
Andererseits ist doch insbesondere der Selbstbau unserem Amateurfunk
von Anbeginn wesenseigen!
So führte in den Gründerjahren an der Notwendigkeit, praktisch alles selbst
zu bauen, ohnehin kein Weg vorbei. Das hat sich mittlerweile geändert,
doch der Experimentalcharakter und damit das Selbermachen ist jederzeit
d a s herausragende Merkmal des Amateurfunkdienstes gewesen und
wird es weiterhin sein. Einer vielleicht vorübergehenden Modeerscheinung,
die über einen großen Teich geschwappt kommt, bedarf es dazu nicht.
Zwar hat sich der Charakter des Selbermachens über die Jahrzehnte hinweg
dramatisch gewandelt. Einen kompletten Stationstransceiver jedoch
wird heute kaum noch jemand im heimischen Shack fertigstellen können,
von Ausnahmen wie den bewundernswerten Enthusiasten, die einen „Solf“
zum Spielen bringen, einmal abgesehen.
Selbst der oft gescholtene sogenannte „Steckdosenamateur“ hat alle
Hände voll damit zu tun, sämtliche Komponenten seiner Station optimal
zu konfigurieren. Die Installation der funkunterstützenden Software auf dem
PC und die Herstellung der Verbindungen zur Funk-Hardware verlangen
ihm ebenfalls einiges ab.
Zudem hängen sich ja gekaufte Antennen keinesfalls von alleine auf. Wer
dann noch einen industriell hergestellten Azimut-Elevations-Rotor installiert
und ausrichtet, eine Antennengruppe daran montiert und austariert sowie
über ein wiederum gekauftes Interface samt fertiger Software eine PC-
gestützte Nachführung der Antenne zu Himmelskörpern oder Raumfahr-
zeugen zum Laufen bekommt, blickt auf das Ergebnis eines schönen
Stücks eigener Arbeit.
Selbst wer tiefer in den Selbstbau im engeren Sinne eindringt, ist heute
zwingend auf kommerzielle Unterstützung angewiesen. Denn hochmoderne
Bauelemente sind in Einzelstückzahlen kaum noch zu bekommen und
von „OM Normalverbraucher“ erst recht nicht aufzulöten. Bausätze von
Elektor, ELV, Franzis und nicht zuletzt von uns machen qualifizierten Selbst-
bau im dritten Jahrtausend in der Breite überhaupt erst möglich! Hierbei
übernehmen Versender wie Conrad oder Reichelt (Letzterer übrigens
dieses Jahr auf der Maker World vertreten) eine maßgebliche Rolle, denn
die früher in jeder Kleinstadt präsente „Radio-Quelle“ gibt es ja längst
nicht mehr.
Selbermachen − was wir durchaus auf gut Deutsch sagen können − gibt es
im Experimentalfunkdienst Amateurfunk also definitiv immer und dabei wird
Sie der FUNKAMATEUR nach wie vor unterstützen!
Wir sehen uns am Bodensee – auf der Ham Radio und selbstverständlich
auch auf der Maker World!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Ham Radio und Maker World: vom Helikopter bis zur Antenne
„Selbstbau“ heißt das Leitthema des diesjährigen Bodenseetreffens der
Funkamateure, das am letzten Juniwochenende in Friedrichshafen die Messe
Ham Radio begleitet. Damit tragen die Veranstalter einer erfreulichen Ent-
wicklung Rechnung, die sich in manchen Ortsverbänden des DARC e.V.,
also an der organisierten Basis, schon länger beobachten lässt.
Dort nimmt der Selbstbau elektronischer Schaltungen, Geräte und Antennen
erkennbar wieder zu. Gestandene Funkamateure bringen ihre Erfahrung ein,
helfen Einsteigern mit praktischen Tipps und Tricks. Sie zeigen dem tech-
nischen Nachwuchs, wie man Schaltungen aufbaut und ggf. Fehler sucht.
Dabei haben alle ihren Spaß und selbst die alten Hasen profitieren davon,
etwa bei Mikrocontroller-Anwendungen, entsprechend dem Motto „Lebens-
langes Lernen“.
Ich sehe dies als Bewegung zurück zur Praxis. Eine Vielzahl von Bausätzen
aus dem Angebot von Händlern wie Pollin, Reichelt, Vellemann und nicht
zuletzt dem FA-Leserservice kommt diesem Interesse entgegen. Zur wei-
teren Unterstützung dienen kleine Mikrocontrollermodule wie PICAXE,
Arduino oder Raspberry Pi, die bei geringem Kosteneinsatz faszinierende
kreative Anwendungen ermöglichen.
Manche Funkamateure blättern die AATiS-Medienliste durch und unter-
stützen den Verein, indem sie dort angebotene Bausätze bestellen. Die
Bandbreite der Angebote reicht von der Mikro-Taschenlampe AS332 mit
Spannungswandler bis zum Geigerzähler AS602/622. Dabei hält nicht nur
der Wunsch nach neuen und pfiffigen Schaltungen an, auch die Anfrage
nach Unterlagen für ältere Bausätze hat stark zugenommen.
Während wir Funkamateure und Hobbyelektroniker seit jeher technische
Tüftler und Bastler sind, hat mit den sogenannten Makern eine weitere
Gruppe die Faszination des Selbstbaus für sich entdeckt. Laut Wikipedia ist
„Maker“ die Bezeichnung für eine Subkultur, die man auch als Do-It-Yourself-
Kultur mit dem Einsatz aktueller Technik beschreiben kann. Also handelt es
sich eher um eine wiederentdeckte denn um eine neue Strömung.
Die Organisatoren der Ham Radio waren daher gut beraten, mit der Ein-
führung der Maker World parallel zur Ham Radio eine zusätzliche Besucher-
gruppe anzusprechen. Beide Veranstaltungen gehen auf dem Messegelände
am Bodensee eine Symbiose ein. Dabei gewinnt das Treffen durch die Ver-
bindung mit der Maker World auch für Funkamateure zusätzlich an Attrak-
tivität.
Gleichzeitig sprechen die Veranstalter ein neues und überaus technikaffines
Publikum an, das bei dieser Gelegenheit die Möglichkeiten unseres Amateur-
funkdienstes kennenlernt und sich vielleicht dafür begeistert. Ich rechne
damit, dass beide Gruppen rasch zueinanderfinden werden, unterstützt
durch die Ausrichtung der Veranstaltungen in benachbarten Hallen und mit
jeweils für beide Angebote geltenden Eintrittskarten.
Die Ham Radio ist mit dem großen Technikflohmarkt, den technisch orien-
tierten Vorträgen des Bodenseetreffens und der für alle Interessenten
offenen Lehrerfortbildung bereits gut für das Thema Selbstbau aufgestellt.
Hinzu kommen nicht zuletzt die Angebote an den Ständen von DARC,
AATiS, FUNKAMATEUR und weiteren, aber auch das Treffen im Ham Camp.
Wolfgang Lipps, DL4OAD
Vom Bastler zum Hardware-Hacker
Transceiver haben heute oft mehr Knöpfe als eine PC-Tastatur und halten
dazu etliche weitere Einstellungen im Menüsystem bereit. Andere Produkte,
wie Funkzubehör, Fernseher, Telefone oder gar Küchengeräte machen da
keine Ausnahme. Sie bieten eine Funktionalität und Anpassbarkeit, die zuvor
undenkbar war.
In einem heute für weniger als 10€ erhältlichen WLAN-USB-Stick stecken
ein Gigahertz-Sende-Empfänger sowie Bandspreiz- und Verschlüsselungs-
technologie, die noch Anfang der Neunzigerjahre 19-Zoll-Schränke füllten
und Militär oder Geheimdiensten vorbehalten waren.
Als Folge solcher Funktionsaufrüstung von Fertiggeräten war es zuletzt um
die Nachwuchsgewinnung im Funk- und Elektronikbereich schlecht bestellt.
Nahezu alles war bereits fertig bzw. mit einer Ausstattung erhältlich, die den
Eigenbau und oft genug ebenso das Technikverständnis überforderte.
Der Selbstbau reduzierte sich daher eine Zeit lang auf solche Gebiete, die der
Industrie entweder nicht lohnenswert oder aus Haftungsgründen bedenk lich
erschienen. Etwa die Konstruktion von elektronischen Türschlössern, Feuer-
werks-Fernzündungen oder HF-Endstufen aus kostengünstigen Bauteilen.
Derzeit etabliert sich jedoch eine neue Generation von Selbstbauern. Sie
nennen sich nicht mehr Bastler, sondern Hardware-Hacker oder Maker.
So wie vormals integrierte Schaltkreise den Selbstbau wesentlich erleich-
terten, greifen die Praktiker heute auf fertige Module zu und passen dafür
verfügbare Programmkomponenten den eigenen Bedürfnissen an.
Aus Plattformen wie Basic Stamp, BeagleBoard, Raspberry Pi, Arduino
und dergleichen entstehen zusammen mit Sensoren und Aktuatoren, aber
auch mit fertigen Komponenten wie WLAN- oder DVB-T-Sticks, in kurzer
Zeit eigene Lösungen. Diese brauchen sich hinter denen der Industrie nicht
zu verstecken, sondern können im Gegenteil neue Wege aufzeigen.
Die notwendige Intelligenz und Anpassung an Aufgaben sowie Schnittstellen
erfolgt mittels Software, während sich die Hardwarekomponenten größten-
teils lötfrei verkabeln lassen. Das ist in Zeiten manuell schwer zu verarbei-
tender kleinster SMD-Bauteile eine ganz erhebliche Erleichterung.
Dass diese Bewegung mehr als eine Randerscheinung ist, zeigt sich an der
Reaktion der Industrie: So bietet etwa Intel mit dem Galileo mittlerweile ein
spezielles Arduino-Board an, das mit seinem Prozessor in x86-Architektur
den Brückenschlag zum Standard-PC bietet.
Problematisch ist bisweilen das fehlende Grundlagenwissen: Was passiert
eigentlich in der Hardware oder in den Tiefen einer Software? Aber Hand
aufs Herz: Wer hat sich früher mit dem zweiten Durchbruch eines Transistors
oder den Latch-Up-Effekten von Logik-ICs beschäftigt? Solange es funktio-
nierte, kaum jemand. Oft führten erst hartnäckige Fehler zur Aneignung der
notwendigen Grundlagen.
Heute gibt es wieder viele Seiteneinsteiger, die sich plötzlich mit Widrig-
keiten wie etwa denen einer Funkübertragungsstrecke für Messdaten kon-
frontiert sehen. Dabei finden sie tieferes Interesse an den Grundlagen
und manchmal sogar am Amateurfunk. Die Tüftler setzen sich wieder inten-
siver mit der Technik auseinander, statt nur an der Benutzeroberfläche zu
bleiben. Dieses begrüßenswerte Interesse am Grundlagenwissen bedarf
jeder nur denkbaren Förderung, wozu sich selbstverständlich auch der
FUNKAMATEUR bekennt.
Ulrich Flechtner, DG1NEJ
Jetzt umsteigen
„Bitte alle aussteigen, der Zug endet hier.“ Diese Ansage kennen Bahn-
reisende aus dem Effeff. Doch endet nicht nur jeder Zug irgendwann. Auch
für die Bearbeitung und Übertragung von Daten muss man sich alle paar
Jahre nach einem neuen Transport- bzw. Arbeitsmittel umsehen.
Bei vielen unserer Leser sind Computer täglich oder zumindest gelegentlich
im Einsatz. Nicht wenige dieser Rechner arbeiten auf Basis des Betriebs-
systems Windows XP von Microsoft. Dennoch stellt Microsoft nach dem
8. April 2014 für Windows XP keine Sicherheits-Updates mehr bereit. Wie
seit Langem angekündigt, endet gleichzeitig die Unterstützung für das mitt-
lerweile über zwölf Jahre alte Betriebssystem.
Lediglich die XP-Version der Antiviren-Software Microsoft Security Essentials
erhält für weitere 15 Monate frische Antiviren-Signaturen. Oft bessere Viren-
scanner anderer Anbieter wollen ebenfalls noch eine Weile XP unterstützen.
Das Werkzeug zum Entfernen bösartiger Software, Malicious Software
Removal Tool, hält der Windows-Update-Mechanismus noch bis Juli 2015
aktuell.
Was also tun? Ein Rechner mit Windows XP ist zwar über den 8. 4. hinaus
nutzbar. Doch wenn nach diesem Stichtag ein Sicherheitsleck im System
publik wird, steht künftig niemand mehr bereit, der es an einem der nächsten
Patch-Days wieder schließt. Das wissen auch die Übeltäter, die genügend
Energie in das Aufspüren solcher Löcher stecken, um entweder an Ihre Daten
zu kommen oder Ihren Rechner gar für kriminelle Zwecke zu missbrauchen.
Der Umstieg auf eine neuere Version des Betriebssystems ist also angezeigt.
Viele Anwender werden sich fragen, ob ihr Rechner ein neues Betriebssystem
überhaupt verträgt. Als Antwort darauf haben die Entwickler in Redmond mit
dem Windows 7 Upgrade Advisor sowie dem Windows 8 Upgrade Assistent
zwei Werkzeuge geschaffen, um zumindest abschätzen zu können, ob ein
Wechsel überhaupt möglich ist. Zu diesem bedarf es in aller Regel einer Neu-
installation, die die Chance des längst überfälligen Aufräumens bietet.
Im Fachhandel ist Windows 7 als 32- oder 64-Bit-Version noch bis Ende
Oktober dieses Jahres erhältlich. Die Anforderungen sind bei beiden Varianten
relativ gering, sodass sich selbst ein schon seit einigen Jahren genutzter
Rechner problemlos umrüsten lassen sollte. Allerdings hat Windows 7 ebenfalls
ein Verfallsdatum: Der Support endet 2020. Einige Jahre länger werden
hingegen Windows 8 bzw. das relativ schnell nachgeschobene Windows 8.1
verkauft und gepflegt. Dafür endet frühestens 2023 deren erweiterter Support.
Diese Version des Betriebssystems erfordert jedoch mehr Ressourcen, sodass
man hierfür um den Kauf eines neuen Computers kaum herumkommt.
In Internetforen kursieren zudem Gerüchte, wonach schon bald Windows 9
auf den Markt kommen soll. Damit will Microsoft an den Erfolg des nun in
Rente geschickten XP anknüpfen. Bis es tatsächlich so weit ist, können
aber ebenso gut noch einige Jahre ins Land gehen. Unterdessen erinnert
Microsoft online mit einem monatlich eingeblendeten Hinweisfenster an
das Support-Ende für XP.
Daher gilt: „Sie haben direkte Anschlussverbindungen“ an Windows 7 und
Windows 8. Nutzen Sie diese rechtzeitig! Denn wer in Zukunft mit einem sich
immer weiter öffnenden virtuellen Fenster im mitunter unsicheren Internet
unterwegs ist, sollte sich über „gesundheitliche Schäden“ an seinem Rechner
nicht beschweren.
Ingo Meyer, DK3RED
Besser geht immer: mein ganz persönlicher Contest
Das Streben der Funkamateure nach Vergleich bzw. der Wunsch, erfolg-
reicher zu sein als andere Stationen, ist beinahe so alt wie unser Hobby
selbst. Ob nun in einem Contest über wenige Stunden, einen kompletten
Tag, ein ganzes Wochenende oder in einem Langzeitwettbewerb: Solche
Gelegenheiten treiben uns an und bringen uns ganz nebenbei dazu, die
Effektivität der heimischen Funkstation ständig zu verbessern. Letztlich ist
die Aufnahme in den DX-Century-Club durch das DXCC-Diplomprogramm
ebenfalls nichts anderes als die Teilnahme an einem Langzeitwettbewerb.
Vier Antennen in den Hauptstrahlrichtungen mit acht Endstufen, 16 PCs,
dazu 32 Morsetasten und 64 Tastaturen. Ach ja, Kopfhörer, Transceiver und
Operator brauchen wir ja auch noch. Und einen Anschluss fürs Internet.
Es könnte schließlich sein, dass QRZ.com helfen soll, ein nicht ganz ver-
standenes Rufzeichen aufzuklären. So oder so ähnlich stellt man sich die
übliche Materialschlacht beim Contest vor.
Doch Spaß beiseite. Wie ein Contest tatsächlich abläuft, das weiß ich schon.
Und hin und wieder trete ich selbst an, um an einem KW- oder UKW-Wett-
bewerb teilzunehmen. Nicht so richtig ehrgeizig, sondern nur mit ein wenig
PC-Unterstützung. Gewonnen habe ich erst einen einzigen Funkwettkampf,
das war vor 25 Jahren auf UKW.
An einem ganz anderen Contest nehme ich dagegen bereits seit vielen
Jahren permanent teil. Gemeint ist mein privater „Verbesserungs-Contest“.
Bei jedem wie auch immer gearteten Funkwettbewerb, ob auf KW oder
UKW, kann es aus verschiedensten Gründen Funkverbindungen geben, die
nicht gelingen. Bei denen mir der Rapport im QSB versinkt, beim Locator
die Gegenstation von der Schippe springt, ich auf 160 m den interessanten
Multiplikator eine Stunde anrufe und nicht gehört werde, bis diese Station
im Rauschen verschwindet.
Es gibt etliche Gründe, warum es sich lohnt, an der eigenen Station etwas
zu verbessern. Einer davon ist die Teilnahme an einem Contest. Sie treten
gegen sich selbst an. Und Sie kämpfen gegen den inneren „Schweinehund“:
Klar, der aktuelle Aufbau hat es doch zehn Jahre getan, warum also sollte
ich jetzt einen Vorverstärker für 70 cm zusammenbauen? Nur für die paar
zusätzlichen Funkverbindungen? Lohnt sich der Aufwand überhaupt?
Ich sage Ihnen: Ja, es lohnt sich. Und zwar deshalb, weil es Spaß macht.
Wie bei einem „richtigen“ Contest, bei dem während des Wettbewerbs
die QSO- oder Multiplikatorenzahl kontinuierlich steigt, so merken Sie Ihrer
Station die Verbesserungen an. Hier eine neue Sende-Empfangs-Umschal-
tung, dort die Umstellung der Station auf störungsfreie Schaltnetzteile, hier
ein Vorverstärker für UKW, dort die Erneuerung der „alten“ Koaxialkabel
durch neue dämpfungsärmere Typen mit hochwertigen Steckern.
Ein weites Feld im Verbesserungswettbewerb sind zudem die Antennen.
Nicht umsonst spricht man von optimierten Yagi-Antennen. Sicher hat
der „alte Strahler“ seinen Dienst getan, aber es geht eben noch besser;
es besteht Optimierungspotenzial.
Nehmen Sie sich also etwas Zeit, schauen Sie sich Ihre Station kritisch an.
Sie werden sehen: Auch Sie können mitmachen, beim allgegenwärtigen
Verbesserungs-Contest.
Viel Spaß beim Optimieren wünscht
Peter John, DL7YS
APRS ist angekommen
Als Bob Bruninga, WB4APR, in den Achtzigerjahren das Automatic Packet
Reporting System (APRS) zu entwickeln begann, betrachtete er es als Hilfs-
mittel für Rettungskräfte, Hilfsorganisationen sowie unterstützende Funk-
amateure. Jederzeit sollte erkennbar sein, wer sich aktuell mit welchem
Status an welchem Ort befindet.
Erste zivile GPS-Empfänger ermittelten Positionsdaten, die über ein modi-
fiziertes AX.25-Protokoll per Funk übertragen und bei den Empfangssta-
tionen auf einer virtuellen Karte dargestellt wurden.
Das APRS-Protokoll verzichtet im Gegensatz zu Packet-Radio auf Punkt-
zu-Punkt-Verbindungen mit Fehlerkorrektur durch Empfangsbestätigungen.
Stattdessen kann jede empfangende Station die Datensätze selbst wieder
ausstrahlen und somit als Digipeater fungieren, was durch die Redundanz
zu einer sehr robusten Übertragung führt.
Anfangs war es ein System für Spezialisten, weil jede Station einen Com-
puter zur Codierung und Decodierung benötigte, ein GPS-Modul teuer
und die Software gewöhnungsbedürftig waren.
Die Attraktivität stieg mit sinkenden Preisen für die Hardware und verbes-
serter Software. Ein bedeutender Fortschritt war zudem die Entwicklung
von Ein-Chip-Trackern, die aus GPS-Daten ein sendefähiges NF-Signal zur
Einspeisung in Funkgeräte liefern. Funkgerätehersteller begannen darauf-
hin, die für APRS notwendige Hardware in ihre Geräte zu integrieren.
Ich erinnere mich noch gut, dass ich als regelmäßiger Wanderer auf neuen
Wegen mit APRS eine Technik gefunden hatte, die vor Anrufen besorgter
Familienmitglieder bewahrte. Im Rucksack lagen Handfunkgerät, GPS-
Empfänger sowie APRS-Tracker mit selbst programmiertem Mikrocon-
troller. Zu Hause lief der PC und zeigte auf einer Landkarte meine aktuelle
Position. Mangels Bären oder vergleichbarer Raubtiere in Deutschland
konnte auch das ängstlichste Familienmitglied aus der Bewegung des
kleinen Symbols schließen, dass es mir gut ging. Zumindest solange kein
Stecker aus der Buchse rutschte und die Akkumulatoren durchhielten.
Bald kamen handliche GPS-Empfänger für die Orientierung von Boots-
fahrern und Wanderern auf, die die Verbreitung der GPS-Technik enorm
beschleunigten. Dies führte zum Aufkommen ganz neuer Hobbys wie dem
Geo-Caching, also der Suche nach in Wald und Flur ausgelegten Dosen
mit kleinen Überraschungen an bekannt gegebenen Koordinaten.
Die Popularität von APRS stieg schließlich derart, dass dem System sein
Protokoll zum Verhängnis wurde. Unvorsichtige Parametrisierung der Ge-
räte führte dazu, dass regelrechte Lawinen von Statusmeldungen durchs
Land rollten. Dies führte vor einigen Jahren zu einer Anpassung, die nun-
mehr die zügige Überleitung der Meldungen ins Internet über Gateways
vorsieht.
Im Internet kann nun jeder auf entsprechenden Websites die Position, die
Bewegung und den Status von Stationen auf virtuellen Landkarten verfolgen.
Spezielle Programme, Geräte oder Einstellungen sind dafür nicht nötig.
Hören Sie doch einmal mit auf 144,8 MHz, dem APRS-Kanal, ob Sie eines
der charakteristischen 1200-Baud-Signale empfangen, oder schauen Sie
auf http://aprs.fi, woher es stammt. Entdecken Sie Wetterstationen und
spüren Sie mühelos den Bewegungen der gerade aktiven Sender nach.
Vielleicht nutzen auch Sie bald APRS − ob mit einem Fertiggerät oder
mit Eigenbauten.
Ulrich Flechtner, DG1NEJ
Übung macht den Meister
Wir Funkamateure haben das Privileg, unsere Funkgeräte und das Zubehör
selbst bauen zu dürfen. Für viele Technikinteressierte macht dies den
eigentlichen Reiz des Amateurfunks aus. Den meisten ist daher der
Umgang mit dem Lötkolben vertraute Routine. Sie wissen aus Erfahrung,
dass Löten zu den wichtigsten Fertigkeiten gehört, die man beherrschen
sollte. Schließlich entscheidet die Qualität der Lötstellen nicht selten über
Funktion oder Nichtfunktion eines Selbstbauprojekts.
Der FA stellt regelmäßig kleine und größere Eigenbauprojekte vor und
bietet einen Teil davon über den Leserservice als Bausatz an. Wir möchten
damit den Selbstbau unter den Funkamateuren und die praktische
Beschäftigung mit der Elektronik fördern. Wer einen Bausatz bei uns kauft,
erhält sämtliche Bauelemente, die Platine und in vielen Fällen auch ein
bearbeitetes Gehäuse. Selbstverständlich gehört stets eine ausführliche
Bauanleitung dazu.
Den Hauptteil der Arbeit beim Zusammenbau macht fast immer das Löten
aus. Die meisten Selbstbauer kommen gut damit zurecht und somit recht
schnell zu einem funktionsfähigen Gerät. Bei Problemen stehen wir gern
zur Unterstützung bereit: im Bedarfsfall prüfen wir zugeschickte Bastel-
projekte und setzen sie instand.
Oft stellt sich bei dieser Gelegenheit heraus, dass bereits das Nacharbeiten
von verdächtigen Lötstellen ausreicht, um den Bausatz „zum Spielen“ zu
bringen. Besonders fiel uns das beim FiFi-SDR-Bausatz auf: In etwa 90%
der Fälle waren missglückte Lötstellen die Ursache für die Fehlfunktion.
Bei solchen Gelegenheiten zeigt sich, dass der Umgang mit dem Lötkolben
eine handwerkliche Fertigkeit ist, bei der es einiges zu beachten gilt.
Es fängt beim richtigen Material und Werkzeug an, setzt sich über die
Temperatureinstellung des Lötkolbens fort und verlangt nicht zuletzt
manuelles Geschick. Es braucht Grundkenntnisse und viel Übung, um
gute Arbeitsergebnisse zu erzielen. Das gilt übrigens völlig unabhängig
davon, ob bedrahtete oder SMD-Bauelemente verarbeitet werden.
Gute Fachliteratur zum Thema Löten ist leider rar. Da wir in Leserzuschriften
oft gebeten werden, auf dieses Themengebiet einzugehen, beginnen wir
in dieser Ausgabe ab Seite 44 mit dem Abdruck einer längeren Beitragsserie,
die von Norbert Graubner, DL1SNG, verfasst wurde.
Er ist einer unserer fähigsten Bausatzentwickler und verfügt über fundier-
tes Fachwissen sowie einen großen Erfahrungsschatz zum Thema Löten.
Wir hoffen, dass die beschriebenen Fakten und Zusammenhänge sowie
die Vielzahl an Tipps dazu beitragen, Eigenprojekte künftig noch sicherer
erfolgreich abzuschließen und damit folgerichtig die Freude am Hobby zu
vergrößern.
Was gibt es schließlich Schöneres als ein selbst gebautes Gerät, das ein-
wandfrei funktioniert und auch noch gut aussieht? Wir werden auch in
Zukunft das Unsrige dazu beitragen und ein reichhaltiges Angebot an
Bausätzen zur Verfügung stellen – nicht zuletzt, damit Sie auch beim Löten
in der Übung bleiben.
Ihr Peter Schmücking, DL7JSP, FA-Leserservice
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Vom AC 1 bis zum SDR und weiter
Wir spüren es täglich: Ob Fernsehen, Mobiltelefon, Foto- und Videokamera
oder Navigationsgerät − moderne Digitaltechnik ist aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken. Das ist in unserem gemeinsamen Hobby nicht anders:
Es begann in den Siebzigern mit Digital-ICs, deren interne Schaltung man noch
nachvollziehen konnte. Beim Frequenzzähler mit höher integrierten Schalt-
kreisen gelang es nur noch wenigen, sich deren interne Transistorstruktur
vorzustellen. Durch das Aufkommen von Mikrocontrollern wurde alles noch
komplexer. Mit den Prozessoren kam der PC ins Shack − von den einen zu-
nächst als Teufelswerk verdammt und von anderen sogar selbst gebaut:
Die Veröffentlichung der Bauanleitung zum Amateurcomputer AC 1 begann
exakt vor 30 Jahren im FA!
Dann kam das Internet, dem der Ruf vorausging, unser Hobby kaputtzumachen.
Heute nutzen wir u. a. E-Mail, DX-Cluster, LoTW, Clublog, Reverse-Beacon-
Netzwerk, QRZ-Datenbank und Echolink. Die weltweite Vernetzung hat den
Amateurfunk in einer Weise bereichert, von der wir vor 20 Jahren nicht einmal
zu träumen wagten. Weiteren Aufwind erfuhr unser Hobby u. a. durch Stations-
automatisierung (CAT), Transceiver-Fernsteuerung (Remote) und SDR bis hin
zum Web-SDR (S. 1285).
Das offenbarten selbst die dem Thema DX gewidmeten Begleitveranstaltungen
der 2013er-Ham Radio. Da ist es noch weniger auszudenken, welche positiven
Effekte vom mobilen Internet ausgehen werden, das auf dem Gebiet des Ama-
teurfunks erst zaghaft den Kinderschuhen entwächst.
Die Redaktion FA ist stolz darauf, diese digitale Revolution im Hobbybereich
seit der ersten „Elbug mit Dünnschicht-Hybrid-Schaltkreisen“ in FA 1/73 von
(nunmehr) DL6JGN bis heute begleitet und ihr Impulse verliehen zu haben. So
verschafften die FA-SDR-Kits, der FA-SDR-TRX und das FiFi-SDR als Bau satz-
projekte in den vergangenen Jahren zahlreichen bastelnden Funkamateuren
einen hautnahen Zugang zur Technik des softwaredefinierten Radios.
Und mit der Vorstellung von DB1CCs HiQSDR-Bausatz haben wir in FA 2/13
die Leserschaft an ein nachbaubares SDR der jüngsten Generation (Direkt-
abtast-Transceiver) herangeführt. Wie Digitaltechnik selbst den analogen FM-
Funk bereichern kann, demonstrierte DC7GB mit seinem Subton-Telemetrie-
Verfahren (FA 8 und 9/13), das auf der Weinheimer UKW-Tagung auf großes
Interesse stieß.
Ich verspreche Ihnen, dass es spannend bleibt, kann mir jedoch vorstellen,
dass diese „digitale Vielfalt“ dem einen oder anderen Leser nicht behagt.
Aber natürlich werden wir auch weiterhin konventionelle analoge Schaltungs-
technik präsentieren, wie etwa das in dieser Ausgabe begonnene Bausatz-
projekt 50-W-Linearendstufe oder demnächst einen großsignalfesten Anten-
nenverstärker für die Lowbands. Auf Elektronikfans wartet u. a. bald ein über-
wiegend analog aufgebauter Fledermausdetektor.
Der FUNKAMATEUR ist von jeher thematisch breit aufgestellt. Das muss
zwangsläufig so bleiben, wenn er weiterhin in gewohnter Qualität produziert
werden, für unsere treuen Abonnenten erschwinglich und der Verkauf über
die Kioske (als einzige deutsche Zeitschrift dieser Art) wirtschaftlich vertretbar
sein soll.
So werden wir wie bisher − mit Unterstützung unserer fleißigen Autoren–
den schwierigen Spagat zwischen einfachen und anspruchsvollen Beiträgen
ausbalancieren und versuchen, der Vielfalt des Funk- und Elektronikhobbys
Rechnung zu tragen. Dass dabei der Einzelne bisweilen Seiten überblättern
wird, lässt sich leider nie ganz vermeiden.
Ihr
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Versorgungssicherheit
Deutschlands Rundfunknetze befinden sich im Umbau: Digitalradio DAB+
erhält zusätzliche Verbreitung, während AM-Sender auf Mittel- und Lang-
welle abgeschaltet werden. Dies hängt miteinander zusammen, denn
die zuständige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rund-
funkanstalten (KEF) will bekanntlich nicht beide Sendewege finanzieren.
Aus streng ökonomischer Perspektive ist das verständlich, auch wenn
ich mit meinen Gebühren lieber AM-Rundfunk unterstütze als etwa teure
Exkursionen öffentlich-rechtlicher TV-Shows auf Urlaubsinseln.
Aus rein programmlicher Sicht ist terrestrisches Digitalradio allerdings
bislang mancherorts ebenso wie die Mittelwelle verzichtbar. Zugegeben:
DAB+ bietet einige zusätzliche Programme und erleichtert den rausch-
freien Empfang von Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur sowie eini-
ger Spartensender. Wirkliche Radiovielfalt bietet mir aber erst Satelliten-
empfang oder Webradio, und das in meist hinreichender Audioqualität.
Im Familienalltag begleitet uns hauptsächlich analoges UKW-Radio.
Abgesehen von Hobbyfreunden, die wie ich gerne Signale entfernter
AM-Sender empfangen und dafür teils erheblichen Aufwand treiben,
kenne ich niemanden, der regelmäßig Mittelwellenradio hört. All dies
scheinen gute Gründe, die Abschaltung des AM-Hörfunks zwar bedauernd,
aber letztlich achselzuckend zur Kenntnis zu nehmen.
Wäre da nicht der Aspekt der Versorgungssicherheit. Dass Stromnetze über
längere Zeit ausfallen können, ist längst nicht mehr ein nur von Bestseller-
autoren aufgegriffenes Thema. Vielmehr befassen sich Spezialisten regel-
mäßig auf Tagungen mit den möglichen Auswirkungen und Maßnahmen.
Dort geht es auch um die noch verfügbaren Kommunikationswege, wenn
aus der Steckdose kein Strom mehr kommt. Nichtstaatliche Hilfsorgani-
sationen, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK), haben ihr zuvor abgeschal-
tetes Kurzwellennetz reaktiviert. In manchen Städten diskutiert die Berufs-
feuerwehr mit Funkamateuren, ob und wie diese beim Ausfall örtlicher
Kommunikationsnetze die Hilfsdienste mit ihrer netzunabhängigen Technik
unterstützen können. Beides schafft mehr Sicherheit, wenn die Stromund
Telefonnetze tatsächlich einmal ausfallen. Die Auswirkungen von nur
zwei Stunden ohne Stromversorgung mussten Ende vergangenen Jahres
die Münchner erfahren.
Auch reichweitenstarke Mittel- und Langwellensender sind ein Sicherheits-
faktor, sollten örtliche UKW- oder DAB+-Sender mangels Stromversorgung
oder Programmzuführung schweigen. Von weiteren Senderabschaltungen
betroffen sind also nicht nur einige Wassersportler, die „weit draußen“
künftig ohne AM-Hörfunk keinen Seewetterbericht mehr empfangen.
Das für den Bevölkerungsschutz zuständige Bundesamt empfiehlt nicht
grundlos in seinen Ratschlägen die Bereithaltung eines batteriebetriebenen
Radios für UKW und Mittelwelle. AM-Hörfunk ist als Informationsmedium
hinsichtlich der Versorgungssicherheit eine wichtige Reserve.
Bislang haben die Verantwortlichen diesen Aspekt in der Diskussion um den
Betrieb von Mittel- und Langwelle nicht erkennbar berücksichtigt, vielleicht
bewusst ausgeblendet. Doch finden in den kommenden Wochen hochrangig
besetzte Kommunikationskongresse statt, auf denen sich dieses
Thema offensiv einbringen lässt. Noch ist es dafür nicht zu spät und uns
Gebührenzahlern sollte die zusätzliche Sicherheit durch AM-Hörfunk auf
Lang- und Mittelwelle die Betriebskosten wert sein.
Harald Kuhl, DL1ABJ
90 Jahre Rundfunk
Am 29. Oktober blicken wir auf 90 Jahre Rundfunk in Deutschland zurück.
Mit dessen Einführung ergab sich eine völlig neue Möglichkeit des un-
beschränkten Informationszugangs. Länderübergreifend konnte man sich
aus unterschiedlichen Quellen und anderen Blickwinkeln informieren.
Welche Bedrohung dies für autoritäre Regimes darstellte, erkannte man
bald daran, dass in Nazideutschland während des Krieges das Hören
ausländischer Sender mit harten Strafen bedroht war. Sogar einige Todes-
urteile wegen der Weiterverbreitung der empfangenen Inhalte wurden
verhängt. Während des Kalten Krieges waren starke Rundfunksender auf
MW und KW eine Möglichkeit, sich unzensierte Nachrichten zu beschaffen.
Regierungen versuchten mit Störsendern, diesen Weg zu unterbinden.
Bei der technischen Entwicklung vergessen wir meist, dass sich innerhalb
kurzer Zeit eine Revolution vollzog. War zu Beginn des Radios noch der
Detektor mit Kopfhörer das Mittel der Wahl, gab es schon 15 Jahre später
Sender mit 100 kW und komfortable, leistungsstarke Superhetempfänger
mit Schwundausgleich sowie Bandbreiteneinstellung und eingebautem
Lautsprecher. Wer ein solches Gerät von 1938 besitzt und restauriert hat,
stellt mit Erstaunen fest, dass sich Empfangsqualität und Trennschärfe
auch heute noch absolut hören lassen können.
Eine weitere Neuerung vollzog sich ebenfalls verblüffend schnell: Zehn
Jahre nach dem Start des Hörfunks konnte man schon mit preiswerten
Radiogeräten am weltweiten Kurzwellen empfang teilnehmen. Für die
damalige Bevölkerung war dieser technische Fortschritt genauso bemer-
kenswert und atemberaubend wie heutzutage für uns die Entwicklung
von Smartphone und Tablet-PC.
Inzwischen gibt es auf KW schon seit Jahren keine großen deutschen Hör-
funksender mehr. Wer auf der Kurzwelle eine deutschsprachige Sendung
hört, kann fast sicher sein, dass es sich um einen ausländischen Dienst
handelt. Weitreichender amplitudenmodulierter Rundfunk auf Mittel- und
Langwelle ist inzwischen hierzulande ein exotisches Phänomen. Bei uns
werden laut aktueller Planung spätestens 2015 die letzten Sender dort
ihren Betrieb einstellen.
Was bleibt, ist UKW-FM, dessen langfristige Zukunft ebenso ungewiss ist.
Eigentlich war seine Abschaltung schon ausgemachte Sache. DAB+ als
Ersatzsystem kann viele Hörer bisher nicht überzeugen. Versuche mit
digitaler Modulation − Stichwort DRM − auf Kurz-, Mittel- und Langwelle
werden eingestellt bzw. nicht weiter ausgebaut.
Bleibt das Internet mit scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten des Infor-
mationszugangs und Zehntausenden von Radiokanälen. Aber hier ist
Euphorie absolut unangebracht. Nicht nur, dass wir erfahren müssen, dass
die Nutzer potenziell und bisweilen auch tatsächlich einer Überwachung
unterliegen. Zudem ist das Sperren und Filtern technisch überall möglich
− nicht nur in Staaten wie China oder Iran…
Aus diesem Blickwinkel erscheint der Amateurfunk in einem ganz neuen
Licht. Gerade Jugendliche meinen, dass unser Kurzwellenfunkverkehr im
Zeitalter des Internets und der Handykommunikation antiquiert sei. Wir
aber können nach wie vor mit einfachen Mitteln länderübergreifende welt-
weite Kommunikation durchführen. Dazu gibt es nun auch Frequenzen im
Mittel- und Langwellenbereich, was früher undenkbar gewesen wäre.
Seien wir stolz auf dieses Privileg und nutzen es intensiv!
Martin Steyer, DK7ZB
Auch mal ans andere Ende einer Funkverbindung
Jeder Funkamateur kam bestimmt schon einmal auf die Idee, selbst
von einem mehr oder weniger begehrten Ort aktiv zu werden. Diplom-
programme wie z. B. IOTA, SOTA und DLFF können Anreize bieten. Die
für die klassische DXCC-Jagd zählenden Gebiete anzusteuern, ist jedoch
ebenso bedenkenswert.
Doch der Aufwand! Ein Großteil der Funkamateure geht davon aus, dass
eine begehrte DX-Station auch immer ein lautes Signal erzeugen muss.
Ergebnis ist eine nicht zu unterschätzende Materialschlacht − auf beiden
Seiten. Bei vielen, die die rare Station erreichen wollen, sind daher dreh-
bare Antennen im Einsatz. Und der Gejagte hat, wenn es die Örtlichkeiten
erlauben, zumindest mit ähnlichem Kaliber aufzuwarten.
Der Aufwand mag zu Hause vertretbar sein, denn man muss die Station
ja nur einmal errichten und nicht bewegen. Anders sieht es beim Technik-
transport zum entfernten Punkt aus. Größere DXpeditionen rufen daher
schon weit im Vorfeld zu Spenden auf, um zumindest einen Teil des finan-
ziellen Aufwands auszugleichen.
Wer Abstriche an der Stärke des ausgesendeten Signals macht, kommt
indes mit viel weniger Material aus. Selbst mit einem relativ kleinen,
„barfuß“ betriebenen Transceiver und einer simplen Drahtantenne lässt
sich einiges erreichen. Andererseits werden Sie erstaunt sein, wie viel
Ausrüstung bei geschickter Auswahl noch mit ins Fluggepäck passt.
Für den, der mit Auto oder Zug unterwegs ist, hat sich das Platzproblem
ohnehin etwas relativiert.
Bleibt nur noch das DXCC-Gebiet, das andere Funkamateure gern er-
reichen möchten. Aus dieser Sicht lassen sich nahezu ganz Europa und
viele besuchenswerte Teile der restlichen Welt ohne Formalitäten akti-
vieren, weil die betreffenden Länder das CEPT-Abkommen unterzeichnet
haben. Und selbst weit entfernte Gebiete wie beispielsweise Chile, Argen-
tinien und Namibia offerieren relativ unkomplizierte und preisgünstige
bzw. kostenlose Wege, mit einer Funkstation einreisen und funken zu
können.
Gut, viele der so ins Visier genommenen Gebiete dürften noch nicht ein-
mal in einer der „Most-wanted-Listen“ auftauchen. Sie werden dessen
ungeachtet erstaunt sein, wie viele Anrufe Sie bekommen, wenn Sie
außerhalb des zahlenmäßig mit Funkamateuren vergleichsweise reich
gesegneten Deutschlands mit einem mehr oder weniger exotischen Ruf-
zeichen(-präfix) aktiv sind. Ein dickes Pile-up lässt sich dort vermutlich
nicht hervorrufen, aber für den Anfang sollte es langen. Gerade das spricht
dafür, eine Funkaktivität im sogenannten Urlaubsstil durchzuführen. So
lassen sich Hobby und Erholung verbinden, wobei das eine das andere
nicht ausschließt.
Es gelingt auch mit wenig Material und Kosten, einmal am anderen Ende
einer begehrten Funkverbindung zu sitzen, ohne Abstriche am Spaß
machen zu müssen. Der Weg dahin ist relativ leicht zu beschreiten!
Ingo Meyer, DK3RED
Elektronik selbst gestalten − so leicht wie nie zuvor
Über Jahrzehnte hinweg dominierte anfangs die Röhrentechnik und später die
Transistortechnik sowohl in der Industrie als auch im Hobbybereich. Erst in den
1970er-Jahren lösten die ersten Schaltkreise die großen und trotzdem relativ
leistungsschwachen Schaltungen ab, die nach und nach auch von Amateuren
verwendet wurden. Manko blieb, dass Änderungen an der realisierten Steuerung
stets einen mühseligen Umbau erforderten.
Radikale Umwälzungen ergaben sich, als Software die "Verdrahtung" der Digital-
baugruppen ablöste und nahezu beliebig flexible Steuerungen möglich wurden.
In der Anfangszeit der Mikrocontrollertechnik hatten Computer im Sinne des
Begriffs die höhere Priorität. Mit den Mikrocontrollern wurden vorrangig Geräte
aufgebaut, die fast ausschließlich der reinen Informationsverarbeitung dienten.
So wurden damalige Computer vorrangig für komplexe Berechnungsverfahren
eingesetzt. Das Interesse vergrößerte sich immer mehr, als Computer auch
für Spiele Verwendung fanden. Parallel zu diesen Anwendungen setzte sich in
der Industrie die Anwendung von Mikrocontrollern in der Steuerungs- und
Regelungstechnik immer mehr durch. Im nächsten Schritt entstanden die ein-
gebetteten Systeme. Mikrocontroller kommen mittlerweile zur Steuerung auch
in nahezu allen Haushaltsgeräten, von der Waschmaschine über den Kühlschrank
bis zum Fernsehgerät zum Einsatz.
Bis Ende der 1980er-Jahre waren dabei Assembler und die Programmier-
sprache C die Standards. Für viele Hobbyelektroniker, die sich zuvor mit Hard-
wareentwicklungen beschäftigt hatten, war das nicht ganz so einfach. Anfang
der 1990er-Jahre entwickelte der Hersteller Parallax die BASIC Stamp. Mit der
Programmiersprache BASIC wurde die Anwendung auch für Hobbyelektroniker
einfacher. Damit kam der Durchbruch. Bereits in den ersten zehn Jahren wurde
die BASIC Stamp über eine Million Mal verkauft und auch im Hobbybereich zur
Steuerung eingesetzt. Das Interesse an diesem Controllerboard ist noch immer
nicht zurückgegangen. Allerdings sind seit Ende der 1990er-Jahre Alternativen
auf Basis der AVR- und heute auch der ARM-Controller hinzugekommen.
Dank der sozialen Netzwerke im Internet haben heute die Arduino-Boards und
das Raspberry Pi als „Mini-PCs“ eine große Verbreitung gefunden. Die Vielzahl
zusätzlicher Peripherieplatinen (Shields genannt), fertiger Programmbibliotheken,
kostenloser Software und Veröffentlichungen im Internet haben das weltweite
Interesse daran gesteigert.
Für einfache Anwendungen sind beispielsweise die Arduino-Boards auf Basis der
8-Bit-Controller optimal. Für komplexe Anwendungen, die mit denen eines PC
vergleichbar sind, ist z. B. das Raspberry Pi eine günstige Lösung. Dort bilden
Linux, Android oder ähnliche Betriebssysteme die Basis. Damit steht Hobby -
elektronikern eine preiswerte Grundlage für eigene Entwicklungen zur Verfügung.
Der Entwicklungsaufwand reduziert sich auf die eigentliche Applikation und da-
mit auf die Software. Allerdings gibt es nicht für alle Anwendungen fertige peri-
phere Baugruppen. Doch selbst mit einem kleinen Zusatz, wie dem in dieser
Ausgabe ab Seite 842 vorgestellten Arduino samt Shield lässt sich mittels Sub-
ton-Telemetrie ein Radiodatensystem für den analogen Sprechfunk realisieren.
Um die Controllerbaugruppe müssen wir uns nicht kümmern. Für eigene Hard-
wareentwicklungen bleibt trotzdem noch genügend Platz. Hier können wir
unserer Kreativität freien Lauf lassen. Und wenn die Idee für viele andere inte-
ressant ist, kann daraus ein neues Arduino-Shield mit weltweiter Verbreitung
entstehen. Beim Arduino müssen wir uns zudem nicht auf die Entwicklungs-
umgebung mit dem C-Compiler beschränken. Der BASCOM-AVR unterstützt
seit einigen Jahren auch die Arduino-Boards. Und die Programmiersprache
BASIC ist weiter für den leichten Einstieg derjenigen geeignet, die noch nie
Software geschrieben haben.
Dr.-Ing. Klaus Sander
Auf nach Friedrichshafen!
Wie in jedem Jahr laden am letzten zusammenhängenden Juni-Wochen-
ende die Messeleitung sowie der DARC e.V. als Veranstalter zur 38. Ham
Radio sowie zum zeitgleich stattfindenden 64. Bodenseetreffen ein.
Nachdem Publikumsmagnet Conrad Electronic 2011 noch vor Messe-
beginn wieder abreiste und seither gar nicht mehr kommt, bleiben 2013
nun auch ein sehr großer und einige kleinere Amateurfunkhändler der
Messe fern. Ohne darüber richten zu wollen, können wir in der Redaktion
eine solche Entwicklung nicht gutheißen.
Dennoch haben wir teilweise Verständnis für die Entscheidung dieser
Händler: Auf der einen Seite stehen die hohen Standgebühren sowie
Personal- und sonstige Logistikkosten. Andererseits beraten die hoch-
qualifizierten Mitarbeiter sehr engagiert ihre potenziellen Kunden, um
dann mit ansehen zu müssen, wie dieselben anschließend zum „Kisten-
schieber“ aus dem In- oder Ausland gehen und ihr Objekt der Begierde
für ein paar Euro weniger ergattern. Eine solche Geiz-ist-geil-Mentalität
kann auf Dauer nicht gut gehen und das Ergebnis sehen wir nun.
Demgegenüber ist die Messeleitung auf Gedeih und Verderb gefordert,
profitabel zu arbeiten. Doch dafür bietet sie ja etwas. Die Neue Messe
weist zweifellos die mit Abstand besten Bedingungen auf, die uns Funk-
amateuren in Europa und Amerika geboten werden: großzügige Park-
möglichkeiten, geräumige Hallen, ein weitläufiger und sinnvoll gestalteter
Außenbereich mit einladenden gastronomischen Einrichtungen, das licht-
durchflutete Foyer mit der Aktionsbühne und nicht zuletzt die zahlreichen
klimatisierten und modern ausgestatteten Vortragsräume unterschiedlicher
Größe. Daytons Hara Arena kann da ebensowenig mithalten wie das
National Hamfest United Kingdom in Newark-on-Trent.
Bleibt noch die Sichtweise der Besucher. Lohnt es sich, angesichts stei-
gender Treibstoff- und Übernachtungskosten noch hinzufahren? Neuheiten
erfährt man mittlerweile schon Wochen und Monate vorher aus dem Inter-
net sowie nicht zuletzt aus dem FUNKAMATEUR. Und Schnäppchen
macht man heute eher vom heimischen PC aus beim einschlägigen Ver-
sandhandel, via eBay, auf Kleinanzeigen-Portalen usw. Das bekommen
auch Flohmarkt-Fans und -Anbieter zu spüren.
Aber ist das alles? Dominiert der Kommerz schon so sehr unser Hobby?
Oder ist es nicht vielmehr vom Messegelände bis zum Campingplatz das
weder durch Funk noch Internet zu ersetzende gesellige Zusammentreffen
mit Gleichgesinnten aus Nah und Fern, das den Reiz eines solchen Events
ausmacht? Der Veranstalter hat erkennbar dazugelernt, organisiert diesmal
wieder eine Ham Night, tut traditionell sehr viel für die Jugend und bietet
eine große Zahl hochkarätiger Vorträge. Alois Krischke dankend auf die
Schulter klopfen, mit Martin Steyer ein Yagi-Problem diskutieren, von
Martti Laine Geschichten vom WC auf dem Scarborough Reef hören und
nicht zuletzt mit dem langjährigen QSO-Partner endlich mal ein Bier trinken
− ist das alles nichts?
Dazu bedarf es jedoch eines passenden und annehmbaren Umfelds, das
man eben in Friedrichshafen vorfindet. Zwar muss man ja nicht jedes Jahr
zur Ham Radio fahren, doch sollten wir Ham Radio nebst Bodenseetreffen
als internationales Highlight im Amateurfunk begreifen, das man sich gele-
gentlich gönnen muss. Es liegt in der gemeinsamen Verantwortung von
Messeleitung, ideellem Träger DARC e.V., Händlern, Vortragenden und
Besuchern, diese langjährige Tradition fortzusetzen!
Awds in FN
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD, Chefredakteur
Mehr Mut zur Innovation
Pessimismus macht sich in Deutschland breit. Mutlosigkeit und Krisen-
sze narien werden gepflegt, Innovationen fehlen. Bürokratie und gut
gemeinte Vorschriften bremsen unser Handeln und damit die Entwicklung
unserer Gesellschaft. Diese Gedanken äußerte 1997 der damalige Bundes-
präsident Roman Herzog in seiner Berliner „Ruck“-Rede.
Das gilt heute genauso, denn diese Entwicklung hat sich fortgesetzt. Nicht
nur Politiker, darunter viele Juristen, Philosophen oder Sozialwissenschaftler,
wollen bestehende Verhältnisse beibehalten. Sie verknüpfen Veränderungen
mit Ängsten.
Bildung wird heute mitunter auf Sprachen, Geschichte, Musik und Religion
konzentriert, während man Naturwissenschaften hintenanstellt. Oder wie
ein Philologe in seinem Buch forderte: „Naturwissenschaftliche Kenntnisse
müssen zwar nicht versteckt werden, aber zur Bildung gehören sie nicht.“
Dabei übersieht man die Ergebnisse, die wissenschaftlich-technische Fort-
schritte erreicht haben. Mit der Bereitstellung großer Energiemengen hat
sich die Entwicklung der Gesellschaft beschleunigt und es gab eine Vielzahl
technischer Neuerungen. Selbst wenn manche Dinge noch nicht optimal
waren, bildeten sie den Ausgangspunkt für weitere Innovationen. Dampfloks
und energieintensive Fernsehgeräte wurden ohne politische Vorgaben ersetzt.
Menschen sind kreativ und innovativ, vorausgesetzt, sie werden nicht
durch einen falschen Zeitgeist gebremst.
Erinnern wir uns: Gleich nach den ersten Versuchen von Marconi und Popow
befassten sich naturwissenschaftlich Interessierte mit dieser neuen Technik.
Das Jahr 1898 gilt damit als Beginn des Amateurfunks. Funkamateure haben
seit dieser Zeit entscheidend zur Entwicklung der Funktechnik beigetragen.
So war der Funkamateur Léon Deloy der Erste, der 1923 auf Kurzwelle bei
2,7 MHz eine Funkverbindung zwischen Frankreich und den USA herstellte.
Bis dahin sendete man in langwelligeren Frequenzbereichen mit weitaus
höherer Leistung. Deloys Erfolg führte zu Fortschritten auch im kommer-
ziellen Funkbereich.
Seit den 1970er-Jahren werden Amateurfunkgeräte seltener selbst gebaut
und hauptsächlich im Handel gekauft. Seit etwa 1990 gibt es im Amateur-
funkbereich immer weniger Nachwuchs. Die heutige Generation nutzt PC
und Internet zur weltweiten Kommunikation. HF-Technik und analoge Elek -
tronik werden kaum noch im Studium vermittelt. Mikrocontroller, Computer
und Informatik sind die Hauptthemen.
Doch bremst dies nicht die Innovationsfreudigkeit der Funkamateure.
PSK31, WSJT, Skimmer und SDR sind nur einige Beispiele für den Einsatz
moderner IT im Amateurfunkbereich. Heute steht uns eine große Auswahl
von Controllerbaugruppen und leistungsfähigen Geräten zur Verfügung,
angefangen von Arduino über Raspberry Pi bis hin zu Smartphones und
Tablet-PCs. Durch moderne Programmiersprachen und offene Quellen ist
die Entwicklung von Software sogar für ideenreiche Programmieranfänger
möglich. In Verbindung mit zusätzlicher Hardware lassen sich innovative
Anwendungen entwickeln. Hier bietet sich für Funkamateure ein weites
Betätigungsfeld.
Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Motivieren Sie Jugendliche zur
Mit arbeit im Amateurfunkbereich. Tragen Sie mit dazu bei, Amateurfunk
und Hobbyelektronik voranzubringen.
Dr.-Ing. Klaus Sander
Selbstbauwettbewerbe auf Amateurfunktagungen
In einer Zeitschrift wie dem FUNKAMATEUR für den Selbstbau zu werben
hieße, Eulen nach Athen tragen. Deshalb möchte ich hier einige zusätzliche
Gedanken einbringen:
Neben der verbreiteten Vorgehensweise, nach erfolgreichem Abschluss
ein Projekt in einem Zeitschriftenbeitrag oder auf der eigenen Website
vorzustellen, bietet sich die Teilnahme an einem Selbstbauwettbewerb
auf einer Amateurfunktagung an. Der Charme solcher Wettbewerbe liegt
im direkten Kontakt mit Gleichgesinnten, die dort ebenfalls ihre Ergebnisse
vorstellen. Durch die Einteilung der Projekte in verschiedene Sektionen
treffen manchmal sehr ähnliche Geräte aufeinander, was einen für alle
Seiten interessanten Erfahrungsaustausch ermöglicht. Außerdem folgen
oft intensive Diskussionen mit Besuchern, die sofort Verbesserungen
oder weitere Anwendungen vorschlagen.
Eine daraus resultierende Weiterentwicklung des Exponates sowie die
spätere Veröffentlichung der Ergebnisse sind ausdrücklich erwünscht.
Zusätzlich bleibt die sportliche Herausforderung, wobei hier auch die
olympische Idee gelten sollte: „Dabei sein ist alles“. Selbst wenn nach
meiner Erfahrung eine Platzierung schwierig ist, denn es sollte ja nur
Sieger geben, mindert dies nicht den Spaß an einer Teilnahme, sondern
weckt einen gesunden Ehrgeiz.
Ich richte seit vielen Jahren den Selbstbauwettbewerb der UKW-Tagung
in Weinheim/Bensheim aus, sowie einige Male den der Amateurfunktagung
in München, und beobachte eine über die Jahre sinkende Teilnahme-
bereitschaft. Über die Gründe kann man nur spekulieren, doch das ist
hier nicht mein Anliegen.
Vermutlich überschätzen potenzielle Teilnehmer den anfallenden Aufwand.
Eine funktionierende, selbst entwickelte Schaltung haben viele Funkama-
teure bzw. Hobbyelektroniker im Keller liegen und erfahrungsgemäß sind
etliche Besucher von Amateurfunktagungen häufig aktive oder zumindest
gelegentliche Selbstbauer. Eine einfache Dokumentation ist schnell erstellt,
denn jeder Entwickler verfügt über Schaltplan und Aufbauskizzen. In Zeiten
der CAD-Programme ist dies ohnehin kein Problem mehr, obgleich handge-
fertigte Skizzen dem Ganzen eine persönliche Note geben.
Im Gegensatz zu einem Zeitschriftenbeitrag hängen die Trauben hier
deutlich niedriger. Und dort wie hier gilt es zunächst einmal, sich aus der
Deckung zu wagen. Geben Sie sich einen Ruck! Eine Rangfolge stellt wie
oben beschrieben kein Argument gegen die Teilnahme dar, denn es gibt
ja nur Gewinner!
Die nächsten Amateurfunktagungen mit Selbstbauwettbewerb kommen
bestimmt. Als besonderes Schmankerl gibt es beispielsweise zur 58. UKW-
Tagung in Weinheim/Bensheim zusätzlich eine Sondersektion, in der das
älteste selbst konstruierte VHF/UHF-Gerät prämiert wird.
Wir sehen uns in Weinheim/Bensheim − auch Ihre Teilnahme ist erwünscht!
Stefan Steger, DL7MAJ
Smartphones im Amateurfunk
Smartphones, Tablets und die „Phablet“ genannte Zwischengröße bieten
heutzutage 20 000-mal mehr Leistung, als der Rechner der US-Weltraum-
behörde NASA für die erste Mondlandung 1969 zur Verfügung hatte. Kein
Wunder, dass sie bei der CeBIT, über die wir ab Seite 360 berichten, als
Trendsetter des Jahres galten. Bei Funkamateuren und Hobbyelektronikern
haben Smartphones ebenfalls in großem Stil Einzug gehalten, schon weil das
vorige Mobiltelefon den Geist aufgab.
Mit wirklich nützlichen Anwendungen − den Apps − sieht es dagegen anders
aus, wobei ich Grundfunktionen wie Telefonieren, Fotografieren und Wecken
hier außen vor lasse. Freilich hat es sich herumgesprochen, dass es für einen
geringen Obolus oder gar zum Nulltarif viele Apps gibt, die auf unser Hobby
zugeschnitten sind. Dazu trug sicher auch Gerd Klawitters fast zwei Jahre lang
im FA gelaufene Serie bei. Hört man sich bei Funkamateuren um, ist zu er-
fahren, dass Apps gerne heruntergeladen und ausprobiert werden. Zum
täglichen Helfer, wie etwa der PC im Shack, haben sie sich indes weniger
etabliert.
Diese eher geringe Akzeptanz, die sich ganz deutlich in Leserbriefen zur o. g.
Apps-Serie widerspiegelte, hat meines Erachtens damit zu tun, dass zumindest
in der Anfangsphase einfach nur bekannte PC-Anwendungen auf Android,
iOS & Co. umgesetzt wurden. Das mag bei einem CW-Lehrer für die Hosen-
tasche ganz nützlich sein, und ein Repeater-Finder, der das ortsabhängige
Angebot an Relaisfunkstellen präsentiert, ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Dagegen bereiten Anwendungen, die große Bildschirme, Tastatur und Maus
erfordern, wie etwa das wettbewerbsmäßige Loggen, auf dem Mini-Display
eines Smartphones kaum Freude. Und gerade SDR mit seinen fantastischen
Möglichkeiten erscheint auf dem Smartphone nicht mehr als eine − wenn
auch nette − Spielerei, siehe S. 385 dieser Ausgabe.
Die Stärke dieser Mini-Mondlandungsrechner mit Mikrofon, Kamera, GPS,
Lage-, Kompass- u. a. Sensoren und ihrer enormen Rechenleistung liegt genau
dort, wohin ihnen Desktop-PCs, ja selbst Laptops und Netbooks, nicht folgen
können. Erst wenn Apps dieses Potenzial ausschöpfen, haben die Rechen-
zwerge eine Chance, für uns Funkamateure als mobile Ergänzung des PC im
Shack zu unentbehrlichen Werkzeugen zu werden.
Dabei scheint der Anfang erfreulicherweise bereits gemacht. Ein sich bei der
CeBIT abzeichnender Trend ist „Augmented Reality“ − die Ergänzung eines
fotografischen Abbildes der Realität durch hinzugefügte Informationen. Ein
Paradebeispiel für deren Umsetzung im Amateurfunkbereich ist die App
„Satellite AR“. Hier erscheinen die gerade erreichbaren Amateurfunksatelliten
in Live-Bilder der Umgebung eingeblendet.
Die Implementierung des von DC7GB im FA 3/12 vorgestellten Peilverfahrens
oder die weitgehend automatisierte Logbuchführung/Auswertung bei SOTA-
Aktivitäten und ähnlichen Bergwettbewerben sind weitere Anwendungen, die
geradezu nach einem Smartphone verlangen! Die Industrie könnte dies noch
fördern, indem sie die Funkgeräte endlich mit Bluetooth versieht.
In der Hoffnung, den Ehrgeiz und die Kreativität von Entwicklern angeregt
zu haben, freue ich mich schon jetzt auf spannende Ergebnisse, über die wir
prompt berichten werden.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Ehrenamt tut gut
Die Ergebnisse einer Untersuchung bestätigten kürzlich die positiven Aus-
wirkungen von gemeinsam ausgeübten Hobbys und ehrenamtlichem
Engagement für den Einzelnen. Beides schütze vor dem sogenannten Burn-
out und mache Menschen widerstandsfähiger gegenüber Stress. Es gelte,
einen Ausgleich zum oft dominierenden Berufsleben zu schaffen.
Wir Funkamateure sind in unserer Gemeinschaft demnach mit einem guten
Stressschutz ausgestattet, selbst wenn unser Hobby nicht jederzeit frei von
Konflikten ist. Doch haben wir ein im Wortsinn verbindendes Thema, das wir
gemeinsam verfolgen.
Auch für ein ehrenamtliches Engagement bieten sich uns diverse Möglich-
keiten, wobei schon kleine Beiträge der Gemeinschaft helfen. Schauen wir
dabei auch einmal über den DARC e.V. hinaus: Hat das Stadtmuseum eine
Technikausstellung, die durch eine fachkundige Begleitung an Zuspruch
gewinnen würde? Oder bieten die örtlichen Schulen technisch orientierte
Arbeitsgemeinschaften an, die gegenüber fachlicher Unterstützung oder
neuen Ideen aufgeschlossen sind?
Der heute oft verdichtete Unterrichtsplan erlaubt es den Schülern kaum noch,
sich nach Schulschluss intensiv mit einem technischen Hobby zu befassen.
Durch unsere ehrenamtliche Mitwirkung in AGs bzw. deren Anregung lässt
sich unser Thema in die Schulen tragen. Dabei muss es nicht gleich um eine
Amateurfunk-AG gehen, zum Einstieg wecken schon kleinere elektronische
Bastelprojekte das Interesse. Langfristig könnte sich daraus eine eigene Schul-
station entwickeln, was unsere Hobbygemeinschaft wiederum verstärken
würde.
Ein weiterer Bereich unseres ehrenamtlichen Engagements vereint sich unter
dem Stichwort Notfunk. Recht bekannt ist mittlerweile das Konzept, dass sich
Funkamateure als Notfunkgruppe zusammentun, ihre Funkausrüstung für den
portablen oder mobilen Einsatz vorbereiten und regelmäßig Übungen durch-
führen. Letzteres im Idealfall gemeinsam mit Hilfsorganisationen, um diesen
das eigene Unterstützungspotenzial zu präsentieren bzw. deren Anforderungen
anhand der Praxis zu erkennen.
Weniger bekannt ist dagegen die Möglichkeit, sich als Funkamateur direkt bei
den Hilfsorganisationen als ehrenamtlicher Helfer einzubringen. So wird in
Deutschland der Zivil- und Katastrophenschutz im Wesentlichen ehrenamtlich
getragen. Im Bereich der elektronischen Kommunikation, also unserer
Domäne, besteht vor allem bei den nicht staatlichen Hilfsorganisationen
(ASB, DLRG, DRK, JUH, MHD) Bedarf an motivierten Funkern mit Ideen und
Engagement.
Denn nicht jeder Helfer möchte vom Einsatzleitwagen aus die Kommunikation
sichern, Antennen aufbauen und BOS-Funkgeräte bedienen. An dieser Stelle
sind motivierte Funkamateure hochwillkommen, die dann eine Zusatzaus-
bildung u. a. für den BOS-Funk erhalten und gegebenenfalls eine bestehende
Notfunkgruppe gleich mitbringen. Aufwand und Hürden sind oft weitaus
geringer als anzunehmen, nur muss man den ersten Schritt tun und die Idee
vortragen.
In erster Linie kommt ein solches ehrenamtliches Engagement unserer Gesell-
schaft zugute. Gleichzeitig stärkt es aber auch unsere eigene Position als
weltweit anerkannter und geachteter Funkdienst. Dieses Selbstbewusstsein
dürfen wir uns zugestehen. Der Stressabbau kommt nebenbei.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Das Psychopathen-Konzert
Störer gab es schon immer. Sie sind so unvermeidlich wie der Sand im Ge-
triebe. Jedes Kommunikationsmedium übt auch eine ungeheure Faszination
auf Kommunikationsgestörte aus. Sie produzieren sich in zwei Erscheinungs-
formen: als selbst ernannte Heilsbringer und als Feiglinge hinterm Busch.
(Die notorischen Brüllaffen, die jedes Pile-up mit ihrem Rufzeichen-Perpetuum
zumüllen, lassen wir ausnahmsweise links vor.)
Die mit offenem Visier Antretenden missionieren zur falschen Zeit am falschen
Ort, sei es, um die Menschheit vor dem Weltuntergang zu warnen, sei es, um
ihnen ein QSO auf 14 195 kHz zu vermasseln. Die anderen, und das ist die
üblere Sorte, verstecken sich in der Anonymität. Sie verfassen absenderlose
Briefe, überkleben heimlich Plakate oder lauern wie die Spinne im Netz, bis
ein Funkinsekt vergisst, die Split-Taste zu drücken. Dann schnellen sie los,
stöhnen qualvoll „up! up!“ oder bieten − als Höflichkeitsfanatiker − dem Äther-
sünder die Tageszeit: „Guud Mooorning!“ Nachweis weiterer Fremdsprachen-
kenntnisse sind die Urlaute amateurfunkerischer Völkerverständigung:
„Spaghetti!“ und „Kartoffel!“
Was haben diese unseligen Funkgenossen prinzipiell gemeinsam? Sie verfügen
über eine Sendegenehmigung. Sie sind im Besitz einer leistungsstarken Funk-
station. Und sie sind Psychopathen.
Was aber bewegt sie zu ihren unseligen Handlungen? Die Antwort erfährt man
aus der Klippschule der Psychotherapie: Sie alle sind im wirklichen Leben zu
kurz gekommen. Sie leiden in der Realwelt an Machtlosigkeit und kompen-
sieren das durch brutal-lustvolle Machtausübung in der Scheinwelt der Afu-
Bänder. Dort, in der risikofreien Rückendeckung der Anonymität, sind sie
unangreifbar. Computerfreaks fliehen in Cyber-Societies, Funknerds schaffen
sich neue Pseudo-Identitäten, indem sie fremde Rufzeichen piratieren. Ihre
Geheimwaffe, ihre Siegeskeule ist das Kilowatt.
Die bisher lästigste Erscheinung − zugleich ein Musterexemplar der Gattung −
ist der Kreuzritter aus dem Königreich beider Sizilien, der mit seinen eineinhalb
italienischen Spitzbuben seit Jahren die DX-Fenster okkupiert. Für diese Provo-
kation wird er beschimpft und beflegelt; das genießt er wie der Sado-Maso
die Peitsche. „So verrottet sind die Sitten!“ jault er auf − und provoziert weiter.
Seit einigen Monaten wird aber die Grenze des Erträglichen maßlos über-
schritten durch eine Störbrigade der miesesten Sorte. Sobald eine rare DX-
Station im CW-Bereich auftaucht, besetzt ein liederliches Kleeblatt systema-
tisch und in exaktem Zusammenspiel die Frequenz. Der erste Funkschurke
sendet pausenlos einen CQ-Ruf mit imaginären Rufzeichen, der zweite legt
eine „599-tu“-Endlosschleife nach und der Dritte im Bunde steuert minuten-
lange Punktreihen und genüssliches Trägersetzen bei. Wer etwa jüngst ver-
sucht hat, T30PY aus West Kiribati, PT0S von Peter/Paul oder ZL9HR auf
Campbell zu erreichen, wird bestätigen: Das sind keine branchenüblichen
Störungen, das ist Terror, das ist planvolle Sabotage des gewaltigen Auf-
wands, der hinter den Funkexpeditionen steckt; das ist tausendfacher Ver-
bindungsdiebstahl an der Funkgemeinde.
Nun sollte man meinen, dass die zuständigen Funktionäre in den nationalen
Funkverbänden promptissimo solchen Störmanövern ein Ende bereiten.
Schließlich kennt man ja die paar deklarierten Fanatiker, und die anderen
Missetäter kann man kreuzpeilen. Kann man nicht? Kann man doch. Wenn
man will. Aber vielleicht ist es den nationalen Häuptlingen zu mühsam. Oder
es ist ihnen zu peinlich, in ihren Reihen Verrückte zu wissen. Oder es ist ihnen
einfach egal.
Wolf Harranth, OE1WHC
Ausblick insgesamt positiv
Im Dezember 1992 übernahm ich von der Treuhandanstalt die Zeitschrift
FUNKAMATEUR. Dies übrigens nicht gerade für die symbolische eine
D-Mark, sondern für einen angemessenen Kaufpreis und eine Beschäf-
tigungsgarantie für meine früheren Kollegen.
In den zwanzig Jahren, die nun seit der Privatisierung der früheren GST-
Zeitschrift vergangen sind, haben wir ein tragfähiges Geschäftsmodell
etabliert. Wir, das sind ein sachkundiges, engagiertes und erfahrenes
Redaktionsteam sowie ein stabiler Stamm kompetenter Autoren und
unter diesen zahlreiche findige Entwickler. Selbstredend gehören dazu
die fleißigen Mitarbeiter im Hause, die Ihre Abonnements verwalten,
Ihre Bestellungen annehmen, Bausätze zusammenstellen und versenden
oder an der Vervollkommnung unseres Internet-Auftritts arbeiten.
Nachdem wir die Startschwierigkeiten in den frühen 90ern gemeistert
haben, publizieren wir heute ein weltweit angesehenes Amateurfunk-
magazin. Daneben drucken wir qualitativ hochwertige und zugleich
preiswerte QSL-Karten „Made in Germany“, liefern außer Literatur und
Software ein ständig wachsendes Sortiment an Spezialbauteilen und
bieten verschiedenste Bausätze an, für die selbst Hochschulen und
Universitäten sowie Kunden außerhalb Europas großes Interesse zeigen.
Dies in seiner Gesamtheit ist unser Alleinstellungsmerkmal für einen
Amateurfunkverlag und zugleich das Fundament unseres wirtschaftlichen
Erfolges.
Daraus leiten sich natürlich hohe Erwartungen unserer Leser und Kunden
ab, denen wir allmonatlich mit lesenswerten Beiträgen und neuen Produk-
ten entsprechen. Lesen Sie beispielsweise unseren ausführlichen Test-
bericht zum KX3 ab Seite 16. Dieser braucht den Vergleich mit Veröffent-
lichungen in anderen namhaften Zeitschriften nicht zu scheuen.
Für das Bausatzprogramm haben wir uns auch 2013 einiges vorgenom-
men. Ohne Details zu nennen, kann ich schon heute versprechen, dass es
mehrere Projekte geben wird, die auf ein breites Interesse stoßen dürften.
Dabei kommt es mir ganz persönlich immer darauf an, preiswerte Bau-
sätze aufzulegen. Gerade dieser finanzielle Aspekt trifft ebenso auf die
Zeitschrift FUNKAMATEUR zu. Auf diese Weise sollen alle Produkte des
Verlages für einen breiten Kundenkreis erschwinglich sein. Die etwa ver-
gleichbare Elektronikzeitschrift Elektor beispielsweise kostet nämlich fast
das Doppelte − sowohl im Abonnement als auch im Freiverkauf.
Trotzdem wollen wir uns mit dem Erreichten nicht zufriedengeben. Die
Technik entwickelt sich rasant, die Funkamateure sind in Deutschland
gesellschaftlich kaum anerkannt und der Nachwuchs fehlt, sowohl für
unser interessantes Hobby als auch − viel schlimmer − für die Industrie.
Wir werden daher weiterhin bestrebt sein, mit dem FUNKAMATEUR
Jugendliche anzusprechen, ihr technisches Interesse zu wecken und so
den Ingenieurnachwuchs fördern. Wäre es nicht in diesem Zusammen-
hang an der Zeit, wenn Baunatal mit uns endlich an einem Strang ziehen
und uns weniger als Konkurrenz sehen würde?
Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und wünsche Ihnen
ein gutes Jahr 2013.
Knut Theurich, DG0ZB
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Technik, die uns begeistert
Auf dem Titelbild dieser Ausgabe sehen Sie einen Icom IC-7100. Sein ab-
gesetztes Bedienteil verfügt über ein schräg nach hinten geneigtes Display,
das zudem Touch-Funktionalität besitzt. Das gab es bisher bei Amateurfunk-
geräten noch nicht und es verleiht einem Allband-Allmode-Mobiltransceiver
praktischen Mehrwert.
Unser potenzieller Amateurfunknachwuchs und zum Teil sogar wir selbst
„tatschen“ und „wischen“ indes seit etlichen Jahren auf Geräten herum,
die sich Smartphone, MP3-Player oder Tablet nennen. So gesehen wird es
höchste Zeit, dass die im Amateurfunkmarkt bislang dominierende japanische
Industrie diese Technologie auch Amateurfunkgeräten einpflanzt.
Auf weitere Neuerungen aus Japan wie etwa SDR sind wir gespannt und
müssen wohl offenbar weiter warten. Demgegenüber haben zwei US-amerika-
nische Hersteller, die beide wie viele vor ihnen als „Garagenfirmen“ begannen,
den anderen gezeigt, wohin die Entwicklung geht. So hat Flexradio Systems
in gut neun Jahren bereits mehrere Generationswechsel seiner SDR-Trans-
ceiver vollzogen, und Elecraft setzt mit dem neuen KX3, den wir im FA 1/13
eingehend unter die Lupe nehmen werden, ebenfalls Maßstäbe.
Dabei geht es nicht nur um die Integration von Funktionalitäten, die wir von
SDRs her kennen, in autarke Amateurfunkgeräte − das hat u. a. Hans Zahnd,
HB9CBU, bereits mit dem ADT-200A umgesetzt. Bei einigen modernen japa-
nischen Amateurfunkgeräten kann man schon einmal am Displayrand ein
Wasserfalldiagramm beobachten, und die Decodierung von RTTY und PSK
gehört fast schon zum Standard. Die SDR-Technologie hat jedoch weit mehr
Potenzial, nämlich die konkrete Definition der Funktion einer gegebenen Hard-
ware durch Software − wie es Bodo Scholz, DJ9CS, bereits im FA 10/2007
am Beispiel der Simpel-Hardware Rocky demonstrierte.
Warum also nicht den wertvollen Transceiver ebenso als Funkmessplatz, Netz-
werkanalysator, Spektrumanalysator, Feldstärkemessgerät u. v. a. m. nutzen.
Die entsprechenden Baugruppen sind ohnehin im Gerät vorhanden. Die einen
mögen die Funktion gern selbst definieren, etwa mit Software à la GNU Radio,
während sich andere lieber ein fertiges Programm laden, um beispielsweise
NCDXF-Baken oder den UKW-Bereich gezielt zu beobachten. Oder um endlich
reale S-Meter-Rapporte geben zu können − womit ich angesichts der
mehr als 31 Jahre gültigen IARU-Festlegung der S-Stufen ein Grundübel bei
Industriegeräten anspreche.
Ein pikantes Beispiel für software- oder sagen wir besser firmwaredefiniertes
Radio par excellence liefert das Reich der Mitte. Es macht ja inzwischen allen
vor, dass sich ein Dualband-Handfunkgerät, das nur funken und Hörrundfunk
darbieten kann, zum Spottpreis auf den Markt bringen lässt. Es dürfte nur noch
eine Frage der Zeit sein, bis alle diese Geräte CE-konform sind.
Kurzum: Die bisher marktbeherrschenden Hersteller aus Japan sowie Ten-Tec
aus den USA sind meines Erachtens gut beraten, schnell auf wirkliche Inno-
vationen zu setzen und nicht technische Kosmetik zu betreiben. Nur wenn
moderne Amateurfunktechnik dem Kunden mehr gestattet als einfach nur
zu funken, was ein Mobiltelefon ebenso kann, werden wir technikbegeisterte
Jugendliche für unser interessantes Hobby gewinnen können. Die entspre-
chende Gerätetechnik vermag, ungeachtet aller Begeisterung für den Selbst-
bau, in der Breite nur die Industrie zu schaffen.
In diesem Sinne bin ich auf das kommende Jahr gespannt. Frohes Fest!
Ihr
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Unsere digitale Zukunft
Auf der Ham Radio 2012 verlautete aus dem VUS-Referat des DARC e.V.:
„Wir wollen keine Inseln bilden. Analog bildet Inseln, Digital verbindet.“
Stimmt das denn?
Schon seit Mitte 1973 gab es zwischen DB0SP und DL0BGA (später DB0XC)
auf 2 m eine analoge Relaiskopplung, ohne dass dazu ein gesonderter Über-
tragungskanal nötig war. DB0SP hörte einfach die Relaisausgabe von DB0XC
ab und sendete direkt auf der Eingabe von DB0XC. Und das bei nur 175 kHz
Abstand zwischen den beiden Relais! Diese als „Elmstrecke“ bezeichnete
Kopplung wurde wegen der politischen Lage Berlins als Ausnahme genehmigt,
da damals der Linienverkehr nicht erlaubt war. Die Strecke arbeitete vollständig
analog und ermöglichte viele Verbindungen vom Erzgebirge bis nach Belgien,
Dänemark und Holland. Tonbandmitschnitte aus der Zeit lassen heute noch
erahnen, was das für eine Innovation war!
Relais lassen sich heute einfacher über Echolink verbinden, wobei sogar der
direkte Anruf an eine bestimmte Station möglich ist. Es ist falsch zu behaupten,
„Analog bildet Inseln“, denn die Übertragungstechnik hat absolut nichts
mit Inselbildung zu tun. Es liegt nur am SysOp! Der zweite Teil der Aussage
„Digital verbindet“ ist ebenfalls nicht schlüssig, wie das Beispiel oben deutlich
zeigt. Es ist allerdings einfacher, heutzutage das Internet zur Kopplung von
Relais zu verwenden. Sehr viel besser wäre es, wenn das im Aufbau befind-
liche HAMNET dies zu 100% leisten könnte. Es darf aber bezweifelt werden,
ob das für alle Relais eine realistische Vision ist.
Reichen die beiden Argumente aus, um das digitale Amateurfunkzeitalter nun
beim Relaisfunk auszurufen? So einfach bestimmt nicht, denn aktuelle digitale
Relais sind immer noch im Experimentierstadium. Sie verwenden z. B. zur
Sprachcodierung einen patentierten CODEC (AMBE-2020), der eine quell-
offene, kostenlose Realisierung mithilfe einer Soundkartensoftware verhindert.
Bessere und sogar freie Alternativen sind durchaus vorhanden, aber nicht
etabliert. Leider kann der CODEC nicht so einfach durch ein Firmware-Update
im Funkgerät getauscht werden. Das ist kommerziell vermutlich gar nicht er-
wünscht, denn die Industrie möchte natürlich neue Geräte verkaufen. Zudem
ist die GMSK-Modulation für unsere Zwecke nicht optimal. Sie reagiert z. B.
sehr empfindlich auf Mehrwegempfang und ist daher für Mobilbetrieb keine
innovative Systemlösung gegenüber FM.
An der für uns Amateure so wichtigen Empfindlichkeitsgrenze verlieren aktuelle
digitale Sprachsysteme, da die Verbindung abrupt abreißt. Trotz Rauschen
kann man dagegen ein FM-Signal von 0,2 μV durchaus noch verstehen!
Gerade diese Grenze immer weiter hinauszuschieben, ist für viele DX-Jäger
(die gibt es genauso in FM) eine Königsdisziplin. Wenn man nun obendrein den
Parallelbetrieb von digitalen und analogen Relais auf der gleichen Frequenz for-
dert und wir unsere FM-Relais mit CTCSS-Subtönen vor Störungen „schützen“
(tatsächlich: verriegeln) müssen, so kann man das höchstens in einer kurzen
Übergangszeit bis zum Wechsel der DV-Relais in einen getrennten Bandbereich
akzeptieren. Ein Dauerzustand darf das nicht werden und eine CTCSS-Empfehlung
der IARU ist deshalb ebenfalls nicht nötig.
Unsere Zukunft wird zweifelsfrei immer digitaler werden, sie wird aber auch
analog bleiben, denn außer bei Telegrafie kann kein menschliches Organ etwas
mit Nullen und Einsen anfangen.
Thomas Schiller, DC7GB
SysOp DB0BLN, Co-SysOp DB0SP seit 1971
60 Jahre FUNKAMATEUR
Der FUNKAMATEUR wird sechzig − ein langer und mühevoller Weg liegt
hinter uns. Heute sind wir die einzige am Markt verbliebene frei erhältliche
Zeitschrift in deutscher Sprache, die sich mit dem Funkhobby im weitesten
Sinne beschäftigt und gehören zur ersten Liga der Amateurfunkmagazine
weltweit. Das geschafft zu haben, macht uns zu Recht stolz.
Möglich ist dies aber nur, weil wir uns konsequent an den Interessen
der Leser orientieren, ein sehr weites Themenspektrum abdecken und nach
der Wende unabhängig geblieben sind. Die Redaktion versteht sich als
Wissensvermittler und der Verlag als Dienstleister für eine ganz besondere
Leserschaft mit sehr speziellen Ansprüchen. Jede Ausgabe, die wir produ-
zieren, muss ausgewogen sein und den Lesern das bieten, was sie von
uns erwarten. Die stabile Anzahl von Abonnenten und rund 5000 Leser im
Ausland zeigen, dass uns das sehr gut gelingt.
In den zurückliegenden Jahren haben wir neue Technologien nicht nur erklärt,
sondern auch daran mitgewirkt, diese einzuführen. Als Beispiele seien DDS-
Applikationen sowie Eigenbauprojekte für D-STAR und Softwaredefiniertes
Radio genannt. Dafür haben wir Bausätze aufgelegt, mit denen wir Tausende
Leser animieren konnten, den Amateurfunk als Experimentalfunk zu praktizie-
ren, selbst Erfahrungen zu sammeln und sich auf diesem Wege ihre ganz
persönlichen Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
Viel liegt uns daran, das Potenzial des Internets als nützliche Ergänzung
unseres Hobbys aufzuzeigen. Smartphones und Tablets sind keine Konkur-
renz für den Amateurfunk, sondern universelle Hilfsmittel. Funkamateure
können sie so normal nutzen wie ihre PCs, die heute im Shack zur Logbuch-
führung, zur Transceiver-Steuerung usw. dienen oder im Hobbyelektronik-
labor beispielweise für Messaufgaben sowie beim Leiterplattenentwurf
eingesetzt werden.
Wichtig ist uns auch, bei unseren Lesern die Lust auf Neues zu wecken.
Web-SDR-Empfänger, Remote-Betrieb und Digitalfunk sind nur einige der
Betätigungsfelder für hochinteressante Experimente. Die rasante Entwicklung
der Kommunikationstechnik, neue Bauelemente und Technologien werden
uns auch künftig viele Möglichkeiten eröffnen. Diese zu erschließen und
sinnvoll zu nutzen, um die Begeisterung für den Amateurfunk, die Funk-
technik und die Elektronik zu erhalten, ist unser erklärtes Hauptanliegen.
Hierbei übersehen wir nicht, dass es immer schwieriger wird, Projekte zu
entwickeln, die sich ohne technologische Spezialausrüstung von jedermann
realisieren lassen. Andererseits wissen wir, dass der erfolgreiche praktische
Einstieg in neue Technik oftmals über einfache Mittel und Wege gelingt.
Diesen Aspekt werden wir ebenfalls nicht aus den Augen verlieren und
deshalb versuchen, Technikinteressierte mit Einsteigerbeiträgen und ein-
fachen Bausätzen für unser Hobby zu gewinnen.
An dieser Stelle geht mein Dank im Namen aller Mitarbeiter des Verlages
an die vielen Leser, die uns über Jahrzehnte die Treue gehalten haben, an
die Autoren, die interessante Beiträge schreiben, und an unsere kreativen
Entwickler.
Bleiben Sie uns gewogen.
Ihr
Knut Theurich, DG0ZB
Herausgeber
Auf die Bänder!
Bisweilen wird der Niedergang des Amateurfunks beklagt. Beim Blick auf die
Mitgliederzahlen und deren Tendenz in manchen Ortsverbänden mag man in
diesen Chor einstimmen. Auch die Alterspyramide der Funkamateure stimmt
nachdenklich.
Doch insbesondere an Wochenenden ist auf den Bändern von der vermeint-
lichen Flaute nichts zu spüren, denn da wird noch gefunkt! Amateurfunkwett-
bewerbe erfreuen sich stetig wachsender Teilnehmerzahlen. Und das nicht
erst, seitdem wir uns in Richtung Sonnenfleckenmaximum bewegen. Ob nun
10-m-Contest, WAG, WAEDC oder Fieldday: Die Zahl der eingereichten Logs
steigt stetig.
Dabei ist es offenbar nicht allein die sportliche Komponente, die begeistert
und zur Teilnahme animiert. Neue technische Lösungen, Antennen und unter-
stützende Software werden getestet und die sich über den Tag ändernden
Ausbreitungsbedingungen studiert. Letzteres zählt übrigens gewissermaßen
zu den Geburtsumständen von Amateurfunk-Contesten. In dem Bestreben,
möglichst viele transatlantische Funkverbindungen herzustellen, entwickelten
sich in den frühen 1920er-Jahren wettbewerbsähnliche Veranstaltungen auf
den Amateurfunkbändern. Heute sind Conteste aus der Sparte DX nicht mehr
wegzudenken.
Auch das Erlebnis in der funkenden Gemeinschaft − im Contestteam nämlich −
ist eine zentrale Motivation für diese positive Entwicklung entgegen dem ver-
meintlichen Trend. Gerade unsere Nachwuchsfunker lassen sich dafür gerne
begeistern.
Ob auf UKW oder KW, ob Kurz-Contest oder 48-Stunden-Marathon: Für jeden
hält der jährliche Contestkalender die richtige Klasse bereit. Diverse Wertungs-
gruppen von QRP bis High Power bieten jedem Funkamateur entsprechend
seinen Möglichkeiten und Vorlieben die Chance zum Mitmachen.
Nach der Berechnung der gesammelten Punkte, die heute dank elektronischem
Contest-Log nur noch einen Bruchteil der früheren Mühen bereitet, findet die
Logdatei ihren Weg u. a. ins DARC-Contestlogbook (DCL). Das wiederum bietet
mit seinen Anbindungen an eQSL und LoTW die Möglichkeit, Diplome unkom-
pliziert zu beantragen. Der damit vereinfachte Diplomerwerb ist eine weitere
Säule der Aktivitäten. Auch hier vervielfachte sich die Zahl der aus gegebenen
Diplome in den vergangenen fünf Jahren, und zwar um einige Hundert Prozent.
Für Diplomsammler ist dies eine zusätzliche Motivation, an einem Contest teil-
zunehmen.
Der kommende Herbst hält wieder einige Contestereignisse bereit. Der Sep-
tember bringt uns gleich zu Anfang den IARU-SSB-Fieldday. Die „Worked All
Europe“-DX-Contestserie ist bereits angelaufen und der „Worked All Germany“-
Contest im Oktober steht vor der Tür. Die CQ-WW-DX-Wettbewerbe folgen auf
dem Fuße. Nicht zu vergessen die IARU-Region-1-Conteste oberhalb 144 MHz
im September und Oktober. Es bieten sich also gute Gelegenheiten, den Ama-
teurfunk durch Funkaktivität leben zu lassen.
Wem aber das Gewimmel im Funkwettkampf nicht zusagt, dem stehen
Contest-freie Bandbereiche und Bänder zur Verfügung. Auch außerhalb von
Contesten laden zahlreiche Aktivitäten zum Mitmachen ein: Funkbetrieb von
den Bergen, aus Flora und Fauna oder der IOTA-Marathon 2012/13 sorgen
ebenfalls für die Bandbelegung. Letztlich sichert diese die Zukunft unseres
Funkdienstes.
„Es gibt nichts Gutes. Außer man tut es.“ In diesem Sinne – wir hören uns…
Enrico (Ric) Stumpf-Siering, DL2VFR
Referent DX & HF-Funksport im DARC e.V.
100 Prozent Zufriedenheit?
Was viele befürchtet hatten, kann man nach Abschluss der 37. Ham Radio
schwarz auf weiß nachlesen. Statt 16 300 wie im Jahr 2011 kamen nur noch
14 800 Besucher. 2010 waren es noch 16 800 und 2007 sogar 18100!
Offenbar haben die fortschreitende Alterung der Klientel, gestiegene Benzin-
und Übernachtungskosten sowie vielleicht auch die Krise der Mittelmeerländer
auf die Besucherzahl durchgeschlagen.
Pessimisten könnten aus diesem Trend ableiten, die Ham Radio sei ein Aus-
laufmodell. Als naiv müsste man Optimisten bezeichnen, die meinen, nächstes
Jahr würde wieder alles besser. Gut, dass man beim Träger der Veranstaltung,
dem DARC, die Zeichen verstanden hat und nun beispielsweise über den
Vorstandsblog um Vorschläge bittet, wie sich die Anziehungskraft der Veran-
staltung wieder steigern ließe. Nicht-DARC-Mitglieder erreicht diese Initiative
allerdings nicht!
Dabei ist Eile geboten, den sich abzeichnenden Niedergang wenigstens zu
bremsen. Denn man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass die
Ham Radio beim Unterschreiten einer bestimmten Anzahl von Besuchern für
die Messe Friedrichshafen GmbH den wirtschaftlichen Sinn verliert. Was dann?
Ich bezweifle übrigens, ob ein Motto überhaupt sinnvoll ist. Die Messe selbst
braucht keines, denn die Aussteller werden ihre Angebote nicht daran aus-
richten. Es betrifft also lediglich das begleitende Bodenseetreffen mit seinen
Fachvorträgen, Workshops, Foren usw. Doch so wie im vorigen Jahr „Morsen
lebt“ manchen Hightech-Begeisterten verprellt haben könnte, mag in diesem
Jahr „Amateurfunk digital“ andere vor den Kopf gestoßen haben, die damit
nichts anfangen können oder wollen.
An und für sich hat die Ham Radio über den Kontinent hinaus einen guten Ruf
als Europas wichtigste Amateurfunkmesse, und sie ist Treffpunkt von Funk-
amateuren aus der ganzen Welt. Hersteller von Amateurfunktechnik nutzen die
Gelegenheit, um ihre Neuentwicklungen zu zeigen, und treiben dafür in Erwar-
tung des Nachfolgegeschäfts teilweise einen erstaunlich hohen Aufwand.
Als Marktplatz für Schnäppchen hat die Veranstaltung dagegen in den letzten
Jahren an Bedeutung verloren − das ist nun einmal der Lauf der Welt. Günstig
einkaufen − das macht man heutzutage im Internet. Stammbesucher beklagten
zudem das anhaltende Schrumpfen des Flohmarkts und das erneute Fehlen
von Conrad Electronic.
Das vom DARC organisierte Vortragsprogramm ist regelmäßig hochkarätig
bestückt. Auch zwei unserer Entwickler waren dabei. Norbert Graubner,
DL1SNG, referierte über Messmöglichkeiten mit dem neuen FA-VA3. Felix
Erckenbrecht, DG1YFE, stellte das FiFi-SDR und Zusatzbaugruppen wie etwa
eine neue breitbandige Magnetantenne vor.
Positiv außerdem: die Ham Rallye und andere Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche. Ferner die von Michael Höding, dem diesjährigen Horkheimer-
Preis träger, initiierte Contest University und die große DARC-Tombola, für
die auch wir Preise gespendet hatten. Wohlwollend wurde von den meisten
Besuchern aufgenommen, dass wir an unserem Messestand einige hoch-
preisige Bau sätze mit etwas Rabatt verkauft haben.
100 % Zufriedenheit − so das Fazit der Veranstalter − bei 9 % weniger Be-
suchern? Schönreden, wie es manche Politiker tun, nützt hier gar nichts.
Stattdessen sind gemeinsame Anstrengungen gefragt, um die Ham Radio
langfristig zu erhalten. Wir tun dazu gern das Unsere.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Ein Leben in der Cloud
Es gibt Tage, an denen man als Fachjournalist darüber rätselt, ob es sich
bei manchem beworbenen Angebot wirklich um einen Mehrwert für den
Ver braucher handelt oder nicht eher die Gewinnmaximierung für den Anbieter
überwiegt. Eine Meldung über „iTunes Match“ legte diesen Gedanken neulich
nahe. Der Inhalt war aber derart kryptisch formuliert, dass sich der tiefere Sinn
nicht auf Anhieb entschlüsseln ließ.
Und so kommt man in den Cloud-Genuss, Nebenwirkungen inklusive: Man
digitalisiere seine eigene Musiksammlung und lade sie anschließend bei Apple
in die Cloud. Dort sorgt quasi ein Wächter dafür, ob der eigene Song tatsäch-
lich den wertvollen Speicherplatz bei Apple belasten darf oder nicht. Dazu wird
ein Abgleich durchgeführt, wofür schon erstaunlich wenige 17 Sekunden eines
Musikstücks genügen. Eine kurze Hörprobe reicht damit aus, einen kompletten
Song freizuschalten – hochgeladen wird dann nichts. So erhält man eine Version
mit 256 kBit/s statt einer lokal vorhandenen in mitunter deutlich schlechterer
Qualität.
Was zunächst nach einem tollen Angebot klingt, ist für das Unternehmen Apple
ein noch besseres Geschäft: Durch das gewaltige iTunes-Musikrepertoire
erzeugt die Apple-Wolke dort keinen weiteren Aufwand. Dafür kann man allen
Kunden im Zweifel auch eine etwas bessere Qualität gönnen. Die Infrastruktur
für die Übertragung müssen schließlich andere stellen und bezahlen.
An seine Grenzen stößt das Verfahren bei zensierten Versionen eines Musik-
stücks, wie sie in den USA vor allem regelmäßig für Rap-Songs produziert
werden. Statt der eigenen Version mit vielen bösen Worten schlägt die elek-
tronische Zensurschere erbarmungslos zu und man besitzt plötzlich ungefragt
eine jugendfreie Version.
Das Ganze ist wohl nur ein Vorläufer dessen, was uns künftig erwartet: Ist
einmal sämtliche Musik in der digitalen Wolke angekommen, braucht es keine
Tonträger mehr. Ein Song, ein Speicherort − weltweit. Bücher, Hörbücher,
Musik-CDs und Videos werden folgen; alles nur eine Frage der Zeit. Und es
geht derzeit schneller als noch vor Kurzem erwartet.
Uns Konsumenten macht die einfache Nutzungslizenz am Ende zum Teil
einer monolithischen Datenmatrix, die unseren materiellen Besitz − Bücher,
CDs und Videos − dahingerafft hat. Die Geräte, über die wir noch verfügen,
verschaffen uns Zugang zu Musik, Büchern und Videos, die weltweit nur
einmal gespeichert wurden. Schlecht allerdings, wenn es dazu kommt,
dass wir immer mit dem angenagten Apfel verbunden sein müssen, um an
die eigenen Dinge heranzukommen – immer unter Kontrolle von Apple.
Und wenn dort etwas entfernt wird?
Das erinnert eher an Ideen einer zentralen politischen Steuerung wie in
China als an das Geschäftsmodell eines angesagten Unternehmens, dem
man sich auch noch freiwillig unterwirft. Hinterher ist der angenagte Apfel
auf allen Geräten der letzte Hinweis auf eine Welt mit realen Gütern, die sich
in die Cloud verflüchtigt haben. Doch wer weiß schon, wohin zu viel Freiheit
die Menschen am Ende (zurück)führt? Nach dem Genuss des Apfels folgte
in der biblischen Geschichte bekanntlich die Vertreibung aus dem Paradies.
Guten Appetit!
Niels Gründel
Standortvorteil Amateurfunk
Die deutsche Industrie sucht dringend qualifizierte Fachkräfte, darunter
Ingenieure. Die Nachricht ist nicht neu, doch neuerdings hört und liest man
sie immer öfter. Unsere Schulen und Hochschulen bringen auf lange Sicht
nicht genügend technisch gut vor- bzw. ausgebildete Nachwuchskräfte
hervor. Die Politik reagiert und möchte auf anderen Wegen qualifizierte Mit-
arbeiter in Deutschlands Firmen führen, wie bisher aus dem nahen und nun
verstärkt auch aus dem ferneren Ausland. Die jüngste Initiative in diesem
Zusammenhang heißt „Blaue Karte“ und wendet sich u. a. an Hochschul-
absolventen aus Nicht-EU-Staaten, die nun einen unbürokratischen Zugang
zum hiesigen Arbeitsmarkt erhalten. Ein entsprechendes Gesetz hat der
Deutsche Bundestag am 27. 4.12 beschlossen. Ob das Nachwuchsproblem
des Technologiestandorts Deutschland auf diesem Weg lösbar ist, bleibt
abzuwarten. Innerhalb Europas ist der Zuzug von Ingenieuren in unser Land
jedenfalls bislang weit hinter den Erwartungen geblieben.
Welche Gründe sind für unseren laut Prognosen künftig noch verstärkten
Fachkräftemangel verantwortlich? Der demografische Wandel wird gerne als
Antwort angeführt, und tatsächlich schließen mangels Schülern mittlerweile
Grundschulen oder sie werden zusammengelegt. Zudem, so ist oft zu hören,
würden sich Jugendliche und damit die Besucher weiterführender Schulen
heute ohnehin nicht mehr für die Technik an sich interessieren, sondern nur
noch für deren Anwendung. Dies trifft teilweise zu, ich beobachte es auch
bei meinem eigenen Sohn. Schließlich will er mitreden können, wenn es um
Internet oder Smartphone geht. War es aber früher grundsätzlich anders?
Trotzdem blieb ausreichend Gelegenheit für ein technisch orientiertes Hobby
wie den Amateurfunk.
Deutlich geändert haben sich dagegen die Rahmenbedingungen: Die Schul-
woche beginnt für meinen Fünftklässler montags mit acht Schulstunden–
darunter drei Doppelstunden naturwissenschaftlicher Fächer –, unterbrochen
von einer Mittagspause. Nachmittags stehen Hausaufgaben und/oder Training
auf dem Programm. An solchen Tagen bleibt für technisch orientierte Hobbys,
die oft den Grundstein für einen künftigen Berufsweg legen, schlicht keine Zeit.
Da die Verkürzung der Schulzeit bis zur Hochschulreife um ein Jahr zumindest
bei uns nicht mit einer Straffung des Lernstoffs einhergeht, besteht vermutlich
auch künftig wenig Freiraum. So fällt es auf den ersten Blick schwer, nach-
haltiges Interesse an Technik im Allgemeinen und am Amateurfunk im Spe-
ziellen zu wecken.
Dennoch gibt es dafür Wege, und diese führen in Form von Arbeitsgemein-
schaften wieder über die Schulen. Die auch im Amateurfunk zunehmend ein-
gesetzte Digitaltechnik, ob als weltweites Übertragungsverfahren unter der
Hörbarkeitsgrenze oder als flexibles Betriebssystem im Transceiver, sorgt dort
für Aufmerksamkeit. Auch von daher ist das Motto der Ham Radio 2012,
eben „Digitaler Amateurfunk“, eine gute und, wie ich meine, überfällige Wahl.
Dieses populäre Thema weckt zudem das Interesse junger Funkamateure,
die auf dem heimischen Relais kaum mehr in Erscheinung treten und nun
Ende Juni erstmals Europas größtes Amateurfunktreffen besuchen wollen.
So bietet unser Amateurfunkdienst mit seiner Themenvielfalt immer wieder
Anregungen für eigene Experimente und Erfahrungen, die kreative Kräfte
wecken. Das ist unser Beitrag zur Sicherung des Technologiestandorts
Deutschland.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Hightech und Selbstbau
Im Mai trifft sich die Elektronikbranche wieder in Nürnberg zur Messe SMT
Hybrid Packaging. Wie die Productronica in München oder die Nepcon in den
USA bzw. Fernost ist das ein Mekka der großen Anwender in der Elektronik-
industrie. Dort begegnen sich die Technologen der europäischen Automobil-
zulieferer und die Lohnfertiger vom Mittelständler bis hin zum weltweit ope-
rierenden Konzern.
Sie alle informieren sich über neue Produktions technologien im SMD-Bereich,
der Welt der Drahtbonder und der Leiterplattentestsysteme. Leiterplatten-
hersteller zeigen neue Technologien für 16- oder 24-fach-Layer. Auf kompletten
SMD-Bestückungslinien der 25-m-Klasse werden cora publica funktionsfähige
Leiterplatten gefertigt. Chip Shooter setzen 60 000 SMD-Bauteile der Bauform
1 mm × 0,25 mm pro Stunde mit Wiederholgenauigkeiten von ± 10 μm auf
vergoldete Leiterplatten.
Klingt dies wie Magie bei Harry Potter? Sie glauben mir nicht? Doch, doch,
das gibt es wirklich, es ist die Realität in der professionellen Produktion.
So bauen die Hersteller ihre jackentaschengängigen Navigationssysteme der
heutigen Zeit, so entsteht das Motherboard für die Bordelektronik eines jeden
Kleinwagens aus deutscher Produktion − das ist Elektronikfertigung.
Warum ich Ihnen das schreibe? Wir, die Gilde der Funkamateure, sind sicherlich
zu einem nicht unwesentlichen Teil im Umgang mit Lötkolben und Lötzinn
geübt. Wir entwickeln mit semiprofessionellen und manchmal professio nellen
Hilfsmitteln Leiterplatten, Schaltungen, Baugruppen oder komplette Geräte.
Aber dies tun wir eben mittlerweile in einer anderen Liga als die, in der moderne
Technik, die begeistert, gefertigt wird. Und das ist auch gut so.
Daher kann ich nicht immer nachvollziehen, wenn sich in unserer Szene oder
den einschlägigen Internetforen Missmut darüber breitmacht, dass es keine
Bauvorschläge gäbe, die „State-of-the-Art“ sind. Da stellt sich für mich die
Frage: Was ist denn für uns Amateure der viel beschworene Stand der Technik?
Ist es nur das, was wir mit unseren Mitteln erdenken, bauen, beherrschen
und bedienen können?
In dieser Hinsicht haben die zahlreichen selbst ernannten „erfahrenen Tech-
niker“ der Amateurszene Recht, die uns immer daran erinnern, dass man die
„modernen Transceiver“ gar nicht mehr selbst reparieren kann. Stimmt, das
trifft auf die überwiegende Mehrheit der Funkamateure zu. Aber das macht
nichts. Einen Fehler im Quellcode einer ausgefeilten SDR-Software wird OM
Normalverbraucher genauso wenig finden wie eine kalte Lötstelle am Pin 132
der CPU eines teuren Allmode-Transceivers fernöstlichen Designs.
Gerade deswegen lese ich persönlich immer wieder gerne die Beiträge in
den verschiedenen Veröffentlichungen, die sich mit Randbereichen unseres
Hobbys wie der Technik auf hohen und höchsten Frequenzen oberhalb
10 GHz beschäf tigen. Mich fasziniert, was eine Handvoll Funkamateure dafür
baut und damit anschließend sogar Funkverbindungen durchführt.
Genauso gerne lese ich aber Bauvorschläge für Geräte einfachen Zuschnitts,
etwa für nützliches Stationszubehör. Liebe Leser des FA: Beide Facetten un-
seres Hobbys haben ihren Platz in unseren Medien. Seien Sie bitte für alles
offen, was die Amateurfunkzeitschriften Ihnen als Lektüre anbieten.
Auf Wiederlesen
Peter John, DL7YS
Treffen mit Gleichgesinnten
Damals, im Jahre 2004, ging es um den Amateurfunk- und Computermarkt in
Neumarkt, kurz ACN. Die Nachfolgeveranstaltung der legendären Nürnberger
Flotronica sollte nicht mehr stattfinden.
Eine telefonische Umfrage bei anderen gewerblichen Ausstellern ergab, dass
die meisten gern kommen würden, sogar wenn sich erst kurzfristig eine Lösung
fände. Vier Wochen harte Arbeit und etliche Hilfsbereite reichten für die Orga-
nisation: Jurahallen anmieten, Aufbauhelfer und Bewirtschaftung organisieren,
Versicherungen abschließen, Genehmigungen beantragen, Hallenpläne mit
Ausstellerverzeichnis erstellen und nicht zuletzt die Anmeldungen von privaten
und gewerblichen Ausstellern entgegennehmen.
Der spannendste Teil begann am Veranstaltungstag, einem Samstag, bereits
früh vor 6 Uhr. Habe ich alle Anmeldungen erhalten und richtig zugeordnet?
Kann ich jedem Interessenten seinen gewünschten Standplatz geben? Doch
die Veranstaltung lief in geordneten Bahnen. Zufriedene Besucher zwischen
den Reihen der Aussteller, erwartungsvolle Gesichter vor den Versorgungs-
ständen, geschäftige Händler und eifrig diskutierende Funkamateure bei
ihrer Lieblingsbeschäftigung: sich mit Gleichgesinnten über Funktechnik u. a.
Themen im persönlichen Gespräch auszutauschen, sich zwischendurch bei
bayerischen Köstlichkeiten zu stärken − dabei stets in Rufweite von Freunden
und in vertrautem Amateurfunkumfeld bleibend!
Bereits während der Veranstaltung hörte ich immer wieder, wie schön und
wichtig solch ein Tag unter bzw. mit Gleichgesinnten ist. Man kann sich nach
langer Zeit einmal persönlich kennenlernen und austauschen, neue Ideen
aufschnappen, alten Ballast in Form überflüssiger Funkutensilien loswerden
und wieder neue wichtige Dinge erwerben. Dabei wird schnell klar, wie viele
Funkamateure und Elektronikbegeisterte es an diesem Tag nach Neumarkt
gelockt hat.
Das war meine erste Veranstaltung als Organisator; es folgten weitere sieben
bis einschließlich 2011. Der ACN etablierte sich von Jahr zu Jahr und es kamen,
entgegen dem sonst üblichen Trend, jedes Jahr neue Aussteller aus nah und
fern, die wiederum mehr Besucher anzogen. Die guten Rahmenbedingungen,
Autobahnnähe sowie kostenlose Parkplätze, günstiger Eintritt und erschwing-
liche Standgebühren taten ein Übriges, die Veranstaltung über Jahre popu-
lärer zu machen.
Leider hat die Stadt Neumarkt als Eigentümerin der 4000 m2 großen Halle
für 2011/2012 dringend notwendige Umbaumaßnahmen anberaumt, sodass
der ACN in diesem Jahr ausfallen muss. Es liegt also weder an mangelndem
Besucherinteresse noch an zu geringer Beteiligung gewerblicher Aussteller,
sondern einzig daran, dass die Räumlichkeiten momentan nicht zur Verfügung
stehen.
Mir persönlich ist sehr daran gelegen, die Neumarkter Veranstaltung als Treff-
punkt für uns Funkbegeisterte zu erhalten und eine Plattform für persönliche
Begegnungen zu bieten. Daher soll der ACN im Frühjahr 2013 wieder wie
gewohnt stattfinden! Vorher jedoch wird die dreitägige Ham Radio in Fried-
richshafen der internationale Treffpunkt der Funkamateure aus ganz Europa
sein.
Wir sehen uns Ende Juni am Bodensee, im September in Weinheim/Bensheim
oder im Spätherbst in Hannover – so wie wir uns bereits Anfang März in Mün-
chen getroffen haben … Nutzen wir die verbliebenen Amateurfunk-Events
umso intensiver!
Bis dahin! Ihr
Eberhard L.Smolka, DB7UP
Eberhard L. Smolka e.K. ist Inhaber der UKWBerichte, Baiersdorf
Happy Birthday, FT-817!
Kaum registriert feiert dieser Tage das von Yaesu produzierte Multiband-
Portabelgerät FT-817 seinen elften Geburtstag. Das ist in einer Zeit, in der
kaum ein Gerät länger als drei Jahre in Produktion ist, bemerkenswert:
Fahrzeuge, Mobiltele fone, Computer und gerade auch Amateurfunkgeräte
verschwinden normalerweise in viel kürzerer Zeit wieder von der Bildfläche.
Ausgerechnet aber ein erstmals im FUNKAMATEUR 2/2001 vorgestelltes
QRP-Gerät hält sich eine so lange Zeit.
Das FT-817 hat sicherlich einen Nerv getroffen. Kleiner als die meisten VHF-
und UHF-Mobilgeräte bietet es alle Bänder von 160 m bis 70 cm, dazu alle
wichtigen Sendearten und eine eingebaute Stromversorgung in Form von acht
Mignonzellen oder einem Akkumulator. Natürlich folgte bald eine Dis kussion,
dass zehn oder zwanzig Watt Sendeleistung besser seien als die maximal
fünf gebotenen, dass die Bedienelemente zu klein und die interne Stromver-
sorgung zu kurzlebig sei. Das ist menschlich und das Los vieler Produkte:
Was klein ist, könnte größer sein, was schwach ist, stärker. Doch angesichts
von Größe und Gewicht des Geräts ist an diesen Punkten kaum zu rütteln.
Die Verkaufszahlen und vielfach eingeführten Wartelisten sprachen und spre-
chen für sich. Zudem brachte Yaesu mit den Modellen FT-857 und FT-897
rasch leistungsfähigere und dadurch auch entsprechend größere Familien-
mitglieder heraus.
Erheblich aufsehenerregender zeigten sich in der Folge Gerüchte über durch-
brennende Sendeendstufen, gar war die Rede von sich selbst entlötenden
MOSFETs in diesem Bereich. Beinahe jeder kannte einen, der einen kannte,
der davon betroffen sein sollte. Als Ursache wurden sowohl eine Schwingnei-
gung bei abfallender Versorgungsspannung als auch eine erhöhte Anfälligkeit
gegenüber Fehlanpassungen genannt. Tatsächlich ist die Reparaturhäufigkeit
nach Auskunft verschiedener Fachwerkstätten nicht wesentlich höher als bei
anderen Geräten und in vielen Fällen auf das unkontrollierte Hochsetzen der
Sendeleistung in einem versteckten Menü zurückzuführen – ein Eingriff, der im
Übrigen insbesondere bezüglich der Intermodulation gut überlegt sein sollte.
Yaesu reagierte dennoch und änderte die Schaltung des Endstufenzugs. 2004
erblickte das Modell FT-817ND das Licht der Welt, bei dem Treiber- und End-
stufe anstelle der Auslauftypen 2SK2973 und 2SK2975 Transistoren vom Typ
RD01MUS1 und RD07MVS1 aufweisen. Obendrein gehören seither ein Akku-
pack und ein Ladegerät zum Lieferumfang des Transceivers.
Das böse Wort vom Steckdosenamateur trifft auf FT-817-Nutzer übrigens eher
nicht zu. Denn die geringen Abmessungen und ebensolchen Sendeleistungen
begünstigen nicht nur, sondern erfordern geradezu den portablen Einsatz unter
mannigfaltigen Umgebungsbedingungen sowie Experimente mit Antennen-
konstruktionen. Obendrein gibt es eine Fülle von erfolgreichen Bauanleitungen
für Zusatzgeräte, u. a. die im FUNKAMATEUR veröffentlichten für einen Dyna-
mikkompressor oder ein Vorfilter.
Für die Popularität des Geräts sorgen also seine weitgehend vollständige
Ausstattung ebenso wie seine vielseitige Erweiterbarkeit. Was also könnte ein
Nachfolgemodell hier noch verbessern, was sich technisch auch realisieren
ließe? Etwa ein internes Logbuch und PSK-31-Terminal für Datenfunk? Hand
aufs Herz: Wollen Sie wirklich einen eingebauten Computer in einem Portabel-
gerät? Dafür gibt es längst komfortablere Lösungen wie preiswerte Terminal-
programme für PDAs und Smartphones. Es steht also zu erwarten, dass dem
FT-817 noch einige Geburtstage vergönnt sind − ebenso wie seinen jetzigen
und künftigen Besitzern viele Funkverbindungen von Berggipfeln, Leucht-
türmen oder einfach nur aus Hotels bzw. dem heimischen Shack.
Ulrich Flechtner, DG1NEJ
Der Weg ist das Ziel
Etwas selbst bauen kann fast jeder. Dass nicht nur ich dieser Meinung bin,
sehe ich jedes Mal beim Besuch im Baumarkt. Da werden Materialien und
Werkzeuge aus den riesigen Hallen geschleppt, dass es eine wahre Freude
für die Handelsketten ist − von der einzelnen Schraube über das Holzregal
bis hin zur kompletten Einrichtung fürs Bad. Manche Eltern machen mit ihren
Kindern quasi einen Familienausflug dorthin.
Was treibt sie? Man kann doch alles fertig kaufen oder mithilfe eines Hand-
werkers verwirklichen, sodass man sich weder die Finger schmutzig machen
noch eventuell eintretende Missgeschicke beim Aufbau verkraften müsste.
Als Amateur (lat. amator = Liebhaber) benötigt man stattdessen ein Mehr-
faches an Zeit, um ein akzeptables Ergebnis zu erzielen.
Im Elektronikbereich zeigt sich die Tatsache, dass alles „schon da“ ist, noch
stärker. Tausende großer und kleiner Unternehmen wollen den Kunden mit
ihren Produkten beglücken, nahezu jeder erdenkliche Artikel ist innerhalb
einiger Tage verfügbar und meist sogar erschwinglich. Dank Internet und
Paketdiensten braucht man nicht einmal mehr das Haus verlassen, um sie
zu erwerben. Ähnlich verhält es sich im Amateurfunk.
Aber selbst wenn vieles bereits fertig erhältlich ist, kann ich als Selbstbauer
auf die eigene Leistung verweisen. Bestimmt kennen Sie das erhebende
Gefühl, wenn das mit eigenen Händen, bescheidenen Möglichkeiten und aus
gerade vorhandenen Materialien geschaffene Projekt endlich wunschgemäß
funktioniert! Es hat einfach Spaß gemacht, auch wenn dabei vielleicht zwanzig
Stunden draufgegangen sind. Überlegen Sie einmal, wie viel Geld Sie sonst
ausgeben, um so lange Spaß zu haben!
Doch die gewinnorientierte Massenproduktion kann nicht jede Erwartung
erfüllen. So gibt es bestimmte Dinge eben nicht oder nicht mehr, weil die
Ziel gruppe zu klein und eine Fertigung in kleinen Stückzahlen nicht lukrativ
genug ist. Hier lohnt sich Selbstbau tatsächlich, weil man anders gar nicht
zum Ziel käme. Zudem sind industriell gefertigte Produkte nicht grundsätzlich
preisgünstig. Wenn der Hersteller beispielsweise alle erdenklichen Funktionen
in ein Gerät stopft, damit für möglichst viele Käufer etwas dabei ist, schlägt
sich das auf den Kaufpreis nieder. Der Kunde muss dann sozusagen eine
ganze Kuh kaufen, obwohl er doch eigentlich nur ein Glas Milch will. In solchen
Fällen hilft Selbstbau sogar, beträchtlich Geld zu sparen.
Im Großen und Ganzen wird das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen beim
Selbst bau freilich eher ungünstig ausfallen. Mit der Erkenntnis, dass sich mein
Tun ökonomisch oft nicht rechtfertigen lässt, kann ich leben − und damit bin
ich nicht allein. Auch ein Angler könnte den Fisch seiner Wahl im nächsten
Laden kaufen und müsste nicht stundenlang am Ufer sitzen − wo er noch nicht
einmal weiß, ob und was ihm an den Haken geht. Bei mir kommt zumindest
meist das heraus, was mir vorschwebte. Und selbst bei Misserfolgen habe ich
dabei etwas gelernt! Dann war eben der Weg das Ziel.
Das Angebot für Selbstbauer im Bereich Elektronik, Funk und Amateurfunk ist
immer noch riesig. Es reicht von Bauteilen über Bausätze bis hin zu Modulen,
die man „nur noch“ in das eigene Projekt integrieren muss. Da hatten es
Amateure in früheren Zeiten schwerer. Greifen Sie mal wieder zu Seitenschneider,
Schraubendreher und Lötkolben − Ihre Erfolgsaussichten sind gut.
Ingo Meyer, DK3RED
Zum neuen Jahr
Für Leser, die noch selbst zum Lötkolben greifen, haben wir einige gute Nach-
richten. Der von Norbert Graubner, DL1SNG, entwickelte symmetrische 1-kW-
Antennenkoppler wird ab Januar erhältlich sein. Leider hatten unvorhersehbare
Lieferengpässe bei bistabilen Relais die Auslieferung um Monate verzögert.
Zu den für das erste Quartal 2012 vorgesehenen Projekten gehört ferner der
ebenfalls von DL1SNG weiterentwickelte und mit neuen Features versehene
Antennenanalysator FA-VA3. Des Weiteren kommt der „Spandau-Peiler“
als Bausatz heraus, und an einem komfortablen Störindikator wird bereits
gearbeitet.
An diesen Vorhaben können Sie erkennen, dass es weiterhin unser Anliegen ist,
den Selbstbau nicht nur durch entsprechende Beiträge, sondern auch mit
Bausätzen und schwer beschaffbaren Bauelementen zu fördern. Dies vor
allem eingedenk der Tatsache, dass dem Bastler heute weniger Material-
quellen als noch vor 20 Jahren zur Verfügung stehen. Zudem reicht der privat
verfügbare Zeitfonds für komplette Eigenentwicklungen einschließlich Platinen-
und Gehäuseherstellung oft nicht aus.
Inhaltlich gibt es ab dieser Ausgabe zwei Neuerungen: So sind die im Zuge
der wiedererwachten Sonnenaktivität interessanter werdenden Vorhersage-
diagramme für die KW-Ausbreitung bunter und aussagekräftiger geworden.
Seit 2007 haben wir mit dem D-STAR-QTC dazu beigetragen, diese interes-
sante Variante der Übertragung digitalisierter Sprache im deutschsprachigen
Raum auf den Weg zu bringen. Da sich inzwischen weitere Formen digitaler
Sprachübertragung etabliert haben, reagieren wir mit einem umfassenden
Digital-QTC. Es wird sich außerdem auf Digimodes wie PSK, FSK, WSJT
usw. sowie dATV und Digital-SSTV erstrecken und integriert dabei das bisher
eigenständige Packet-QTC. Die Autoren Jochen Berns, DL1YBL, und Jürgen
Engelhardt, DL9HQH, bitten auch diesbezüglich um rege Zuarbeit!
Nun höre ich schon den Aufschrei derer, die den QTC-Teil am liebsten ganz
aus dem FA verbannen würden. Es gibt Leser, die die allmonatliche DX-Story
nicht mögen, andere verschlingen gerade diese Seiten als Erstes. Gut Aus-
gebildete wünschen sich anspruchsvollere Beiträge, anderen wiederum ist
manches viel zu kompliziert. Die Aufzählung konträrer Leserinteressen ließe
sich beliebig fortsetzen.
Der FUNKAMATEUR ist von jeher breit aufgestellt, wie es auch im Untertitel
heißt: „Amateurfunk − Elektronik − Funktechnik“. Das muss zwangsläufig so
bleiben, wenn er weiterhin in gewohnter Qualität produziert werden soll, damit
er für die zahlreichen Inserenten lukrativ bleibt und der Verkauf über den Zeit-
schriftenhandel weiterhin wirtschaftlich vertretbar ist.
So werden wir wie bisher − mit Unterstützung unserer fleißigen Autoren–
den schwierigen Spagat zwischen einfachen und anspruchsvollen Beiträgen
ausbalancieren und versuchen, der Vielfalt des Funk- und Elektronikhobbys
Rechnung zu tragen. Dass dabei der Einzelne nicht immer wunschlos glücklich
sein wird, lässt sich leider nicht vermeiden. Wenn Sie also einmal manche
Seiten missmutig überblättern, bedenken Sie bitte, dass andere vielleicht gerade
dieses Thema spannend finden. Zum Ham Spirit gehört auch Toleranz,
und die ist schließlich die Stärke von uns Funkamateuren …
In diesem Sinn ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2012 − das
übrigens das 60. des FUNKAMATEURs ist!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
FUNKAMATEUR-Software-Award
Anfangs galt er als Teufelswerk, das sich nicht mit den Grundfesten des Ama-
teurfunks vereinbaren lässt. Heute ist er aus den Shacks der Funkamateure
und den Bastelecken der Hobbyelektroniker kaum noch wegzudenken: der
Computer. Als Mess- und Rechenknecht, als Schreibmaschinenersatz, zum
komfortablen Loggen inklusive Stationsmanagement oder für die Arbeit in den
Digimodes − die hier interessierenden Anwendungen sind ebenso vielfältig
wie unser Hobby.
Sogar Mobiltelefone, anfangs unter Funkamateuren ebenso verschrien, sind
in Form von Smartphones zu telefonierenden Computern mutiert. Ihrer An-
wendung, so praktisch sie insbesondere unterwegs sein mag, sind im Funk-
und Elektronikbereich noch Grenzen gesetzt. Loggen mit Bandmap, DXCC-
Übersicht, DX-Cluster-Fenster, Callbook-Einblick und Landkartendarstellung
usw. erfordert bei simultaner Darstellung einen ziemlich großen Bildschirm.
Und eine zweiseitige Leiterplatte im Europakartenformat möchte wohl nie-
mand am Handy-Display entflechten.
Die in diesem Jahr im FA angelaufene Apps-Serie von Gerd Klawitter hat
bisher eher gezeigt, dass die damit gebotenen Möglichkeiten nicht annähernd
an die eines normalen PC mit komfortabler Software heranreichen. Zudem
gibt es offenbar unter den Funkamateuren zu wenig wirklich gute App-Pro-
grammierer und noch nicht genügend Smartphone-Besitzer. Das soll nicht
heißen, dass wir Entwicklungen auf dieser Strecke nun keine Beachtung mehr
schenken. Der FA wird im Gegenteil weiter darüber berichten und heraus-
ragende Apps sogar in größerem Umfang beschreiben.
Andererseits sollte nicht der Eindruck entstehen, dass wir PC-Software zu-
nehmend vernachlässigen. Gerade auf diesem Gebiet gibt es zahlreiche Pro-
grammierer, die mit einem für Außenstehende kaum nachzuvollziehenden
Aufwand an Freizeit ihre über alles geliebten „Kinder“, teilweise schon über
mehr als zehn Jahre hinweg, immer weiter perfektionieren. Sie passen sie an
Betriebssystem- und Hardware-Fortschritte an, versehen sie mit neuen Funk-
tionen und hauchen ihnen mehr und mehr Intelligenz ein. Sie haben nicht nur
unsere Aufmerksamkeit, sondern eine Anerkennung verdient! Deswegen loben
wir nunmehr jahresweise den FUNKAMATEUR-Software-Award aus.
Dazu bitten wir Sie, liebe Leser, um Ihre Mitwirkung: Nennen Sie uns Ihr Lieb-
lingsprogramm, entweder online auf www.funkamateur.de unter Aktuelles →
Software-Award, oder einfach per Post – dann am besten mittels Postkarte.
Eine kurze sachliche Begründung wäre zweckmäßig, ist aber nicht Bedingung.
Einsendeschluss für den 2012er-Award ist der 29. 2. 2012, die Verleihung er-
folgt im ersten Halbjahr.
Es wird allerdings nicht abgestimmt! Vielmehr wählt eine Jury, bestehend aus
den Software-Kennern im redaktionellen Umfeld, unter den eingegangenen
Vorschlägen das beste Freeware-Programm aus. Dessen Autor erhält eine
mit 500 € dotierte Prämie. Einen zweiten Award verleihen wir für Shareware,
wobei der Spitzenreiter hier eine Auszeichnung, aber keine Geldprämie erhält,
da dieses Vertriebsmodell schließlich selbst bereits Einnahmen generiert.
Pro Einsender sind mehrere Vorschläge erlaubt, Programmierer dürfen sich
selbst vorschlagen. Ferner soll es sich um eine am Windows-PC nutzbare
Software handeln. Das schließt im Web-Browser-Fenster laufende Anwen-
dungen ein. Auf Eines legen wir jedoch Wert: Die Software muss eine (ggf.
wahlweise) deutsche Bedienoberfläche aufweisen oder sich mit lediglich
archaischen Englischkenntnissen bedienen lassen. Als Freeware gilt ebenso,
wenn der Autor um eine Ansichtskarte, QSL-Karte oder eine kleine Spende
bittet, ohne dies zu erzwingen.
Für Ihre zahlreichen Vorschläge bedankt sich im Voraus Ihr
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
CW − das Maß aller Dinge?
Beim Über-die-Bänder-Drehen begegnen mir häufig Funkamateure, gleichfalls
im Rentenalter, die sich mit mir über Digimodes austauschen. Wenn ich dann
meine alten Rufzeichen erwähne, kommt oft zurück: „Dann kennen wir uns doch.
Habe mal mit einer C-Lizenz (oder Gleichgestelltem) angefangen. Aber dann
Ende der 70er-Jahre doch noch CW gelernt und viele QSOs damit gefahren.
Aber jetzt ists gut, dass es auch anderes gibt.“
Abwechslung ist sicher das Eine, Traditionspflege das Andere, und beides hat
seine Berechtigung. Abwechslung bedeutet auch technischen Fortschritt, der
dem Ansehen des Amateurfunks stets gutgetan hat. Nicht immer wurden die,
die diesen Fortschritt vorangetrieben haben, gleich von der Mehrheit der Funk-
amateure anerkannt. Ein paar Beispielsprüche, die den Älteren bekannt vor-
kommen dürften:
„Mach endlich mal die Nasenklammermodulation aus, wenn Du mit mir reden
willst“ (in der Anfangszeit von SSB). − „Packet-Radio mache ich nicht. Absoluter
Unpersönlichkeitsfunk. In der Zeit, wo die ihre Digis bauen, sollten sie lieber CW
lernen …!“ − und als Krönung in der Anfangszeit von Packet-Radio: „Nur gut,
dass der Mist wenigstens in der DDR verboten ist.“ Irgendwie erinnert man sich
daran, wenn man mit den Suchwörtern „Morsen lebt“ durch die Fachpresse
oder das Internet blättert.
Aussagen wie: „Mit Telegrafie kann man noch eine Nachricht übermitteln, wenn
andere Methoden längst versagen“, sind heute nur noch bedingt richtig. CW ist
dafür längst nicht mehr das Maß aller Dinge. Das macht andererseits die ausge-
wiesenen Vorteile der Telegrafie keinesfalls zunichte.
Zwar ist CW heute nur eine Sendeart von vielen, eine digitale übrigens, dennoch
eine sehr wichtige und einzigartige. Deshalb gilt es, die CW-Bereiche innerhalb
der Amateurbänder unbedingt zu erhalten − wie es sich beispielsweise die
Arbeitsgemeinschaft Telegrafie e.V., www.agcw.de, auf die Fahnen geschrieben
hat.
Telegrafie, manuell gegeben und im Kopf decodiert, ist zweifelsohne eine Kunst,
und diese kommt, wie Dr. Hans Schwarz, DK5JI, in seiner Eröffnungsrede zur
diesjährigen Ham Radio so treffend formulierte, von Können. Diejenigen, die
das beherrschen, erbringen eine erstaunliche mentale Leistung und haben
obendrein Vergnügen daran.
Dass der Telegrafie im Amateurfunk in der Vergangenheit immer ein Sonder-
status zugewiesen wurde, was sie zum „Herrscher“ über die Genehmigungs-
klassen machte, konnte nicht verhindern, dass sie heute kein Prüfungsbestand-
teil mehr ist.
CW hat sich gewaltig weiterentwickelt. Es gibt nicht nur hervorragende Lern-
programme wie RufzXP oder Morserunner, sondern einen unverkennbaren
Trend zur „Elektronifizierung“. Schon seit Jahrzehnten werden Elbugs benutzt,
und einen Standard-Durchgang im Contest gibt heute kaum noch jemand hun-
dertfach von Hand. Skimmer & Co. können im Pile-Up sinnvolle Unterstützung
bieten, während das Reverse-Beacon-Netzwerk bisher ungeahnte Einblicke in
Ausbreitungsmechanismen gewährt. Freuen wir uns darauf, was die sich immer
weiterentwickelnde Technologie noch an Überraschungen bieten wird!
Hohe Anerkennung, womöglich gar den Nobelpreis, erhielte mit einiger Sicher-
heit, wer ein Handfunkgerät entwickeln würde, das autonom mit „batteriefreund-
licher“ Leistung jederzeit sicheren weltweiten Sprechfunkverkehr ohne weitere
Hilfsmittel wie Satelliten oder das Internet ermöglicht.
Sie meinen, das wird es nie geben? Warten wir es einfach ab. In der Zwischen-
zeit nutzen wir die bekannten Sendearten und fahren ein paar schöne QSOs.
Von mir aus gern in Telegrafie, aber bitte ohne Herrn Morse und seine „Jünger“
zu vergöttern. Telegrafisten können etwas, was die meisten anderen Menschen
nicht können. Bessere Menschen sind sie aber nicht.
Jürgen Wiethoff, DJ6AM
Digitalradiofreie Zonen
Dieser Tage ist der terrestrische digitale Hörfunk, jetzt vermarktet unter dem
Namen „Digitalradio“, in Deutschland zum zweiten Mal an den Start gegangen.
Nachdem Digital Audio Broadcasting (DAB) seit seiner Einführung vor rund
zehn Jahren bei den Radiohörern hierzulande buchstäblich nie richtig ange-
kommen ist, versucht man es nun mit dem effizienteren DAB+ erneut.
Nun gut, jeder verdient eine zweite Chance, das gilt ebenso für technische
Ideen. Schließlich hat bereits das hochauflösende Fernsehen erst im zweiten
Anlauf den Sprung in Deutschlands Wohnzimmer geschafft; die Zeit und
insbeson dere die Effizienz der Übertragungstechnik waren einfach reif dafür.
Darauf hoffen nun auch die Verkäufer des Projektes DAB+ und wollen uns
Radiohörer in ihren Werbebotschaften mit nahezu den gleichen Argumenten
wie vor zehn Jahren überzeugen: Digitalradio bietet einen glasklaren störungs-
freien Klang. Außerdem sendet man neben den Audiokanälen zusätzliche
Textinformationen sowie Grafiken an entsprechend ausgelegte Empfänger
mit Farbdisplay. Solche Argumente sind überraschend wenig einfallsreich, hat
man sie doch sämtlich schon vielfach gehört, ohne dass diese dem Digital radio
beim typischen (UKW-)Radiohörer bisher zum Durchbruch verholfen hätten. Für
interessanter halte ich dagegen die von DAB+ potenziell gebotene Programm-
vielfalt, die das bewährte UKW-Hörfunkangebot ergänzt: Beeindruckende 41
Radiokanäle habe ich kürzlich mit meinem digitalen Kofferradio empfangen.
Allerdings musste ich dafür rund 600 km bis in den Münchner Raum reisen,
denn bei mir zu Hause ist Digitalradioempfang bislang nicht möglich. Die von
DAB+ versprochene bundesweite Hörbarkeit ist dank etlicher Versorgungslücken
noch längst nicht gegeben. Nicht einmal entlang der Hauptverkehrsrouten,
obwohl sich die neue Programmvielfalt doch ganz besonders an die Autofahrer
als eine für Radiostationen wichtige Zielgruppe richtet. Gut Ding will wohl Weile
haben, wir kennen das schon vom digitalen Hörfunk.
Wie erwartet war Digitalradio auch auf der diesjährigen IFA in Berlin ein Thema,
obwohl es angesichts der übermächtigen Präsenz von dreidimensionalem
(Internet-)Fernsehen und vernetzten Haushaltsgeräten eher an den Rand
rutschte. Hoffnung auf einen Erfolg von DAB+ machten in Berlin aber mehrere
Veranstaltungen, auf denen sich Branchenvertreter trafen und das weitere
Vorgehen bei der Wiedereinführung des Digitalradios in Deutschland disku-
tierten. Denn offenbar hat zumindest ein Teil der Hörfunk-Branche nun doch
erkannt, dass beim typischen Radiohörer vor allem die empfangbaren Radio-
programme zählen. Die dafür verwendete Sende- und Empfangstechnik oder
eventuell parallel übertragene Zusatzdienste sind dagegen zweit-, wenn nicht
drittrangig. Die lückenhafte Reichweite bleibt allerdings zumindest vorerst
weiterhin ein Ärgernis: Ein Vertreter des Netzbetreibers, Media Broadcast,
kündigte zwar einen zügigen Netzausbau vor allem entlang der Autobahnen
an, mochte sich aber nicht detailliert zum Zeitplan äußern. Dennoch stehen
selbst in manchen digitalradiofreien Zonen die neuen DAB+-Empfänger bereits
heute in den Supermärkten zum Verkauf. Denn im Gegensatz zur Lage vor zehn
Jahren mangelt es zum Neustart nicht an preisgünstigen Empfangsgeräten, die
neben UKW- schon Digitalradioklänge einfangen. Sogar entsprechende Auto-
radios sind bereits erhältlich.
Der Erfolg oder Misserfolg von DAB+ in Deutschland wird übrigens auch auf
unsere europäischen Nachbarn wirken, die die hiesige Entwicklung genau
beobachten. Vergleichbar der Einführung des digitalen Antennenfernsehens
(DVB-T) vor einigen Jahren, als wir Europas digitale TV-Pioniere waren.
Ein wichtiger Unterschied zum Fernsehen besteht aber: Die ursprünglich für
2015 geplante endgültige Abschaltung des analogen Parallelsystems, also
des UKW-Hörfunks, findet vorerst nicht statt und ist auf unbestimmte Zeit
verschoben.
Harald Kuhl, DL1ABJ
S wie Sudan
Der Südsudan wird unabhängig? Da müssen wir hin! Und in der Tat: Noch ehe
die Weltgemeinschaft und die DXCC-Verwalter das neue Gebiet halbwegs
anerkannt haben, sind die ersten Profis unter den DXpeditionären bereits vor
Ort. Das ist die Frucht präziser Planung und perfekter Logistik. Hut ab! Der
Südsudan wird unabhängig? Der fehlt uns noch, den müssen wir „arbeiten“,
am besten sofort, am besten auf allen Bändern und in allen Sendearten. Und
tatsächlich: Prompt können wir uns im Online-Log abgehakt finden, mehr noch:
Wir können sogar sehen, welcher Operator unser 59 oder 599 empfangen und
bestätigt hat. Chapeau! Auf der Website der Expedition verfolgen wir tages-
aktuell den Fortschritt der Unternehmung: „Die Pile-Ups sind mörderisch!“,
und dann: „So viel Armut!“ Da hat offenbar einer zwischendurch aus dem
Hotelfenster geschaut.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Das ist keine bissige Kritik. Es ist bloß
eine Feststellung unserer Gier und wie sie bedient wird. Eine weitere Tatsache
ist, dass sich in dieser Region, nach Funkmaßstäben gleich um die Ecke, das
größte Flüchtlingslager der Welt befindet. Es heißt Dadaab und liegt in Somalia.
Allein in diesem vom UN-Flüchtlingswerk (UNHCR) betreuten Lager vegetieren
400 000 Menschen − das sind mehr als es in Europa und Amerika zusammen-
genommen Funkamateure gibt. Sie besitzen nichts als das nackte Leben, und
ein knappes Tausend pro Tag verliert selbst das.
Zu den am weltweit meistgesuchten DXCC-Einheiten zählen Navassa und
Nordkorea. Diese beiden sind uns gleich wichtig, obwohl sie nichts als das N
als Anfangsbuchstaben gemeinsam haben. Navassa ist funklos, weil dort Um-
weltschützer das Gedeihen von Fauna und Flora bedroht sehen. In Nordkorea
gibt es keinen Amateurfunk, weil sich ein Terrorregime gänzlich von der Außen-
welt abschottet und sein Millionenvolk gnadenlos unterdrückt. (Die einzige
halblegal geduldete und für das DXCC in großzügiger Regelauslegung anerkannte
Aktivierung, wir erinnern uns, gelang nur als diskret ausgehandelter Deal:
Senden dürfen im Gegenzug für die Hilfslieferung der Welthungerhilfe.)
Auch das ist kein bissiger Kommentar. Wir stellen lediglich fest, wie einäugig
unsere Weltsicht ist: Der Amateurfunk sei die Brücke zur Welt und unpolitisch,
deshalb schert uns eben nicht, ob unser Gegenüber ein Millionär ist oder ein
Erwerbsloser, ein freier Bürger in einem freien Land oder ein DXpeditionär in
einer Diktatur (wie in Myanmar, wo es keine einheimischen Funker gibt). Der
Amateurfunk ist unpolitisch, punktum.
Aber der Mensch, das wussten schon die alten Griechen, ist ein zoon politikon.
Politik in diesem Sinn ist nicht, was die Politiker tun, sondern wie wir uns unse-
ren Nächsten gegenüber verhalten, auch wenn diese Nächsten die ferns ten, die
entferntesten sind − nein! Sie sind ja gar nicht fern! Ist doch der Amateurfunk,
tausendmal beschworen, die Brücke zur Welt, und mehr noch: die Brücke
zu einer Welt ohne Grenzen. Wenn das nicht bloße Phrase, bloßes Lippen-
bekenntnis sein soll, müssen wir in der Welt mehr sehen als ein abstraktes
Gebilde abzuarbeitender DXCC-Gebiete. Und als Funkamateure sollten wir
uns nicht darauf beschränken, mit der Ablieferung eines Rapports angeblich
einen Schritt auf dieser Brücke zur Welt ohne Grenzen getan zu haben. Wenn
wir außer einem kleinen Schein für die Direkt-QSL auch einen größeren Schein
für die Linderung der Not hergeben, wird davon zwar vermutlich nicht die
Welt gerettet. Aber vielleicht stirbt ein Mensch weniger an Hunger. Dann ist
die Brücke zur Welt ohne Grenzen vielleicht ein winziges Stück tragfähiger
geworden − auch als Brücke der Menschlichkeit und Solidarität.
Wolf Harranth, OE1WHC
Your signal is five by nine, fifty nine
Wie oft habe ich diesen Satz wohl schon selbst gesagt oder 599 als Rapport
bei Contesten gegeben? Oft, sehr oft, zu oft − wie ich nun weiß. Er geht ja auch
so schön leicht von der Zunge oder in CW von der Hand. In Contest-Software
ist der 59- bzw. 599-Rapport oft bereits voreingestellt. Ein Knopfdruck bei einem
CW-Contest genügt, und sowohl der Rapport als auch die laufende Nummer
werden automatisch gegeben. Alles andere wäre Aufwand und Zeitverlust.
Ja, ich habe auch hin und wieder beim „normalen“ QSO eine oder zwei S-Stufen
mehr gegeben, als mein S-Meter anzeigte, wenn ich einen mir unerklärlich guten
Rapport erhielt. Bislang machte ich mir darüber wenig Gedanken. Das änderte
sich schlagartig, als ich meine neue selbst gebaute Antenne testete. 599 auf 20 m
aus der Ukraine bei einem normalen QSO brachten mich ins Grübeln, zumal ich
mit nur 5 W sendete. Weitere QSOs mit ähnlichen Ergebnissen folgten. Ich will
nicht verschweigen, dass ich auch einmal 495 und 459 erhielt. Bei einem weiteren
Test meiner Antenne in einem Contest bekam ich selbstverständlich immer
wieder 599 als Rapport, auch wenn die Gegenstation mehrfach „my nr?“ oder
Ähnliches gab und ich so lange die laufende Nummer wiederholte, bis ich ein
„cfm“ oder „qsl“ hörte.
Zum Schmunzeln ist das schon, da es sich ja meinerseits laut Rapport stets um
ein gut lesbares (5), sehr starkes Signal (9) mit reinem Ton (9) handeln musste.
Es ist sehr einfach, beim Contest auf die entsprechende Taste zu drücken. Auch
beim normalen QSO ist ein guter Rapport zwar nett gemeint, aber keineswegs
hilfreich: Solch ein Rapport ist einfach nur Zeitverschwendung, und ein normales
QSO könnte sich einfach auf den Austausch der Rufzeichen beschränken.
Name und QTH ließen sich bei Interesse im Internet bei qrz.com nachsehen.
Eigentlich könnte man die Contest-Regeln ändern und auf den Rapport ganz
verzichten. Dann wäre ein QSO noch kürzer und es bliebe Zeit für zusätzliche
Verbindungen. Allerdings zählt ein QSO nach allgemeinem Verständnis eben
nur nach dem Austausch der Rapporte, auch wenn diese zu einer Farce ver-
kommen sind. Daran lässt sich wohl auch nichts mehr ändern. Sonst gilt man
leicht als Rechthaber, Spielverderber und/oder Außenseiter.
Doch muss immer Quantität vor Qualität stehen? Ich für meinen Teil möchte
jedenfalls wissen, wie mein Signal bei der Gegenstation ankommt, wo sich
diese befindet und mit welcher Sendeleistung und Antenne sie arbeitet. Nur
dadurch kann ich die Leistungsfähigkeit meiner eigenen Station abschätzen und
ggf. Verbesserungen durchführen. Durch einen realen Rapport kann ich etwas
besser beurteilen, wie es in die eine oder andere Richtung geht oder ob mein
Transceiver in Ordnung ist.
Ich habe mich nach meinen letzten Erfahrungen dazu entschlossen, künftig bei
normalen QSOs keinen geschönten Rapport mehr zu geben. Vielleicht sitzt ja
an der Gegenstation ein Operator, der auch etwas testen möchte. Auch bei
Verbindungen mit Expeditionen oder Sonderstationen werde ich dies so halten.
Der DXpeditionär muss meinen Rapport ja nicht in sein Log übernehmen, kann
ihn aber zu seinem Nutzen wahrnehmen.
Damit bleibt das Problem des wirklich aussagefähigen Rapports. Fast alle
S-Meter, auch die der Spitzentransceiver, zeigen überhaupt erst Signale ab real
S5 nach IARU-Standard an. Über S 9 passt es auch nur so ungefähr, sofern der
Vorverstärker ausgeschaltet ist. Da die Fehlanzeige unter S 9 aber meist in der
gleichen Größenordnung liegt, kann man im Wissen um den Fehler einfach den
vom S-Meter angezeigten Wert nennen. Auf den höheren Bändern würde das
allerdings oft genug einen Rapport von 409 oder 519 bedeuten. Oder sollten
wir, wie ganz früher, einfach auf „gefühlte“ S-Meter-Werte vertrauen? In jedem
Fall ist eine Differenzierung besser als stures Five Nine!
Your signal is five by nine, fifty nine
Olaf Möller, DL4DZ
Contest macht d o c h Spaß!
Sonntagmorgen, halb vier Ortszeit. Ich bin im Kurzwellen-Contest aktiv und
habe auf 80 m gerade eine SV9-Station ausgegraben. Sie ist ein wichtiger
Multiplikator für mich und eigentlich laut genug, damit sie mich auch mit
meinen 100 W und dem Dipol hört. Ich rufe an − doch plötzlich ein Gebrabbel
auf der Frequenz. Unfassbar! Offensichtlich wurde sie auch gerade im Cluster
gemeldet. Der SV9 kommt mit DH8? zurück. Ich antworte brav; neben mir
röhren aber noch gefühlte 100 weitere Stationen. Der SV9 ruft mich noch
einmal auf, wieder krakeelen mindestens 20 Stationen weiter. Ich höre SP3,
F8, PA4, DF6 … sind das alles DH8er? Nach drei Wiederholungen gibt der
SV9 auf, ruft wieder CQ Contest, und mir geht ein wichtiger Multiplikator
verloren. Ich bin gefrustet. Diese Verrohung der Sitten auf unseren Bändern
im DX- und Contest-Geschäft nervt mich schon seit geraumer Zeit. Offen-
sichtlich spiegeln sich hier die Mentalitäten des „echten Lebens“ wider.
Obendrein bin ich sowieso total übermüdet und frage mich, warum ich mir
das alles antue. Gibt es nicht stressärmere Hobbys? Briefmarkensammeln.
Angeln vielleicht.
Wofür sind Conteste überhaupt gut? Man vergleicht sich national und inter-
national mit seinesgleichen. Neben der permanenten Verbesserung der
eigenen Stationsausrüstung und der Antennenanlage gilt es, zum richtigen
Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen. Rufen oder Suchen? Bleibe ich
noch auf 20 m oder wechsle ich besser schon auf 40 m? Die rechte Taktik,
insbesondere bei Teilnahme mit geringer Leistung, zahlt sich aus − und stra-
tegisches Denken hilft auch in besagtem echten Leben. Und vielleicht fällt
auch noch der eine oder andere Bandpunkt für die diversen Diplome ab.
Ist das nicht doch lohnenswert?
Ein paar Stunden später bin ich über den toten Punkt hinweg und habe eine
freie Frequenz auf 40 m gefunden. Die Entscheidung, jetzt auf 40 m zu wech-
seln, war wohl goldrichtig. Selbst mit meinen 100 W und dem Dipol ruft mich
eine Station nach der anderen an, mein Adrenalinspiegel steigt beständig −
ein irres Gefühl! Sogar neue Multiplikatoren finden ihren Weg ins Log, selbst
ein SV9er ist dabei; der Multi ist doch noch gerettet. Und mein Contest-Log-
buch-Programm verrät mir, dass ich jetzt schon 15 % über dem Vorjahres-
ergebnis liege. Das lässt auf eine gute Platzierung hoffen. Contest macht
d o c h Spaß! Gut, dass ich nicht angeln gegangen bin.
In ein paar Wochen ziehen wir wieder auf den Berg − zum UKW-Contest.
Auch dort ist die richtige Strategie wichtig: Wohin drehen wir die Antenne
nun auf 70 cm? Lohnt sich jetzt schon CW auf 2 m oder bleiben wir noch
etwas bei SSB? Bringen Skeds im Chat oder DX-Cluster tatsächlich etwas
oder lenken sie nur ab und wir vergeuden wertvolle Zeit? Was wird die
aktuelle Antennengruppe bringen; hat sich dieser Aufwand gelohnt?
Der neue CQ-Papagei ist jedenfalls fertig. Eine Contest-Weisheit besagt:
Wer nicht ruft, verliert.
Jeder Contest, sei es auf Kurzwelle oder UKW, hat seine eigenen Regeln,
und jeder einzelne erfordert seine spezielle Strategie, sowohl ausrüstungs-
mäßig als auch betriebstechnisch. Das macht sie für mich so reizvoll.
Aber nicht alle Teilnehmer streben nach einem Platz ganz vorn. Einfach nur
ein paar Stunden mitzumachen, hier und da selbst zu rufen, nach Präfixen,
Band- oder Diplompunkten zu suchen, bereichert das Geschehen und macht
Freude. Und was wären Conteste, wenn nur noch „Leistungssportler“ teil-
nähmen?
In diesem Sinne awdh im Contest!
Oliver Dröse, DH8BQA
Telegrafie statt moderner Technik?
Wenn diese Ausgabe des FA erscheint, vergeht nur noch rund ein Monat,
bis Europas größtes Amateurfunk-Event, die Ham Radio, in Kombination mit
der Hamtronic seine Pforten öffnet. Laut Projektleiterin Petra Rathgeber sind
„Marktführer wie boger electronics, Conrad Electronic, Hilberling, hofi, Icom
Europe, Kenwood Electronic, Luso, Waters & Stanton, WiMo oder Yaesu…
ebenso vertreten wie große und kleine Händler, Tüftler und Erfinder“.
Dabei sind es gerade die Fachhändler wie hofi, Waters & Stanton, WiMo
und viele weitere − hier nicht ganz zutreffend in einem Atemzug mit den
Vertretern der großen Hersteller genannt −, die die Messe Jahr für Jahr mit
Leben erfüllen. Sie treiben dabei einen bis an die Grenze des Machbaren
gehenden personellen und finanziellen Aufwand. Das verdient ein hohes Maß
an Dank und Anerkennung!
Die Mitarbeiter des FUNKAMATEUR-Leserservice sind wie gewohnt am
angestammten Stand 102 in der Halle A1 anzutreffen. Wir bitten aber um
Verständnis, dass die Redakteure ihre Zeit überwiegend damit verbringen
(müssen), andere Messestände sowie Veranstaltungen zu besuchen. Sie
werden daher für eine persönliche Begegnung am FA-Stand eher selten zur
Verfügung stehen.
Ein wichtiger Bestandteil des Rahmenprogramms der Ham Radio ist das
62. Bodenseetreffen mit seinem umfangreichen Vortragsprogramm. Immer
wieder haben Leser gefragt, wann der eine oder andere, von der Zeitschrift
her bekannte, Autor anzutreffen sei. Deshalb weisen wir diesmal im DL-QTC
auf S. 672 speziell auf Vorträge und Seminare von Autoren des FUNKAMA-
TEUR hin.
Die 36. Amateurfunkausstellung in Friedrichshafen steht unter dem Motto
„Morsen lebt“ und stellt diese Technik vom Morsekurs für Anfänger bis hin
zu Vorträgen für Telegrafie-Profis in den Mittelpunkt. Als Begründung nennt
Stephanie Heine, DO7PR, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
im DARC e.V., dem ideellen Träger der Ham Radio: „Morsen ist so aktuell
wie eh und je. Bis heute gibt es keine international funktionierende Kommu-
nikationstechnik, die so einfach mit so wenig Energieverbrauch funktioniert.“
In puncto Senkung des Energieverbrauchs liegt das durchaus am Puls der
Zeit, und für den Notfunk, nicht erst seit Fukushima aktueller denn je, ist
Morsetelegrafie unter bestimmten Umständen unverzichtbar. Auch ich habe
seit meinem Erst-QSO 1973 bis heute den überwiegenden Teil meiner KW-
Verbindungen in CW getätigt.
Dennoch hätte ich mir gewünscht, dass sich Europas führende Amateur-
funkmesse zeitgenössischere Themen auf die Fahnen schreibt. Schließlich
möchte man hier die neuesten Entwicklungen, modernstes Gerät und sich
abzeichnende Trends präsentiert bekommen. Mit SDR, Digimodes, digitaler
Sprachübertragung, Kommunikation an der Rauschgrenze, neuartigen Mini-
satelliten, Nutzung von Internet und Smartphones für den Amateurfunk seien
hier nur einige genannt.
Ein Highlight dürfte es auf jeden Fall sein, wenn Guglielmo Marconis Tochter
Maria Elettra dem Vernehmen nach die Eröffnungsrede hält. Zudem ist damit
zu rechnen, dass die zahlreichen Aktiven, die das Rahmenprogramm der
Messe tatsächlich gestalten, ungeachtet eines unpassenden Leitmotivs sehr
viele beachtenswerte Akzente setzen werden. Daneben machen die unzäh-
ligen persönlichen Begegnungen die Ham Radio attraktiv, sodass sich eine
Fahrt nach Friedrichshafen in diesem Jahr wieder lohnt!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Unseren Beitrag leisten
Wir können zwar Radioaktivität künstlich anreichern und nutzen, aber die
Geister, die wir gerufen haben, nicht wieder loswerden, wenn etwas außer
Kontrolle geraten ist. Wir können Hochgeschwindigkeitszüge bauen, aber
manchmal einen einfachen Vorortzug nicht rechtzeitig zum Halten bringen.
Und was nutzen Roboter, die Staub saugen, Rasen mähen oder gar auf
der ISS tätig werden, wenn sie dort fehlen, wo ihr Einsatz am dringendsten
wäre – nämlich auf Unglücksschauplätzen in gesundheitsgefährdender
Umgebung.
Katastrophen wird es schon deswegen immer wieder geben, weil unsere
technologischen Möglichkeiten nicht ausreichen, uns restlos vor den Natur-
gewalten zu schützen. Nicht anders Unfälle und Havarien infolge mensch-
lichen Versagens, „Kaputtsparens“, Schlamperei oder simpel der „Tücke
des Objekts“.
Ereignisse wie die japanische Erdbeben-/Tsunamikatastrophe, das Zug-
unglück von Hordorf oder die Elbe-Hochwasser sollten uns in Erinnerung
rufen, dass wir gut ausgebildeten und fähigen Funkamateure eine Verpflich-
tung gegenüber der Gesellschaft haben. Auch im 21. Jahrhundert hat
Amateurfunk seine Bedeutung und kann sogar Leben retten! Wir Funk-
amateure sind also gut beraten, unsere Notfunknetze weiter zu perfektio-
nieren, um in desaströsen Situationen kompetent helfen zu können − und
dies auch entsprechend publik zu machen! Sage keiner, im hoch tech-
nisierten Deutschland wären die vorhandenen Katastrophenschutz-
strukturen allen Eventualitäten gewachsen…
Natürlich werden wir nicht überall gefragt sein und beispielsweise in
einem havarierten AKW kaum etwas ausrichten können. Aber bei
Unglücken mit einhergehendem Zusammenbruch der Infrastruktur–
bei denen jeder Ein satzplan zur Makulatur wird – können Funkamateure
mit ihren praktischen Kenntnissen und ihrer Improvisationsfähigkeit über
sich hinauswachsen.
Allerdings werden wir mit dem aufsehenerregenden Präsentieren der
schicksten Notfunkkoffer oder mit unterhaltsamen Fieldday-Aktionen
allein die Profis noch nicht beeindrucken. Selbst lobenswerte Insellösungen,
wie sie beispielsweise aus dem Kreis Wesel (www.notfunk-kreis-wesel.de)
berichtet werden, sind zwar zielführend, aber noch lange nicht ausreichend.
Kein Einsatzleiter wird begeistert sein, wenn unerwartet eine Gruppe vor
Technik strotzender Funkamateure anrückt und das Heft an sich reißen will.
Was nach wie vor fehlt, ist ein durchdachtes, von allerhöchsten Stellen
bis zur lokalen Ebene greifendes und bundesweit flächendeckendes
Konzept der Verzahnung von Amateur-Notfunk mit dem der BOS und
anderer Hilfs organisationen.
Zudem sind einsatzbereites Equipment, durchdachte Stromversorgungs-
lösungen, schnell errichtbare Portabelantennen und vieles mehr gefragt.
Ebenso gilt es, die am Notfunk ernsthaft Interessierten auszubilden
und fit zu machen. Schließlich sind regelmäßige Übungen unter praxis-
nahen Bedingungen erforderlich − im trauten Kreis der Funkamateure
wie auch im Zusammenwirken mit den Angehörigen der o. g. Hilfsdienste.
Das sollten wir können − wie es uns z. B. Funkamateure in Schweden
und den USA seit Jahrzehnten vormachen!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Smartphone trifft Amateurfunk
Vor gut 20 Jahren kamen die ersten Computer für den Heimgebrauch zu
erträglichen Preisen in den Handel. Technikbegeisterte, die bis dahin ihren
Entdeckerdrang auf dem Gebiet des Amateurfunks ausgelebt hatten,
widmeten sich fortan gern auch diesem Themenbereich. Eine zeitgleiche
Koexistenz gab es nicht, weil die ersten Personalcomputer so viel HF-Müll
produzierten, dass sie jeden Funkempfänger zustopften. Andersherum
geriet jeder PC aus dem Takt, wenn ein Funkamateur in unmittelbarer Nähe
die Sendetaste betätigte. Selbst ein Mobiltelefon machte sich zu damaligen
Zeiten im Funkempfänger störend bemerkbar.
Im Laufe der Zeit wurden die PCs strahlungsärmer. Sie konnten fortan
nicht nur unmittelbar neben einem Funkempfänger stehen, sondern sogar
schadlos direkt mit ihm verbunden werden. Der PC ließ sich nun in die
Amateurfunkstation integrieren; mit seiner Hilfe konnte man beispielsweise
Morsesignale, RTTY-Sendungen, SSTV-Bilder oder Wetterkarten per FAX
mit wesentlich verringertem Hardware-Aufwand auf dem PC-Monitor sicht-
bar machen.
Als Software standen professionelle Programme zur Verfügung. Unter den
Entwicklern befanden sich häufig clevere Funkamateure, denn sie waren die
Praktiker mit jahrelanger Erfahrung, die wussten, was ein Programm leisten
muss.
Ebenso sind Mobiltelefone heute im Shack nicht mehr tabu. Ihre Weiterent-
wicklung, die weitverbreiteten modernen Smartphones, sind sogar kleine
Computer mit Telefoniermöglichkeit. Was spricht also dagegen, bestehende
PC-Software − soweit sie kein großes Display erfordert − derart herzurichten,
dass sie auch auf Smartphones funktioniert? Auf diese Weise können die
zu Hause bereits als nützlich bis unentbehrlich eingestuften Anwendungen
auch von unterwegs, z. B. während Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder auf Reisen, genutzt werden.
Gegenüber einem Laptop oder einem der noch kleineren Netbooks, die
ebenfalls portabel einsetzbar sind, haben Smartphones den Vorteil, dass man
mit ihnen sowohl telefonieren als auch fotografieren kann. Zudem verfügen
viele Geräte noch über einen GPS-Empfänger, einen Kompass sowie einen
Beschleunigungssensor. Nicht zuletzt ist ein Smartphone bei vergleichbarer
Leistungsfähigkeit deutlich kleiner und leichter als ein Laptop oder Netbook.
Und da man es ohnehin auf Reisen dabeihat, können Laptop und herkömm-
liches Mobiltelefon zu Hause bleiben.
Für fast jedes Smartphone sowie für einen Teil ihrer etwas größeren Verwand-
ten, die Tablet-PCs, existieren für jeden nur erdenklichen Anwendungszweck
inzwischen unzählige zugeschnitte Programme: die sogenannten Applika-
tionen oder kurz Apps. Die meisten davon gibt es zurzeit für die Geräte von
Apple, gefolgt von denen mit dem Google-Betriebssystem Android.
Wir haben die gegenwärtig angebotenen Amateurfunk-Apps für Sie gesichtet
und stellen sie Ihnen ab sofort im FA vor − wenn auch ohne Anspruch auf
Vollständigkeit. Welches Smartphone-Betriebssystem zu bevorzugen ist?
Wenn sich die Entwickler aus den verschiedenen Lagern an einen gemein-
samen Tisch setzen würden, käme bestimmt das Beste heraus.
Haben Sie Ideen und Anregungen für neue Apps? Vielleicht schreibt jemand
eine für die Bergaktivisten (S. 447 in dieser Ausgabe) und SOTA-Anhänger?
Lassen Sie uns die Klammer Computer − Mobiltelefon − Amateurfunk gemein-
sam fester ziehen!
Gerd Klawitter
Baumarkttechnik und Amateurfunk
Lassen Sie uns in den Amateurfunk-Geschichtsbüchern einmal so etwa
40 Jahre rückwärts blättern. Sehr wohl existierten Baumärkte oder deren
Vorläufer, die „Eisenwarenhändler“ − und dort gab es z. B. zweiadrige Litze,
mit der man trefflich Dipole für Kurzwelle „selber bauen“ konnte. Die
Ab teilung für Aluminiumrohre mit 12 mm oder 16 mm Durchmesser als
Schüttware suchte man noch vergeblich, die Schlagbohrmaschine in der
Version „erschwinglich für jedermann“ musste erst noch erfunden werden.
Doch dafür hatte jeder gestandene Kurzwellen-Funkamateur Antenneneier,
das Original aus Porzellan, in der Bastelkiste. In weiten Bereichen unseres
Hobbys und insbesondere beim Thema Antennenbau war Selbstbau angesagt,
obwohl OMs wie z. B. Kurt Fritzel schon die Bühne des ent stehenden
Amateurfunkmarkts betreten hatten. Die UY10 von WISI gab es noch nicht,
und Sepp Reithofer, DL6MH †, publizierte seine erste Gruppenantenne.
Tja, so oder so ähnlich war das damals.
Ich habe an dieser Stelle − obwohl nicht mit Spektrumanalysator und NWT
gesegnet und mit beschränkten handwerklichen Fähigkeiten auf die Welt
gekommen − schon mehrfach die Geister des Selbstbaus und des Zurück-
zu-den-Wurzeln-des-Amateurfunks beschworen und beschrieben. Doch
einen Themenkreis habe ich dabei stets übersehen: den Antennenbau. Das
ist ein hochinteressantes Experimentierfeld für uns Funk amateure! Ich meine
das nicht in Bezug darauf, dass wir stets und ständig technische Innovatio-
nen erfinden. Das müssen wir gar nicht.
Als erster Schritt reicht es doch aus, wenn wir etwas selbst bauen und damit
Funkbetrieb machen. Und wem das Wobbeln eines Bandfilters zu kompliziert
erscheint, der kann sich heutzutage in jedem Baumarkt die nötigen Zutaten
für den Antennenbau besorgen. Eine vernünftige Bohrmaschine, Marken-
bohrer für Metall − nicht die, die für 2,99 € als „Mitnahmeschnäppchen“ im
Kassenbereich hängen −, einen Körner, eine Lehre, einen Schraubstock,
dazu Blechtreibschrauben und die oben genannten Aluminiumrohre reichen
völlig aus.
Ach ja, und was bauen wir? Ganz einfach! Blättern Sie doch einmal die Publi-
kationen, z. B. von Martin Steyer, DK7ZB, in dieser Fachzeitschrift durch. Er
hat unter anderem eine ganze Reihe von 2-m- oder 6-m-Yagi-Antennen per
Computersimulation entworfen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Martin
legte bei seinen Veröffentlichungen stets Wert darauf, dass man seine „dB-
Schöpfungen“ auch mit handelsüblichen Baumarktprodukten nachbauen
kann. Die von ihm beförderte 12-Ω- oder 28-Ω-Technik ist erprobt und funk-
tioniert mit Sicherheit. Eine Masthalterung aus Auspuffklemmen mag man
belächeln, aber sie tut ihren Dienst. Und auch die ist im Baumarkt erhältlich.
Schließlich habe ich noch eine Bitte: Bauen Sie zuerst eine Antenne, die Sie
auch einsetzen können. Egal, ob es eine Vierelement-Yagi-Antenne für den
2-m-OV-Kanal ist oder ein Zweielement-Beam für erste QSOs auf 50 MHz.
Wenn Sie erst einmal eine solche Antenne selbst gebaut haben, damit ein
gutes Stehwellenverhältnis erzielen und dann auch noch QSOs fahren,
dann wird Sie der Antennenbazillus nicht mehr loslassen. Und an der Kasse
Ihres angestammten Baumarkts werden Sie bald mit Handschlag begrüßt.
Das hilft der Konjunktur.
Viel Spaß beim Antennenbau wünscht
Peter John, DL7YS
iPhone, iPad & Co.: neue Möglichkeiten im Amateurfunk
Gerade ein Jahr ist es her, dass Microsoft-Chef Steve Balmer auf der Consumer
Electronics Show (CES) in Las Vegas den Kompaktcomputer Slate vorstellt hat,
mit dem man Videos ansehen und eBooks lesen konnte. Das reichte damals
nicht, um genügend Nachfrage oder gar Euphorie auszulösen.
Nur drei Wochen später der Paukenschlag: Steve Jobs, Computervisionär und
Apple-Chef in Personalunion, zeigt das iPad und erläutert seine Vorstellungen,
wie dieses Gerät − ein Tablet-PC mit iPhone-Funktionen − unser Leben ver-
ändern soll. Schon am Tag des Verkaufsstarts gingen in den USA etwa 300 000
iPads über den Ladentisch.
Inzwischen ist das iPad längst nicht mehr allein, da auch andere Globalplayer
in diesem rasant wachsenden Markt mitverdienen wollen. Auf der diesjährigen
CES wurden mehr als 80 neue Modelle dieser flachen Computer ausgestellt,
die nach Ansicht von Experten das Ende der Ära der gängigen Desktop-PCs
und Netbooks eingeläutet haben.
Seit der Einführung des iPads sind Millionen dieser Hightech-Geräte verkauft
worden. Nicht nur Technik-Freaks setzen sie ein, sondern alle Bevölkerungs-
gruppen − zum Mailen, Surfen, Spielen, eBook-Lesen usw. Selbst der Deutsche
Bundestag hat seine Geschäftsordnung schon im Hinblick auf das iPad ge-
ändert. Verlage nutzen die Tablets vermehrt, um journalistische Inhalte zu ver-
markten. So gibt es Siebels Spezialfrequenzliste seit Kurzem als App für das
iPhone und auch der FUNKAMATEUR wird überlegen müssen, ob und wie er
diese neue Informationstechnologie nutzen will.
Mittlerweile stehen hunderttausende Programme zur Verfügung. Die meisten
kommen kostenlos oder für eine eher symbolische Gebühr schnell und unkom-
pliziert auf das Tablet. Oft ist man von den Einfällen der Programmierer, die
immer neue Anwendungsgebiete erschließen, verblüfft und fasziniert zugleich.
Selbstverständlich sind unter diesen Apps auch erste Software-Werkzeuge
für den Amateurfunk. Dabei wurden fast immer bekannte Problemlösungen
an die Betriebssysteme von Smartphones und Tablets angepasst. So genügt
beim portablen Funkbetrieb ein iPhone zum Logbuchführen und Ermitteln des
genauen Locators, und man kann mit dem iPad recht komfortabel in den Digi-
modes arbeiten. Sogar SDR-Software ist inzwischen verfügbar. Umfangreiches
Referenzmaterial passt in die Hosentasche. Online-Datenbanken von QRZ bis
Wikipedia stehen überall dort zur Verfügung, wo ein drahtloser Internet zugang
nutzbar ist. Komplizierte Satellitenbahnberechnungen werden zum Kinderspiel,
und auf die Amateurfunkprüfung kann man sich während der Bahnfahrt vor-
bereiten. Noch habe ich revolutionäre Amateurfunksoftware − also Programme,
die kommerziell gern als Killer-Apps bezeichnet werden − nicht gefunden. Es
dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis Programmierer wirklich neue Ama-
teur funkanwendungen mit hohem Gebrauchswert veröffentlichen.
Großes Potenzial sehe ich in der Bedienung und Fernsteuerung von Transcei-
vern oder in der Messtechnik. Bluetooth, Wi-Fi, GSM und UMTS sorgen für die
Kopplung mit anderen Systemen, GPS liefert präzise Daten und die Touch-
screens der Tablets und Smartphones machen Tasten und Drehknöpfe ent-
behrlich.
Erst im letzten Jahr wurde der Wi-Fi Direct-Standard zertifiziert. Geräte können
sich nun auch abseits vorhandener Infrastruktur miteinander vernetzen − Schluss
mit dem Kabelwirrwarr und der Suche nach dem passenden Stecker!
Die technologischen Möglichkeiten sind vorhanden und die Softwareentwickler
stehen in den Startlöchern. Wichtig sind nun weitere zündende Ideen!
Thomas Lindner*
* Th. Lindner ist Autor der Mac-Programme RUMlog, RUMtrol und RUMped
Warum suchen wir denn nicht?
In einer der jüngsten FA-Ausgaben berichteten zwei OMs, dass sie während
einer kleinen DXpedition auf eine Ostseeinsel lange Zeit kaum QSO-Partner
fanden, bis sie endlich im DX-Cluster „gespottet“ wurden. „Hat uns das
Internet wirklich schon soweit im Griff?“ fragte daraufhin ein OM in einem
Leserbrief. Wenn ich über (geöffnete) KW-Bänder drehe, stelle ich gegenüber
früheren Zeiten mitunter eine ziemliche Leere fest. Offenbar warten viele nur
noch auf Meldungen im DX-Cluster.
Nicht anders in den Bereichen oberhalb 144 MHz. Nach den großen Contesten
scheint die Troposphäre wie abgeschaltet zu sein. Selbst wenn jemand im
DX-Cluster weit entfernte Baken meldet, dreht kaum jemand die Antenne in die
betreffende Richtung und ruft CQ − es hört ja eh keiner hin. Da ist es schon ein
wenig schade um die schönen Ausbreitungsbedingungen!
Ebenso auf den Relaisfunkstellen, D-STAR-Repeater mit ihrem Reiz des Neuen
einmal ausgenommen: War vor 20 Jahren ein CQ-Ruf noch Erfolg versprechend
und half vor zehn Jahren noch die Bitte um einen Rapport, steht man heute als
Unbekannter auf einer Relaisfunkstelle ohne QSO-Partner da.
Um es vorwegzunehmen: Ich will hier nicht über den Sinn von 59(9)-Thank-you-
QSOs diskutieren und habe nichts gegen DX-Cluster, zumal ich mich selbst
ihrer bediene. Doch war deren Nutzung früher eher Sache der technisch am
weitesten fortgeschrittenen Spezialisten, was viele zum Nachziehen animierte.
Heute sind PC, Log-Software und Internetanbindung zu einer welt weiten
Massenerscheinung geworden. Das sehe ich nicht als negativ an. Es ist das
Verhalten der Cluster-Teilnehmer, das mich stört.
Weil es so einfach geworden ist, sich gezielt über seltene Stationen informie-
ren zu lassen, die vielleicht einen Bandpunkt, eine IOTA oder ein Locator-Feld
bringen, scheinen viele nicht mehr selbst auf die Suche zu gehen. Insbeson-
dere in den SSB-Bereichen der VHF/UHF-Bänder werden zudem Klön-QSOs
seltener, die Bänder verwaisen. Das dürfte nicht zuletzt den Frequenzhunger
der Kommerziellen anregen!
Weil die Split-Frequenz meist mit im Cluster steht, stürzen sich weltweit hun-
derte Jäger auf das rare Wild. Dabei sind es nicht nur die temperamentvollen
Südeuropäer, die ihre Keule stur auf der angegebenen Frequenz schwin gen.
Und manche davon scheinen das Ziel niemals gehört zu haben … Selbst wenn
dieser unangenehme Nebeneffekt nicht wäre − normale Stationen mit 100 W
oder kleiner Endstufe nebst Dreielement-Beam haben bei derart massivem
Andrang praktisch keine Chance mehr. In der Pile-Up-Hölle rufen zu viele wild
durcheinander. Die QSOs mit den Disziplinierten werden gestört und bisweilen
sogar zerstört. Da verlieren manche noch so engagierte DXpeditionäre einfach
die Lust.
Liebe YLs und OMs, wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir über die wei-
tere Entwicklung nachdenken sollten. Freilich kann ich mit diesen Zeilen nicht
die Welt verändern. Im Sinne der guten Vorsätze für 2011 an ein Back-to-the-
Roots zu appellieren, ist in diesem Zusammenhang gar nicht so abwegig.
Nutzen wir doch neben den üblichen Informationsquellen die modernen tech-
nischen Möglichkeiten. Das kann beispielsweise durch intensive Beobachtung
des Funkbetriebs um die DX-Station herum mithilfe eines SDR geschehen oder
bei CW-Betrieb durch Nutzung des CW-Skimmers (FA 4/08). Damit können wir
unsere Chancen erhöhen und es gleichzeitig der DX-Station leichter machen.
Wie Peter, DL2FI, auf S.107 dieser Ausgabe aufzeigt, bieten uns PC, SDR und
Internet noch viele weitere Hilfsmittel, wobei punktgenaue Ausbreitungsvor-
hersagen und Langzeit-Bakenbeobachtung nur zwei Beispiele sind. Mit diesen
modernen Werkzeugen ausgerüstet könnte sich sogar ein Übers-Band-Drehen
oder CQ-Rufen wieder lohnen − Letzteres kann uns obendrein bald das Mikro-
fon selbst abnehmen, siehe S.114.
In diesem Sinn ein erfolgreiches (DX-)Jahr 2011!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Bilanz und Ausblick
Es ist gute Tradition, am Jahresende kurz innezuhalten und die zurückliegenden
zwölf Monate Revue passieren zu lassen, eigene Stärken und Schwächen zu
erkennen und beim anschließenden Blick nach vorn die richtigen Prioritäten zu
setzen. Auch wir – das heißt Redaktion und Leser service − tun das regelmäßig
und erstellen auf diese Weise unsere Planung für das neue Jahr.
Von den ehrgeizigen Projekten, die 2010 auf unserer Agenda standen, konnten
wir die meisten realisieren. Aber besonders bei den materialintensiven und auf-
wendigen Bausätzen bekamen wir erneut die Unwägbarkeiten des Bau ele men-
te markts zu spüren. Es genügt bereits, wenn es bei einem einzigen Bauteil zu
Lieferengpässen kommt, um die gesamte Bausatzfertigung in die Warteschleife
zu zwingen. Darüber ärgern wir uns mindestens ebenso wie Sie. Andererseits
ist es auch immer wieder ein erhebendes Gefühl, wenn ein neuer Bausatz
ausgeliefert werden kann und auf positive Resonanz stößt.
Die große Nachfrage nach dem FA-SDR-Transceiver nach DL2EWN, dem von
DL1SNG und DL1FAC entwickelten IQ-DDS-Generator, den DH8BQA-Projekten
sowie der FA-SY-Steuer- und -Anzeigeplatine nach DG8SAQ gibt unserer
Einschätzung Recht, auf dem richtigen Weg zu sein und den Nerv der noch
bastelnden Funkamateure zu treffen. Dass wir zwischenzeitlich mit der Zu-
sammenstellung der Bausätze nicht mehr nachkamen, zeigt aber auch, dass
wir unsere Kapazitätsgrenze erreicht haben.
Einen wesentlichen Teil des Erfolgs verdanken wir unseren fleißigen und be-
gabten Entwicklern, die unzählige Stunden ihrer Freizeit in die Projekte inves-
tierten. Ihnen allen gebühren große Anerkennung und herzlicher Dank. Damit
ihr Ideenreichtum und Engagement uns allen noch lange erhalten bleibt, appel-
lieren wir erneut an Sie, auf das Privatleben unserer Entwickler Rücksicht zu
nehmen. Fragen und Anmerkungen zu Bausatzprojekten richten Sie deshalb
bitte ausschließlich an die in der jeweiligen Baumappe angegebene E-Mail-
Adresse oder direkt an den FUNKAMATEUR-Leserservice.
Ein Fortschritt war die Implementierung der neuen Suchfunktion in unserem
Online-Archiv auf www.funkamateur.de. Die Suche nach einem bestimmten
Beitrag in den Inhaltsverzeichnissen der inzwischen 59 Jahrgänge unserer
Zeitschrift wird damit nicht nur komfortabler, sondern bietet auch den Zugriff
auf noch vorhandene Resthefte in unserem Online-Shop. Weil uns viele Fragen
dazu erreichten, haben wir bei dieser Gelegenheit zusätzlich eine Suchmög-
lichkeit über die Inhaltsverzeichnisse des QRP-Reports geschaffen.
Im Alltag − ich denke hier nicht zuletzt an die jetzt anstehende Zusammen-
stellung der Jahrgangs-CD − schon wieder fast vergessen ist der im Früh jahr
erfolgte Umzug des Verlags in neue, schönere Geschäftsräume. Neben dem
laufenden Verlagsbetrieb hat das allen Mitarbeitern eine Menge zusätzlicher
Anstrengungen abverlangt, und manch ein Kunde wird deshalb längere Liefer-
zeiten beklagt haben. Für Ihr Verständnis vielen Dank.
Einige Projekte konnten wir leider immer noch nicht abschließen, z. B. die
Überarbeitung unseres 2-m-FM-Transceiverbausatzes aus dem FA 7/2005.
Wir wissen, dass nach wie vor großes Interesse an diesem Bausatz besteht −
und das, obwohl es fertige FM-Transceiver schon für wenig Geld zu kaufen
gibt.
Die ungebrochene Begeisterung für softwaredefiniertes Radio spiegelt sich
auch in der großen Resonanz zum Beitrag über das Fichten-Fieldday-SDR
im FA 11/10. Viele Leser können es offenbar kaum erwarten, den Bausatz in
den Händen zu halten. Uns geht es genauso. Deshalb arbeiten wir mit Hoch-
druck an der Vorbereitung der Serienproduktion.
Da aber noch weitere interessante Projekte und neue Bücher in Vorbereitung
sind, können Sie nicht nur wegen des FiFi-SDR auf 2011 gespannt sein.
Ihr
Peter Schmücking, DL7JSP
Leserservice
Ende der Printmedien?
Derartiges sagte man bereits in den frühen 90er-Jahren vorher. Erinnern Sie
sich? Wir schreiben das Jahr 1995, im Unternehmen fährt man Windows 3.11
für Workgroups, das Betriebssystem dahinter ist Novell-DOS 7.01. Das Inter-
net ist vorhanden, doch niemand kennt es. Es gibt BTX, erste Menschen mit
PC machen Banküberweisungen per Tastatur − ach wie exotisch …
In einer süddeutschen Zeitung findet sich ein Artikel, verfasst von einem der
ungezählten selbst ernannten Hellseher, der uns weissagt, dass wir in spätes -
tens fünf Jahren in einer papierlosen Welt leben würden. Es gibt keine Laser-
drucker mehr, Kopierer fänden wir nur noch im Deutschen Museum in München.
So stand es geschrieben, so wurde es uns verkündet im Jahr 1995.
Zur Jahrtausendwende prophezeite man uns den größten Datencrash der
Menschheit. „Y2K“ hieß das Zauberwort, und ganze Heerscharen von selbst
ernannten Spezialisten verkauften uns Tools, damit wir keinen Datenverlust er-
leiden. Da übrigens hätten uns die 1995 weggeschriebenen Drucker ganz gut
geholfen, denn mit denen hätten wir einfach alle unsere Daten ausdrucken und
sichern können. Egal − wir haben die Y2K-Geschichte geglaubt und die Software-
angebote angenommen.
Für 2010 hat man uns nicht nur reichlich neue „Apps“ versprochen, sondern
auch verkauft. Wir sind stets und ständig online, wir „laden herunter“, wir
hören Musik „on demand“. Eine Zeitung brauchen wir nur noch, falls wir auf
dem Klo etwas zum Lesen haben möchten. Und auch dort werden wir noch in
diesem Jahr bald einen Beamer aufhängen, damit wir die Tagesthemen in Farbe
an die Wand über der Badewanne werfen können. Ton in Dolby-Surround, „all
inclusive“. Alles mit Pay-per-Letter und wer den Sportteil doppelt liest, der
zahlt auch doppelt.
So, und nun hat uns jemand gesagt, dass demnächst die Printmedien am un-
vermeidlichen Ende sind. Es wird ab 2015 keine Zeitungen mehr geben. Wir
lesen mit tablettartigen „View-Plattformen“, die uns die Heilsbringer aus Cu-
pertino oder Adlershof unter den Weihnachtsbaum legen. Die täglichen News
laden wir dann aus dem Netz herunter. Amen!
Also liebe Leser, nun sollten Sie sich eventuell damit vertraut machen, dass
es ab 2015 keinen FUNKAMATEUR mehr in gedruckter Form geben wird.
Schade eigentlich. War doch eine nette Zeitschrift oder? Vorbei sind die Zeiten
der Druckerschwärze und morgens in der U-Bahn stört auch nicht mehr Ihr
Sitznachbar mit seiner ausladenden Morgenzeitung. Ende und Aus mit dem,
womit uns Herr Gutenberg vor vielen Hundert Jahren beglückt hat. Doch was
sagte kürzlich der deutsche Außenminister Guido Westerwelle anlässlich der
Eröffnung der 62. Frankfurter Buchmesse, die in diesem Jahr unter anderem
von der Diskussion um das E-Book geprägt war: Das elektronische Buch werde
das traditionelle ergänzen.
Nun sind ja Funkamateure eigentlich recht innovative Gesellen. Sie basteln, sie
friemeln, sie erdenken neue Lösungen. Trotzdem bauen diese findigen Men-
schen ihre Endstufen mit Röhren! Wie bitte? Röhren? Ja genau, Amateurfunk
ist eben die gelungene Mischung aus älterer Technik (Röhren und gedruckte
Medien) und den berühmten State-of-the-Art-Lösungen wie D-STAR, HamNet,
SDR usw.
Und weil das so ist, können Sie auch getrost davon ausgehen, dass es auch
nach 2015 aller Voraussicht nach den gedruckten FUNKAMATEUR geben
wird. Als bunte Zeitschrift, die jeden Monat in Ihrem Briefkasten liegt. Beim
FUNKAMATEUR wird die Abschaffung der Printmedien einfach nach hinten
verschoben. Auf unbestimmte Zeit.
Peter John, DL7YS
SDR ist Experimentalfunk auf anspruchsvollerem Niveau
Als im Mai dieses Jahres die Platinen der ersten Serie unseres FA-SDR-Trans-
ceiverbausatzes aus der Produktion kamen und der Entwurf der Baumappe
weitgehend abgeschlossen war, stand ein letzter Testaufbau auf dem Plan,
um sicher zu sein, dass die auszuliefernden Bausätze mängelfrei sind.
Der Aufbau der Hardware verlief völlig problemlos. Nun wäre bei einem kon-
ventionellen Transceiver der Abgleich der Verstärker, Filter, Diskriminatoren,
Phasenregelschleifen usw. an die Reihe gekommen. Beim SDR-Transceiver
gibt es das alles nicht mehr, sondern stattdessen die Installation und die Ein-
richtung der Software. Anstatt mit Schraubendreher oder Abgleichstift an
Spulenkernen zu drehen, sind die Einstellung der richtigen Parameter und
die Betätigung virtueller Schiebesteller gefragt. Sachverstand, Fingerspitzen-
gefühl und Ausdauer braucht man auch in diesem Fall, wenn das Ergebnis
den Erwartungen entsprechen soll.
Obwohl ich inzwischen gelernt habe, wie man mit einigen Macken von Betriebs-
system und Anwendersoftware umgeht, erlebte ich immer wieder Überraschun-
gen. Anfangs wollte der Rechner einfach nicht mit der externen Soundkarte
zusammenarbeiten. Nach stundenlangem Herumprobieren stellte ich entnervt
erst einmal alles beiseite. Aufgeben stand aber nicht zur Debatte. So probierte
ich es am nächsten Tag erneut und stöpselte diesmal unter anderem das USB-
Kabel zufällig in eine andere Anschlussbuchse. Plötzlich funktionierte die Sound-
karte. Bei dieser Gelegenheit lernte ich gleich, die USB-Anschlüsse meines
neuen PC zu unterscheiden.
Während der Konfiguration des SDR-Programms Rocky hatte ich mich leicht-
sinniger weise nicht an unsere Baumappe gehalten und lief deshalb prompt in
eine selbst gestellte Falle: Als zwei Programme gleichzeitig auf den FA-SY-
Controller zugreifen wollten, ging die Initialisierungsdatei in die Brüche und
musste repariert werden. Irgendwann hatte ich dann aber doch einen funk-
tionstüchtigen SDR-Transceiver vor mir − das ist ein wirklich gutes Gefühl, das
ich allen wünsche, die unseren Bausatz aufbauen. Meine Erfahrungen sind
dann in die Baumappe eingeflossen.
Inzwischen konnten wir einigen Funkamateuren helfen, die mit dem Aufbau
oder der Inbetriebnahme des SDR-Bausatzes Probleme hatten. Dabei stellte
sich Folgendes heraus:
Es genügt nicht, die Baumappe und Handbuchübersetzungen „diagonal“ zu
lesen. Jede Einzelheit kann entscheidend sein. Die Bedeutung mancher Hin-
weise erschließt sich sogar erst beim erneuten Durchlesen aus dem Zusam-
men hang.
Das Verständnis der Schaltung des Transceivers und sein Zusammenspiel mit
Soundkarte und PC entscheidet über die Aussicht, einen möglichen Fehler
finden und beseitigen zu können.
Die Handhabung und Bedienung des SDR-Transceivers unterscheiden sich
von denen eines herkömmlichen Funkgeräts. Wer bereit ist, sich vorbehaltlos
umzugewöhnen, hat es leichter.
Bei Problemen mit dem PC gibt es meist Freunde und Bekannte, die mehr
wissen oder andere Erfahrung gemacht haben als man selbst. Man sollte sie
fragen.
SDR-Eigenbau-Transceiver allgemein und die Software im Speziellen bieten
jede Menge Raum zum Probieren und Optimieren. Wer einmal Spaß daran
gefunden hat, weiß, wie sich Experimentalfunk auf einer neuen Qualitätsstufe
anfühlt.
In diesem Sinne wünsche ich allen bastelnden Funkamateuren Mut, Ausdauer
und Erfolg mit der modernen Technik.
Peter Schmücking, DL7JSP
Software fällt nicht vom Himmel
Hin und wieder erreichen uns Anfragen, die sich stets auf das gleiche Ziel
richten: „Können Sie nicht ein Programm schreiben oder schreiben lassen,
das dieses oder jenes kann? Es gibt so etwas Ähnliches zwar schon, aber man
muss es käuflich erwerben. Funkamateure könnten doch schließlich für Funk-
amateure so etwas mal eben zusammenschreiben − ist ja nur Software.“
Wenn das so einfach wäre, könnten doch viele von uns maßgeschneiderte
Programme oder die in den Controller zu ladende Firmware mal so eben schnell
in wenigen Minuten aus dem Ärmel schütteln. Nur gilt es, davor allerlei „kleine“
Hürden zu überwinden. Zum einen ist eine gewisse Grundkenntnis der Rech-
ner- oder Controllerstruktur erforderlich, zum anderen sollte eine passende
Entwicklungsoberfläche vorhanden sein. Letztere bieten Controllerhersteller
oft schon kostenlos mit an, um ihre Produkte besser vermarkten zu können.
Auch für die PC-Seite hat sich in den letzten Jahren der Zugang zu einer
leistungsfähigen Entwicklungsumgebung dank Microsofts .NET-Konzept ver-
einfacht.
Doch auch wenn die Werkzeuge für die Programmerstellung bereitstehen, ist
noch kein Bit der gewünschten Software entstanden. Um zu einem fehlerfrei
laufenden Programm zu kommen, ist eine nicht zu unterschätzende Wissens-
basis notwendig. Erst wenn die Konzeption des Programms stimmt und die
einzelnen Programmteile untereinander effizient arbeiten, entsteht aus einer
Anhäufung von Befehlen ein Produkt, das schnell arbeitet und auch den beab-
sichtigten Zweck erfüllt. Völlige Fehlerfreiheit können nicht einmal renom-
mierte Softwareschmieden garantieren.
Viele Bücherwerbetexte suggerieren, dass bei bloßer Kenntnis der jeweiligen
Programmiersprache die Programme fast von selbst entstehen. Weit gefehlt.
Es heißt nicht nur, fleißig zu arbeiten, sondern auch Murphy in allen Erschei-
nungsformen zu trotzen: Mal hängt sich das Programm auf, mal spielen Hard-
und Software aus irgendeinem Grund einfach nicht zusammen.
Thomas Edison wird der Ausspruch zugeschrieben, dass jede Erfindung aus
10 % Inspiration und 90 % Transpiration besteht. Auch ein Programm stellt
eigentlich nichts weiter als eine Erfindung dar − nur ist sie nicht zu greifen,
sondern wird vom Rechner zum Leben erweckt.
Die für landläufige Aufgaben verfügbare Vielzahl kostenloser Software vermittelt
offenbar weithin den falschen Eindruck müheloser Urheberschaft. In der Folge
versagen die Nutzer solcher Software gern die angebrachte Wertschätzung.
Darüber lohnt es, nachzudenken.
Einen Aspekt dieser Thematik bildet die Verfügbarkeit der Quelltexte. Für einige
Projekte sind die Urdateien, aus den die Maschinenprogramme erstellt werden,
frei verfügbar. Gründe dafür können z. B. genutzte Programmbau steine sein,
die rechtlich eine Wiederveröffentlichung des damit erstellten Programms er-
fordern. Beweggrund, die Software-Dokumentation frei zur Verfügung zu stel-
len, kann aber auch sein, dass ein möglichst breiter Interessentenkreis an der
Weiterentwicklung beteiligt werden soll. Manchmal finden sich auch Projekte,
die nur die Firmware oder das Programm als Fertigprodukt anbieten − wie sie
entstanden sind, bleibt im Dunkeln. Oft ist das eine Vorsichtsmaßnahme, um
Kommerziellen, die gern auch aus solchen Ideenquellen schöpfen, nicht allzu
viel zu verraten oder gar das mühsam in der Freizeit entwickelte Programm
zum Nulltarif und auf einem silbernen Tablett zu präsentieren.
Sieht man sich die Beiträge im FA an, so finden Sie alle Varianten: von offen-
gelegten Quelltexten bis zu lesegeschützten Controllern. In der Regel reichen
die bei Projekten mit Mikrocontrollern gemachten Hinweise aus, um die Firm-
ware neu zu schreiben, wenn die eingangs aufgezählten Grundlagen vorhanden
sind. Die Gründe, die einen Entwickler dazu bewogen haben, sein Produkt
in der einen oder anderen Form anzubieten, sollten jedoch respektiert werden,
ebenso seine Entscheidung, sich seinen erheblichen Aufwand ggf. auch ange-
messen entgelten zu lassen.
Ingo Meyer, DK3RED
Die Bänder beleben
Neulich hörte ich den wohl nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, einmal
ein Buch über solche Orte zu schreiben, die noch in keinem Diplomoder
Aktivitätsprogramm der auch in dieser Hinsicht ideenreichen Funk-
amateure auftauchen. DXCC und IOTA als große Vorbilder haben längst
für viele Funkamateure nicht weniger attraktive Gesellschaft bekommen,
darunter etwa die Gipfelstürmer von SOTA, die Naturliebhaber von WFF
sowie etliche Initiativen mit Punkten für Funkverbindungen mit Leucht-
türmen, Burgen und anderen Bauwerken. Dies sind nur einige von vielen
möglichen Beispielen. Hinzu kommen beinahe wöchentlich neue Sonder-
stationen mit teils überlangen Sonderrufzeichen und/oder exotisch an-
mutenden Präfixen, die meine Logbuchsoftware regelmäßig über das
zugehörige Land rätseln lassen. Den QSL-Büros und -Managern dürfte
dieser kreative Einfallsreichtum von Funkamateuren merkbar zusätzliche
Sortierarbeit bescheren.
Selbst als Nicht-Diplomsammler − abgesehen von gelegentlichen Teil-
nahmeurkunden internationaler HF-Conteste habe ich in all den Jahren
erst eines erarbeitet − kann ich mich auf den Amateurfunkbändern den
Ideen der Aktivierer schon wegen ihrer Vielzahl kaum verschließen. Das
ist auch gar nicht notwendig, denn die meisten dieser Funkinitiativen
erscheinen begrüßenswert, auch wenn man den Anlass für die eine oder
andere schon mit einem freundlichen Augenzwinkern begleiten kann.
Manchmal überrascht der große Erfolg eines Funkprogramms selbst deren
Initiatoren, und nicht alle langjährigen Teilnehmer sind mit einer solchen
Entwicklung immer ganz glücklich. So diskutierten kürzlich Teilnehmer des
SOTA-Programms über den regelmäßig großen Andrang anrufender Sta-
tionen und beklagten deren besonders beim CW-Betrieb teilweise rüdes
Verhalten. Wer den Frequenzbereich um 7032 kHz beobachtet, dem wer-
den die regelmäßig für einige Minuten tobenden Pile-Ups nicht entgehen.
Dann versuchen gleichzeitig etliche Stationen, ins Logbuch einer portablen
Bergfunkstation zu kommen und so SOTA-Punkte zu sammeln. Proble ma-
tisch wird es immer dann, wenn Funkamateure beständig rufen, offenbar
ohne das zuweilen schwache Signal des Bergfunkers selbst zu hören.
Wie auch immer: Solche portablen Aktivitäten von Bergen, aus Natur-
schutzgebieten oder von anderen externen Standorten stellen oft einige
Ansprüche an die Betriebstechnik − auf beiden Seiten des Pile-Ups. Als
anrufende Station trotz oft erschwerter Bedingungen einen vollständigen
Funkkontakt erfolgreich durchzuführen, betrachte ich als gutes Training
für das DX-Gehör und eben für die eigene Betriebstechnik.
Außerdem ist dies Ermunterung und Vorbereitung für eine eigene Aktivie-
rung von einem oder zwei SOTA-Gipfeln am Rande des Harzes, die ich
gemeinsam mit einigen Funkfreunden plane. Wir werden einfach an einem
Nachmittag mit KW-Transceiver, Morsetaste, Akkumulator und Dipolanten-
ne im Rucksack losziehen, um unser Glück auf den Bändern zu versuchen.
Diese Möglichkeit ist einer der Gründe für den großen Erfolg mancher
Aktivitätsprogramme: Mit vergleichsweise geringem Aufwand kann man
einmal probieren, wie es sich anfühlt, selbst am anderen Ende eines
Pile-Ups zu sitzen. Dafür reicht oft schon ein Spätnachmittag, sodass der
zu erwartende Zeitaufwand überschaubar ist. Und wer einmal erlebt hat,
wie gering der allgemeine elektromagnetische Störpegel abseits aller
Siedlungen ist, wird eine solche Funkaktivität, ob allein oder mit Freunden,
immer wieder genießen wollen.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Ohne Fleiß kein Preis
Kürzlich war ich zu einer Festveranstaltung bei einer brandenburgischen
Klubstation eingeladen. Es ging um die feierliche Einweihung des
„Bernau Space Gates“, siehe auch: www.darc.de/y14
Nun ist eine dreh- und schwenkbare Gruppenantenne für 2 m bis 13 cm
nichts großartig Neues, das hat manch einer seit Jahrzehnten zu Hause.
Aber ich staunte nicht schlecht, u. a. den stellvertretenden Bürgermeister
und die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung dort anzutreffen,
von der Lokalpresse ganz zu schweigen. Die Honoratioren wiederum
zeigten sich stark beeindruckt, Signale von der ISS live und quasi in
Rundfunkqualität erleben zu können. So etwas kommt an!
Dagegen kann man mit stundenlangen CQ-59-thank-you-QSOs vielleicht
einen Contestpokal gewinnen, nicht aber das Wohlwollen der örtlichen
Organe. Auch der sonntägliche Schnack mit Hamburg, Paris oder gar
Down Under reißt heutzutage weder Jung noch Alt vom Hocker. Das haben
die Bernauer längst erkannt und so machen sie sich Jahr für Jahr auf lokaler
Ebene nützlich: in diesem Jahr zum Beispiel durch die funktechnische
Betreuung des Motorradtreffens für behinderte Kinder („Jumborun“), durch
simulierte Tierortung mittels Fuchsjagdtechnik bei den Naturschützern
sowie bei der Durchführung einer Notfunkübung zusammen mit der
freiwilligen Feuerwehr. Und jedes Mal ist auch die Lokalpresse vor Ort…
Nachwuchssorgen in Bernau? Mitnichten! Im 45-köpfigen DARC-Orts-
verband Y14 gibt es drei Mitglieder unter 18 Jahren. Zufallstreffer? Nein −
es ist das Ergebnis der jahrelangen Betreuung der Arbeitsgemeinschaft
Amateurfunk/Funkpeilen an einer Schule, wodurch auch Kinder, deren
Eltern mit unserem Hobby nichts zu tun haben, ihren Weg zum Amateur-
funk finden.
Natürlich weiß ich genau, dass es bundesweit zahlreiche solcher „Bernau
Space Gates“ gibt − Gruppen von YLs und OMs, die etwas dafür tun, unser
Ansehen in der Öffentlichkeit zu heben. Ihnen sei hiermit ein großes Lob
ausgesprochen! Doch es sind entschieden zu wenige, die sich aus der
grauen Masse herausheben. Zu viele schwärmen lieber in den Vereins-
zimmern der Wirtshäuser von den guten alten Zeiten und beklagen die
schlechter werdenden Rahmenbedingungen. Nicht selten mündet das in
Statements wie „Die müssten doch mal …“ oder „Die sollten doch …“.
Aber das ist es doch gerade: Wer sind denn „Die“? Wenn wir uns von der
Gesellschaft Anerkennung und Wertschätzung sowie vom Gesetzgeber
funkfreundlichere Gesetze und Schutz vor Funkstörungen wünschen,
müssen wir alle etwas zurückgeben. Und das kann weder das Klön-QSO
im stillen Kämmerlein noch der mit Bratwurst garnierte Antennenwald im
abgeschiedenen Fieldday-Gelände sein − so schön beide auch sind.
Dabei brauchen wir gar nicht etwa auf die nächste Naturkatastrophe oder
ein Verkehrsunglück verheerenden Ausmaßes zu warten. Es gibt der
Möglichkeiten viele, Präsenz zu zeigen und unter Beweis zu stellen, dass
unsere Fähigkeiten der Allgemeinheit Gewinn bringen. In der heutigen Zeit
ist Publizität mehr denn je gefragt, um den Fortbestand des Amateurfunks
zu sichern. Erst wenn wir selbst durch zahlreiche Aktivitäten weiten Kreisen
der Bevölkerung, vom Maurer bis zum Minister, nahegebracht haben, wie
kompetent und nutzbringend Funkamateure sind, wird man unsere An-
tennen nicht mehr scheel anblicken. Und erst dann wird es dem Runden
Tisch Amateurfunk (RTA) möglich sein, unseren in o. g. Vereinszimmern
so lautstark geäußerten Wünschen gegenüber dem BMWi entsprechend
Nachdruck zu verleihen!
Werner Hegewald, DL2RD
Die Ham Radio und ihre Händler
Wenn Sie diese Zeitschrift bekommen, sind es nicht einmal mehr vier
Wochen, bis die Ham Radio, Europas Amateurfunk-Ereignis Nr. 1, zum
35. Mal ihre Pforten öffnet. Das erfolgt dann bereits zum achten Mal auf
dem neuen Messegelände. Dort ist unbestreitbar alles schöner, besser
und komfortabler als auf dem alten Gelände. Die Wege sind wohl kürzer,
die Luft in den Hallen ist selbst bei schwüler Wärme noch erträglich, die
Eröffnung und andere Veranstaltungen sind für zahlreiche Interessenten
live und auf der Video-Leinwand zu verfolgen. Manches mag zwar früher
besser gewesen sein, zum Beispiel das attraktivere Camping, aber das
ist ja wohl bei Veränderungen immer so und nicht Gegenstand dieses
Editorials.
Die Investitionen der Messebetreiber rechnen sich freilich nur, wenn ge-
nügend Aussteller zahlen und hinreichend viele Besucher ihren Obolus
entrichten. Der Höher-schneller-weiter-Trend schlug sich erwartungsgemäß
in den Standgebühren nieder, was viele kleinere Fachhändler zwang, die
Halle A1, messeseitig Rothaus genannt, in Richtung Flohmarkthallen B1 bis
B3 zu verlassen. Dort hatten sie zwar als Kommerzielle ein höheres Salär
als die Privaten zu zahlen, aber weniger als in A1, und waren nicht mehr
im Messekatalog verzeichnet − eigentlich eine faire Lösung.
Das fortschreitende Ausbluten des Rothauses blieb allerdings weder
Besuchern noch Journalisten geschweige denn der Messeleitung ver-
borgen. Wie auf der Messe-Website zu lesen, will man daher ab diesem
Jahr „zum Anfangs-Konzept zurückkehren“ und die Flohmarkthallen von
Neuwaren jeglicher Art freihalten. Ob das nun auch den CW-Tastenbastler
mit seinen in Kleinserie gefertigten Unikaten betrifft, sei dahingestellt.
Die tatsächlich gemeinten Fachhändler werden eingeladen, „… sich als
Aussteller an der Ham Radio/Hamtronic in Halle A1 zu beteiligen“. Dort
waren sie doch aber unlängst hergekommen…
Dass indes gerade die kleinen Händler sozusagen das Salz in der Suppe
sind und Nischen bedienen, die den Großen nicht lukrativ erscheinen,
ist offenbar auch der Messeleitung klar. Jedenfalls erfolgte ein Einlenken
dergestalt, dass es jetzt, auf der Website unter „Aussteller“ übrigens nicht
erkennbar, in einer Ecke der A1 einen ziemlich kleinen Economy-Bereich
gibt, innerhalb dessen besagte Kleinaussteller ihre Neuwaren feilbieten
müssen − wiederum ohne Eintrag im Messekatalog.
Na bitte, geht doch? Möglicherweise nicht: Das viel beschworene „Zurück
zu den Wurzeln“ funktioniert eher selten, weil sich nämlich die äußeren
Bedingungen inzwischen geändert haben.
Zum einen erscheint uns die Fläche des Economy-Bereichs viel zu klein.
Zum anderen steigt das Durchschnittsalter der Funkamateure. Und der
überwiegende Teil der Messebesucher strebt nach Einlass unmittelbar
dem Flohmarkt zu. Das Durchkämmen der Flohmarkthallen wird dabei von
Jahr zu Jahr anstrengender. Dabei bleibt der Zeitfonds gering, kommen
doch die meisten Ham-Radio-Besucher sogar nur einen Tag. Selbst wenn
noch Zeit bleiben sollte, fehlt oft die Motivation für den Weg in die Halle A1.
Auf der Heimfahrt wird man missmutig eine Verarmung der Messe fest-
stellen, während die Eco-Händler ein Loch in der Kasse bemerken und das
nächste Mal vielleicht ebenfalls zu Hause bleiben. Den Schaden, sozusagen
den Red House Blues, hat dann die Messeleitung – aber leider haben wir
ihn alle mit ihr! Wenn nicht eine vernünftigere Lösung gefunden wird, was
eigentlich der DARC e.V. als ideeller Träger der Veranstaltung initiieren
müsste…
Werner Hegewald, DL2RD
Amateurfunk und „man-made noise“
Das terrestrische Umfeld ist ständig elektromagnetischen Strahlungen aus-
gesetzt, die zu einem elektromagnetischen „Rausch“-Hintergrund führen.
Im Bereich der nicht ionisierenden Strahlung, hier speziell für Frequenzen
unter 300 GHz, kann dieser Hintergrund natürlichen oder künstlichen Ur-
sprungs sein.
Natürliche elektromagnetische Strahlungen sind generell atmosphärischer
oder kosmischer Herkunft. Sie kommen von einer Vielzahl unterschiedlicher
Quellen mit unterschiedlichen physikalischen Phänomenen und über-
decken einen weiten Bereich von Frequenzen, zeigen unterschiedliche
Ausbreitungscharakteristiken mit sehr großem Leistungspegelbereich.
Das künstliche, von Menschen verursachte elektromagnetische „Rauschen“
(engl. man-made noise) ist als Folge des technologischen Wachstums
inzwischen dem natürlichen Rauschen weltweit überlagert. In den letzten
Jahrzehnten ist es in Wohn- und Betriebsumgebungen der Industrie nationen
dramatisch auf oder über den natürlichen Rauschpegel angewachsen.
Ein Großteil des Funkverkehrs der Funkamateure findet aus Wohnumge-
bungen statt. Die Zunahme der elektrischen Hilfs- und Kommunikations-
mittel im Heimbereich (Vernetzung) führt jedoch zu einem höheren
Störpegel. Durch Schaltnetzteile, Energiesparlampen, Solaranlagen,
Plasmafernseher und deren Netzteile, In-Haus-Datenübertragung über
Stromleitungen (PLC) usw. wird die elektromagnetische Umgebung zu-
nehmend verschlechtert. Schwache, in vergangenen Jahren voll ausrei-
chende DX-Signale, sind inzwischen schon oft nicht mehr aufnehmbar,
da sie vom stark erhöhten Störnebel verdeckt werden. Ein bestimmungs-
gemäßer Funkbetrieb als Experimentalfunk im Sinne des AFuG ist mit
solchen Gegenstationen daher nicht mehr durchführbar. Selbst der
KW-Rundfunkempfang, für viele eine wichtige Verbindung zur Heimat,
ist vielfach kaum noch möglich.
Die CeBIT 2010 sowie die Hannover Messe 2010 ließen die Tendenzen
der weiteren Elektronifizierung auch im Heimbereich deutlich werden.
Für die Datenübertragung im Haus wird dabei wiederholt auf PLC Bezug
genommen, wobei vor allem Smart-Grid mit Breitband-Powerline und das
Projekt E-Energy für die Zukunft weitere Verschlechterungen der elek tro-
magnetischen Umgebung für die meisten deutschen Funkamateure be-
fürchten lassen − siehe dazu den Bericht in dieser Ausgabe ab Seite 478.
,Grundlegende Forderungen‘ sind im EMVG § 4 unter anderem wie folgt
formuliert: „Betriebsmittel müssen nach den allgemein anerkannten Regeln
der Technik so entworfen und gefertigt sein, dass die von ihnen verursach-
ten elektromagnetischen Störungen kein Niveau erreichen, bei dem ein
bestimmungsgemäßer Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgeräten
oder anderen Betriebsmitteln nicht möglich ist.“
Inwieweit BNetzA und gegebenenfalls deutsche Gerichte in Zukunft bei der
Durchsetzung dieser grundlegenden Forderungen gegenüber möglichen
wirtschaftlichen Interessen helfen werden, bleibt abzuwarten. Nutzen wir
daher unser technisches Know-how, um experimentelle weltweite (!) Funk-
verbindungen auch aus Wohngebieten weiterhin durchführen zu können,
und machen in zunehmendem Maße von der Möglichkeit Gebrauch, quali-
fizierte Störungsmeldungen an die BNetzA zu richten!
Dipl.-Ing. Horst-Dieter Zander, DJ2EV
Alleinstellungsmerkmal Unabhängigkeit
Kürzlich glückte mir abends im 30-m-Band eine Telegrafieverbindung mit
Mike, VP8CMH/mm, der als Funkoffizier und Techniker an Bord der RRS
James Clark Ross arbeitet. Das britische Forschungs- und Versorgungs-
schiff fuhr gerade in antarktischen Gewässern und war auf dem Weg zur
auf dem Brunt Schelfeis gelegenen Forschungsstation Halley, um dort
Wissenschaftler abzuholen und Material anzulanden. Der Andrang auf der
Frequenz aus Europa war ausgeprägt und Mike bediente alle an einem
Kontakt interessierten Funkamateure im Conteststil lediglich mit einem
Rapport, sodass keine Gelegenheit für weitere Fragen bestand.
Fragen hätte ich aber gern gestellt, denn dies war seit vielen Jahren mein
erster Kontakt mit einem Funker des BAS, also des für die Aktivitäten
Groß britanniens in der Antarktis verantwortlichen British Antarctic Survey.
KW-SSB-Signale eines BAS-Wetternetzes waren früher während des ant-
arktischen Sommers von Oktober bis Februar auf Frequenzen etwa 1 MHz
unter- oder oberhalb des 30-m-Amateurfunkbands beinahe täglich in
Europa aufnehmbar und zählten zu den faszinierendsten Hörmöglichkeiten.
Aus jüngster Zeit lagen aber keine Empfangsmeldungen mehr vor, und da
ich auf Mikes Website seine E-Mail-Adresse fand, stellte ich meine Frage
über den Verbleib der Kurzwelle nun eben auf diesem Weg.
Die Antwort aus dem Südpolarmeer kam schon nach wenigen Minuten:
Demnach schicken die Antarktisstationen und Forschungsschiffe des BAS
ihre Wettermeldungen bereits seit einigen Jahren per Internet ans Wetter-
büro in London. Der Informationsaustausch läuft heute über jederzeit ver-
fügbare Satellitenstandleitungen, sodass E-Mails oder Telefongespräche
zwischen Mitarbeitern des BAS weder Mühe noch zusätzlichen Kosten ver-
ursachen. Kurzwellenfunk, so erklärte Mike, nutzt man nur noch zur inner-
antarktischen Kommunikation mit Flugzeugen sowie mit Polarforschern im
Feld. Oder für gelegentliche KW-Kontakte der BAS-Funker untereinander,
wobei die Forschungsbasis Signy gar nicht mehr über solche Anlagen
verfügt. Im weiteren E-Mail-Verkehr ließ er aber durchblicken, dass die
Einführung geschlossener Satellitenverbindungen − im Vergleich zum
früher für alle Teilnehmer offenen KW-Sprechfunk − die schnelle Kommu-
nikation mit Antarktisstationen anderer Nationen mitunter erschwert.
Wir Funkamateure haben dagegen weiter die freie Wahl unserer Kommuni-
kationswege. Zwar ermöglicht heute, wie beschrieben, jeder Internet-PC
den Informationsaustausch sogar mit isolierten Forschungsstationen oder
Schiffen in der Antarktis, sodass dies nicht mehr ein Privileg erfahrener
Funker ist. Als Bedrohung für unser Hobby betrachte ich das weltweite
Datennetz dennoch nicht, sondern vielmehr als ein oft nützliches Hilfsmittel.
Denn das immer noch aufregende Gefühl, dass ein über meine Antenne
abgestrahltes Sendesignal den Funkpartner auf der anderen Seite der Erde
unabhängig von fremden Netzen erreicht, gibt mir nur der Amateurfunk!
Die Teilnehmer des SOTA-Bergfunkprogramms zeigen beispielsweise, wie
sich das Internet als Hilfsmittel des Amateurfunks bewährt. Sie koordinie-
ren ihre Funkaktionen über ein Internetportal, tauschen darüber Tipps aus
und berichten dort nach der Bergaktivierung über Erfahrungen. Auf dem
Berggipfel, ob beim Aufbau der Station oder beim Abarbeiten eines kurzen,
aber oft intensiven Pile-Ups, müssen sie sich aber allein auf die eigenen
Fähigkeiten verlassen: Und dies häufig mit geringer Leistung im QRP-
Bereich sowie in Telegrafie. Diese Unabhängigkeit ist ein zentraler Aspekt
unseres Amateurfunkdienstes, die kein Internet ersetzen kann.
Genießen Sie sie!
Harald Kuhl, DL1ABJ
Minus mal Minus gleich Plus
Minus × Minus = Plus ist pure Mathematik und ist in Bezug auf den
Amateurfunkdienst eine Binsenweisheit. Reflektiert man die Editorials
der vergangenen Jahre im FA, ist der Tenor eher negativ − wenigstens
im Hinblick auf die klubinterne Entwicklung unseres Hobbys, im Hinblick
auf die Zukunft des Amateurfunks im Konzert der drahtlosen Giganten
namens GSM, UMTS, WLAN, Radar, Galileo usw. Kann man aus all diesen
negativen Rahmenbedingungen etwas Positives herauslesen?
Man kann.
Der Amateurfunk war von jeher ein Sammelplatz organisierter Solisten,
von Eigenbrötlern, Bastlern und Friemlern, die im stillen Kämmerlein Dinge
erdachten, die, an das Licht der hochfrequenten Öffentlichkeit gebracht,
im technischen und gesellschaftlichen Sinne auch richtungsweisende
Bewegungen initiierten. Und da gab es Zeiten, in denen sich der Amateur-
funk im Bereich Forschung und Entwicklung durchaus mit den kommer-
ziellen Anwendern auf Augenhöhe befand. Manch renommierter Entwickler
der deutschen Elektronikindustrie ist damals aus den Reihen besagter
Bastler und Friemler hervorgegangen. Diese Zeiten sind, von ganz wenigen
Ausnahmen abgesehen, vorbei. Unwiderruflich.
Dem mag man nachtrauern, aber das Rad der Geschichte lässt sich eben
nicht zurückdrehen. Um es auf den Punkt zu bringen: Wir sind (wieder!)
eine Gruppe organisierter Solisten, von Eigenbrötlern, Bastlern und
Friemlern, die im stillen Kämmerlein etwas zimmern. Jetzt zwar mit Voice-
over-IP, WSJT, Windows und DSP. Funkamateure erdenken sinnhafte Bau-
gruppen, die nun nicht mehr mit einer ECC88 oder einem AC125 arbeiten,
sondern mit den Produkten aus dem Hause ATMEL oder Mikrochip und
die von „selbst gemachter“ Software angetrieben werden. Das ist schon
fast State-of-the-Art − aber eben nur fast. Wir können uns einfach nicht
mehr mit den drahtlosen Giganten der Elektronikindustrie messen. Das
kann man als negativ einordnen, das kann man gelassen zur Kenntnis
nehmen, ignorieren kann man es nicht. Aber viele von uns haben sich in
die Auffassung, dass das etwas Negatives sein muss, geradezu verrannt.
Das ist meiner Meinung nach falsch.
Was nämlich ist an dieser Entwicklung positiv? Wir kommen trotz Ein-
steigerlizenzen mit Minimalanforderungen wieder zurück zu den Wurzeln
des Amateurfunks. Funkamateure wie Michael, DB6NT, Wolfgang, DJ8ES,
Bernd, DK3WX, Peter, DL2FI, James, G3RUH, u. v. m. haben dem Ama-
teurfunk im wahrsten Sinne des Wortes wieder den Lötkolben in die Hand
gedrückt. Wir dürfen weiterhin mit selbst gebauten Geräten Funkbetrieb
machen, wir können dafür selbst gebaute und manchmal selbst entwickelte
Antennen benutzen. Das i s t positiv. Auch wenn es mit GSM meist besser,
schneller, höher oder weiter geht.
Der Wermutstropfen, den ich in dieser Entwicklung gefunden habe, ist die
sinkende Anzahl der HF-infizierten Bastler und Friemler. Wir leben zwar
in einer technisierten Welt, das heißt aber merkwürdigerweise nicht, dass
immer mehr Menschen technisch interessiert sind. Ein zusätzliches Icon auf
den Desktop zu ziehen macht keinen technisch interessierten Menschen aus.
Aber einen USB-Adapter nebst Interface zu löten, der mit der passenden
Software den Antennenrotor steuert, das machen nur wirklich technisch
interessierte Bastler und Friemler.
Auf Wiederlöten und auf Wiederbasteln!
Peter John, DL7YS
Vom Frust zur Lust
Was waren das doch für Zeiten! Ein Gartengrundstück auf einem der
höchsten Punkte im Barnim nannte man sein Eigen, ringsherum fast nur
Ackerland, der nächste Nachbar in HF-sichererem Abstand gelegen.
Eine Vielzahl an Antennen und Endstufen stand zur Verfügung − kaum
ein Contest, ob auf den KW- oder UKW-Bändern, wurde verschmäht.
Doch dann kam die Wende (nein, nicht was Sie jetzt denken). Getreu
dem Motto „Wohnen im Grünen“ zog es vor einigen Jahren die Stadt-
menschen in Scharen in den so genannten Speckgürtel Berlins. Flugs
war ich von jeder Menge Eigenheimen mehr oder weniger umzingelt.
Obwohl sie meine Antennen gesehen haben mussten, konnten sie die
Bauerei nicht lassen. Dazu gesellten sich schier unglaubliche Erfahrun-
gen: „Die Kühlschranktür schließt nicht mehr richtig, wenn Sie funken.“
„Das Licht im Aquarium flackert.“, usw. Sämtliche in HF-Reichweite
befindlichen und mit Klingeldraht verlegten Bewegungsmelder sprangen
im Takt der CW-/SSB-/WJST-/PSK-Aussendungen an, was vor allem nach
Einbruch der Dunkelheit auch Nicht-Funkamateuren auffallen musste.
Die Nachbarn nervten … Und ich war frustriert. Die KW-Endstufe wurde
eingemottet, und die gestockten UKW-Antennen zielten nur noch Richtung
Süden. Den Rest gab mir dann ein Frühjahrssturm, der den KW-Beam und
die UKW-Antennen zerlegte. Seitdem ist es in JO62SP ziemlich ruhig
geworden.
Da kam es gerade Recht, dass die Funkfreunde und über viele Jahre hinweg
fleißigen UKW-Contester von DF0TEC aus dem Nordosten unseres Landes
mal etwas kürzertreten wollten. Sie unterbreiteten DF0FA, der Klubstation
des FUNKAMATEURs, das Angebot, ihren beeindruckenden Standort in
JO73CF bei einigen Contesten gemeinsam zu nutzen. Man traf sich zum
Mai- und September-Contest, verbrachte zusammen, neben dem Contest-
betrieb, erlebnisreiche und frohe Stunden mit Bratwurst und Bier am Grill.
Durchaus nicht nebenbei stellten sich recht zufriedenstellende Contest-
ergebnisse ein. Ich konnte mich endlich einmal wieder richtig austoben
und bekam Lust auf Mehr. Es war eine prima Alternative zu den Querelen
am Heimatstandort. Dieser Art Freiluft-Contestaktivitäten wollen wir nun-
mehr treu bleiben – wie schon längst viele Funkamateure mit ihren Teams.
Zudem gewinnt man den Eindruck, dass das Interesse an UKW-Contest-
aktivitäten keineswegs stagniert, sondern in jüngster Vergangenheit
gewachsen ist. Das belegen die Statistiken. An Gelegenheiten, die VHF-/
UHF-/SHF-Bänder zu beleben, mangelt es wahrlich nicht. Es beginnt schon
im Februar im Rahmen des DARC-UKW-Contestpokals mit dem UKW-
Winter-Fieldday (parallel dazu der Winter-BBT), gefolgt Anfang März vom
VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, im April vom UKW-QRP-Wettbewerb,
dann Anfang Mai vom nächsten VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb.
Im Juni folgt ein reiner Mikrowellen-Contest. Höhepunkt bezüglich
der Portabelaktivitäten dürfte im Juli ein weiterer VHF-, UHF-, Mikrowel-
len-Wettbewerb sein. Im August lockt der UKW-Sommer-Fieldday und ab
September bieten die IARU-Region-1-Conteste monatlich gute Gelegenhei-
ten, um etliche neue Stationen oder Mittelfelder ins Log zu schreiben.
Diese Aufzählung ist längst nicht vollständig.
Die genauen Contest-Termine entnehmen Sie bitte den monatlichen Termin-
seiten im FUNKAMATEUR. Lassen Sie sich selbst bei schlechtem Wetter
nicht davon abhalten, wenigstens zu Hause die Station einzuschalten–
solange Sie noch können. Oder hören Sie sich in Ihrem Ortsverband einmal
um, ob aktive Contest-Teams nach tatkräftiger Unterstützung suchen.
Viel Freude bei der Ausübung unseres schönen Hobbys!
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Licht und Schatten
Der Leserservice des FUNKAMATEUR hat sich im Laufe der letzten Jahre
zu einer festen Größe entwickelt − für die Leser unserer Zeitschrift ebenso
wie für das Unternehmen selbst. Wir, das sind inzwischen vier fest ange-
stellte Mitarbeiter, beliefern einen unterversorgten Nischenmarkt mit vielen
Dingen, die außer uns kaum jemand im Angebot hat. Auf diese Weise ist
der Leserservice zu einem wichtigen Standbein der Box 73 Amateurfunk-
service GmbH geworden.
Im neuen Jahr stehen einige interessante Projekte auf unserer Agenda.
Da wäre zuerst der Bausatz für den FA-SDR-Transceiver zu nennen, dessen
Auslieferung Ende Januar beginnen soll. Das ist zwar um ein paar Wochen
verspätet, aber diese Zeit hat das Entwicklerteam um Harald Arnold,
DL2EWN, für die letzten Feinarbeiten an Schaltungsdesign und Platinen-
layout gebraucht. Der Schritt vom funktionierenden Prototyp zur Serie
nachbausicherer Bausätze erfordert oft die Lösung unerwartet auftreten-
der Probleme, die technischer sowie logistischer Art sein können.
Nicht nur wir haben erfahren müssen, dass SDR-Projekte viele Tücken
haben, die auch erfahrene HF-Techniker ins Schwitzen bringen. Unzuläng-
lichkeiten bei unseren Bausätzen wollen und können wir uns aber nicht
leisten. Das sind wir unserem guten Ruf schuldig, vom vermeidbaren Auf-
wand ganz abgesehen.
Die nächste große Herausforderung ist die Realisierung des I/Q-DDS-Gene-
rators, den wir nicht nur als Bausatz, sondern später auch als Fertiggerät
anbieten wollen. Für uns ist das eine Premiere der besonderen Art, denn
wir brauchen die CE-Zertifizierung, eine EEE-Registrierung und müssen
RoHS-konform produzieren.
Auf dem Plan steht weiterhin ein Contest-Keyer mit vielen praktischen
Funktionen, den sich Oliver Dröse, DH8BQA – selbst passionierter Con-
tester − ausgedacht hat und der in einer der nächsten Ausgaben des FA
beschrieben wird.
Inzwischen nimmt auch das Projekt „B-1221“, in dem es um einen nach-
bausicheren 2-m-FM-Transceiver geht, wieder Gestalt an. Günter Borchert,
DF5FC, und Wulf-Gerd Traving, DL1FAC, arbeiten an einem Prototyp, der
sich durch den Einsatz moderner Bauelemente auszeichnet. Sein Herz ist
ein programmier- und frequenzmodulierbarer Quarzgenerator vom Typ
Si571, der eine aufwändige PLL überflüssig macht. Als Sendeverstärker
soll ein Power-Modul von Mitsubishi zum Einsatz kommen, was den Ab-
gleich gegenüber dem ursprünglichen FM-Trans ceiver aus FA 7 und 8/05
er heblich vereinfachen wird. Diesen Bausatz sehen wir als unseren Beitrag
für die Nachwuchsarbeit an.
Zu guter Letzt bitten wir um Verständnis dafür, dass wir nicht alle guten
Ideen realisieren und nicht zu jedem vorgestellten Selbstbauprojekt einen
Bausatz an bieten können. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir unsere
Kapazitätsgrenze inzwischen erreicht haben und keine Abstriche bei der
Qualität machen wollen. Schade ist auch, dass wir einige Projekte, die wir
uns für 2009 vorgenommen hatten, nicht umsetzen konnten. Aber aufge-
schoben ist nicht aufgehoben.
Und so werden wir alles daransetzen, auch in Zukunft ein möglichst breites
Spektrum an interessanten Produkten anzubieten, damit der Lötkolben in
der Hobbywerkstatt keinen Anlass hat, kalt zu werden.
In diesem Sinne − haben Sie Spaß beim Selbstbau!
Peter Schmücking, DL7JSP
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
up… up… split… up…
Sie kennen diese Zeichenfolge? Die Murphys universellem Gesetz folgend
genau dann Ihren Empfänger zustopft, wenn sich Ihr Gehör gerade an das
leise Signal aus Gegenden gewöhnt hat, wo die Rufzeichen mit KH oder
VP beginnen? Glauben Sie mir, Murphy war ein Optimist.
Ich bin nach einer Pause von fast zwei Dekaden wieder auf die Kurzwelle
zurückgekehrt. Mich interessiert DX und ich versuche mit moderaten
Mitteln, etwa 25 W in Telegrafie und resonanten Dipolen, weit entfernte DX-
Stationen zu arbeiten. Das gelingt nicht auf Anhieb, es erfordert Hören (!)
und Geduld. Dadurch bekommt man leider auch mit, was sich auf den
Bändern so abspielt − aber das hat mich dann doch heftig verschreckt!
Ich meine nicht die gezielten Störungen auf den Frequenzen von FT5GA
oder K4M, so etwas hat es schon vor 30 Jahren gegeben. Ich meine die
unsägliche Arroganz, mit der sich selbst ernannte Top-DXer, auch deut-
sche, auf den Bändern benehmen und auf dem DX-Cluster ausbreiten.
Da wird dem DXpeditionsleiter in einem Forum die Antennenausrüstung
vorgeschrieben … Originalton: „Die G5RV ist Mist und ein Spiderbeam
sollte durch ein phased Array ersetzt werden.“ Da wird den DXpeditions-
mitgliedern „Holiday-Mentalität“ vorgeworfen, weil sie um Verständnis
bitten, wenn sie auch einmal etwas essen oder Antennen reparieren
möchten. Da werden ultimativ und rüde bestimmte Modi und Frequenzen
gefordert. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen, wobei ich nur von Er-
güssen deutscher Funkamateure rede.
Viel schlimmer ist für mich die sich einbürgernde Betriebstechnik, speziell
mancher so genannter „Top Guns“. Hier sind einige Dinge, die das DXen
an sich wohl immer unpopulärer machen: Die Brutalität, mit der sich solche
Zeitgenossen Gehör verschaffen. Ohne hereinzuhören einfach erst einmal
den Papagei auf Dauerfeuer stellen. Das eigene Rufzeichen mindestens
dreimal hintereinander geben und weitermachen, obwohl die DX-Station
schon längst antwortet. Voll-BK? Hab ich stillgelegt, sonst würde ich ja die
Antwort der DX-Station hören, bevor ich ausgeredet habe. Bei Simplex-
Betrieb so lange dazwischen zu brüllen, bis die DX-Station entnervt den
Dauerrufer annimmt, um bald danach gestresst aufzuhören. Kommentar
eines solchen „Top DXers“: „Hätte er Split-Betrieb machen sollen…“
Und um auf die Überschrift zurückzukommen. Jeder tappt auch mal dane-
ben. Aber muss daraus gleich eine Lawine von Zurechtweisungen und/oder
Beschimpfungen werden, die manchmal jeden weiteren Betrieb unmöglich
macht?
Was mich neben den selbst ernannten „Air Marshalls“ jedoch am meisten
ärgert, ist das erwähnte brutale Dauerrufen, um dann bei Aufnahme ins
QSO erst das Rufzeichen zu erfragen und dann noch dreimal nachzufragen
(CW anno 2009). Ich bin da ganz ehrlich: Wenn solche Verhaltensweisen
einen Top-DXer auszeichnen, möchte ich nie einer werden.
FT5GA und TX5SPA habe ich mit Geduld zumindest auf einem Band gear-
beitet. T6YA gelang mir wegen der beschriebenen Betriebstechnik diverser
Europäer nicht. Der OP hat viermal mein Teilrufzeichen DK5D? gesendet,
aber das interessierte die anderen gar nicht. Schade.
Heilungschancen? Sehe ich nicht. Abgesehen davon, daran zu appellieren,
dass unser Hobby nur mit sozialem Verhalten seitens aller Interessengrup-
pen funktioniert.
DX-Cluster abschalten? Der ist nur ein Werkzeug. Im angelsächsischen
Raum gibt es ein Sprichwort „A tool can be used or abused“ − auf Deutsch:
„Gebrauch und Missbrauch liegen nahe beieinander.“ Man müsste doch nur
die Regeln 17 bis 19 der Empfehlungen für DX-Pile-Ups vom bekannten
DX-Editor Carl Smith, N4AA (siehe Download-Bereich auf der FA-Web site),
beachten.
Gute Besserung wünscht
Peter Glasmacher, DK5DC, AA6HM
Wer nicht hingeht, ist selbst schuld!
Zahlreiche Treffen, Märkte, Messen und Tagungen buhlen jedes Jahr um
die Gunst der Funkamateure; kleinere wie größere, regionale, überregio-
nale und alle mit durchaus unterschiedlichen Schwerpunkten. Manche
Organisatoren setzen konsequent auf technisch-wissenschaftlichen
An spruch und ebensolche Vorträge, andere mehr auf das Gemein-
schaftserlebnis, einen großen Flohmarkt oder möglichst viele kommer-
zielle Anbieter.
Schade nur, dass auf vielen Veranstaltungen spätestens ab Mittag reich-
lich Platz in den Gängen ist. Die Zahl derjenigen, die sich von solchen
Treffen angezogen fühlen, ist sicht- und fühlbar kleiner geworden. Die
Gründe dafür sind vielfältig und reichen von schlichter Bequemlichkeit
über das mitunter befremdliche Preisniveau der angebotenen Waren
bis zur schnellen Verfügbarkeit von Informationen und Produkten über
das Internet. Auch gibt es mittlerweile zahlreiche Inhaber eines Ama-
teurfunkzeugnisses, die weniger an der Technik als mehr an der darauf
basierenden Kommunikation interessiert sind. Das mag man bedauern,
wegdiskutieren lässt es sich nicht.
Ein wesentlicher Anreiz zum Besuch sind gut sortierte, themenspezi-
fische Flohmärkte. Wer beispielsweise einer technisch orientierten
Fachtagung wenig abgewinnen kann, schaut zumindest wegen des
Flohmarkts vorbei, auch wenn dieser nur konzeptionelles Beiwerk ist.
Umso ärgerlicher, wenn man feststellen muss, dass zahlreiche Händler
überwiegend Elektroschrott anbieten, dies oft kombiniert mit überzo-
genen Preisvorstellungen und einem frühzeitigen Abbau ihrer Stände.
Dass Flohmarkt-Schnäppchen und ansprechende Angebote selten
geworden sind, trägt zu einem allmählich abnehmenden Besucher-
interesse maßgeblich bei.
Es ist ein gewisser Sättigungseffekt eingetreten. Viele Amateure und
Elektronikbastler decken sich mittlerweile preisgünstig im europäischen
Ausland und per Internet-Versandhandel ein. Einige kommerzielle An-
bieter erscheinen nicht mehr, weil sie ihre Umsatzerwartungen nicht
erfüllt sehen − ein Teufelskreis. Am Ende dieser Entwicklung wird das
stehen, was wir auch in vielen anderen Bereichen bereits erlebt haben:
Ein paar Große werden überleben, alle Kleinen werden nach und nach
verschwinden. Wollen wir das wirklich?
Funkamateure und Elektronikbastler verbringen oft viel Zeit unterm Dach,
im Keller oder in der Garage. Jede Zusammenkunft ist daher eine gute
Gelegenheit zur Erweiterung des eigenen Horizonts, für soziale Kontakte,
zum Kennenlernen und Treffen, für den Austausch mit Gesprächspart-
nern und Gleichgesinnten, die man sonst nur per Funk oder aus einem
Internet-Forum kennt. Schon alleine deshalb sind wir alle aufgerufen,
dieser unerfreulichen Entwicklung nach Kräften entgegenzuwirken.
Die Veranstalter sollten überdenken, ob das eigene Konzept durch be-
hutsame Korrekturen nicht noch gewinnen kann. Anbieter von Waren
sind gut beraten, ihre Angebote möglichst attraktiv zu gestalten, wenn
sie sich nicht früher oder später als reiner Internet-Versandhändler
wiederfinden wollen. Für die potenziellen Besucher sollte zumindest
das Erscheinen auf den lokalen Veranstaltungen eine Selbstverständ-
lichkeit sein, demonstriert man doch damit seine Wertschätzung für
die Arbeit der Organisatoren. In diesem Sinne: Wir sehen uns!
Peter Pfliegensdörfer, DL8IJ
Ein Traum, oder?
Neulich habe ich den halben Samstag auf dem Sofa gesessen und in
Amateurfunk-Publikationen geblättert. Mein selbst gewähltes Thema:
„136 kHz − das letzte Feld der Experimentalfunker“. Zugegeben, kein so
heißes Thema; da können einem schon die Augen zufallen.
Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, könnte man doch im OV eine Lang-
wellen-Aktion starten. Eine Handvoll OMs (Taskforce „Lange Welle“) setzt
sich zum Ziel, die Klubstation auf 136 kHz in die Luft zu bringen. Team A
aus dem OV (bestehend aus zwei OMs, die fehlerfrei mit Europakarten
umgehen können und wenig kalte Lötstellen produzieren) baut in Freiluft-
verdrahtung einen brauchbaren Konverter für den betagten OV-Transceiver,
der 136 kHz auf 16 MHz umsetzt. Mit einem Bandfilter und Vorverstärker
kann Team A etwas hören. Der Digital-Papst unseres OVs zimmert mit
Team B einen DDS, der direkt einen passenden Sinus auf besagten 136 kHz
erzeugt. Der lässt sich wiederum problemlos einer Endstufe zuführen, die
von Team C (genannt „Power“) mithilfe preiswerter IRF640-FETs 100 W
auf die Antenne gießt. Selbige ist eine L-Antenne mit Ladespule. Zum Bau
der Spule verwendet das dafür gegründete Team D (Spitzname „Henry“)
eine Kunststofftonne aus der Düngemittelindustrie mit einem Durchmesser
von 800 mm und einer Höhe von 1500 mm. Auf ihr werden knapp 900 Win-
dungen Kupferdraht mit zwölf Anzapfungen angebracht.
An einem Samstag treffen sich die vier Teams bei mir im Garten, um die
einzelnen Baugruppen im Zusammenspiel zu testen. Alles funktioniert, die
Zusammenschaltung klappt, das Umschalten von Senden auf Empfang
geschieht noch durch Umstöpseln von Hand, der Sender und die End-
stufe funktionieren, doch mein Hund pinkelt an die Ladespule. Es kommt
zu Verpuffungen!
Nun könnte das erste QSO gefahren werden, aber niemand weiß so recht,
wie man eine Taste an unser Kunstwerk anschließen könnte. Letztlich fährt
der Leiter vom Team D (immer noch Spitzname „Henry“) ein CW-QSO,
indem er mit einem Schraubendreher zwei Pins am Controller des DDS
kurzschließt (Teamleiter B gibt den entscheidenden digitalen Hinweis). Der
Rapport unseres QSO-Partners geht im Gejohle der Teams A bis D unter.
Aber das ist ja auch nebensächlich. Längst haben alle Teammitglieder eine
wilde Diskussion begonnen, wie man die Station verbessern könne. Eine
vernünftige Sende-Empfangs-Umschaltung muss her, der Anschluss an
eine Soundkarte ist ein Muss, die Antenne sollte besser werden, und wel-
cher Narr hat denn eigentlich das Bandfilter gewobbelt? Das war wohl
nichts!
Schließlich bin ich aufgewacht. Es war alles nur ein Traum. Es besteht
kein Team B, es existiert kein Konverter für 136 kHz, es gibt auch keine
Ladespule. Gibt es nicht? Warum eigentlich nicht? Denken Sie einmal
darüber nach! Zwei Mann je Team, das sind acht Leute, die sich eventuell
aufraffen, im OV ein gemeinsames Projekt zu starten. Es muss ja nicht
136 kHz sein. Eine 23-cm-Station für den nächsten Portabeleinsatz beim
Fieldday tut es auch; selbst der 70-cm-Contest am 3. 10. und 4. 10. 09
bietet sich an, und der für CW-Puristen un ver meidliche Marconi-Contest
auf 2 m geht am 7. 11. und 8. 11. 09 über die Bühne. Oder bereiten Sie
doch schon einmal den Betrieb auf 70 MHz vor. Beträfe einen Transverter
(könnte wieder Team A übernehmen), Antenne (Team B) usw. usw.
Was ich damit sagen bzw. schreiben will? Unternehmen Sie einmal etwas
gemeinsam im OV. Amateurfunk als Gruppentherapie. Das ist es!
Peter John, DL7YS
Politik vs. Technik: 5:0
Es ist wieder IFA in Berlin. „Funkausstellung“ darf man nicht mehr sagen,
sonst sind die Kühlschränke und Waschmaschinen beleidigt, die mittler-
weile Radios und Fernsehern die Messehallen streitig machen. Und auch
dieses Jahr wird von einem selbst ernannten Retter DAB, der designierte
Nachfolger des UKW-FM-Rundfunks, beerdigt.
Technische Gründe hatte das noch nie: DAB, ein für mobilen Radioempfang
ausgelegter MP2-Audio-Datenstrom − in der moderneren Variante DAB+ mit
MP4 runderneuert − ist technisch auch 19 Jahre nach dem Start noch das
beste System für lokales Digitalradio.
Allerdings gab es anfangs gar keine Geräte, dann keine tragbaren Geräte,
dann keine bezahlbaren Geräte. Das hat sich geändert: DAB-Empfänger
sind inzwischen ab 70 € im Handel erhältlich. Mit dem Duschradio für 10 €
kann das zwar noch nicht mithalten, aber in der Dusche stört es ja auch
nicht, wenn es rauscht.
An Frequenzen mangelte es zunächst ebenfalls. Zudem waren die Sende-
leistungen durch Eingaben der frequenzmäßig benachbarten Bundeswehr
stark beschränkt, sodass DAB-Empfang nur im Freien möglich war, nicht
aber in Gebäuden. Auf der WRC 2007 wurde die Erweiterung der DAB-Ver-
sorgung dann genehmigt und die ARD räumte das VHF-Fernsehfrequenz-
band komplett zu Gunsten des Digitalradios.
Doch immer wieder andere untechnische, politische Gründe blockieren
DAB. Mal waren die nördlichen Sendeanstalten dagegen, weil DAB aus
Bayern kam, dann die ARD-Intendanten, weil sie im heutigen UKW-Fre-
quenzplan die dickeren Sender haben dürfen – und sich deren Betrieb auch
leisten können. Dann die KEF, die Kommission zur Ermittlung des Finanz-
bedarfs der (öffentlich-rechtlichen) Rundfunkanstalten: Sie sperrte uner-
wartet den Geldhahn, als die Erweiterung von Sendekanälen und -leistung
anstand.
Die kommerziellen Sender, die nun Dutzende digitaler Sendekanäle bei
erstmals gleicher Sendeleistung wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk
haben könnten, sind aber ebenfalls klamm: Da die Werbeeinnahmen bei
DAB zunächst gering sind, wollen sie es nicht mehr − so, wie das kommer-
zielle Fernsehen inzwischen außerhalb der Ballungsräume auf die DVB-T-
Frequenzen verzichtet.
Damit die ARD das neue Medium nicht alleine belegt, hat der VPRT (Ver-
band Privater Rundfunk und Telemedien e.V.) sich kurz vor der anstehen-
den Entscheidung bei der KEF gegen DAB ausgesprochen − mit Erfolg.
Dies heißt zwar nicht gleich Abschalten − aber eben auch nicht ausbauen.
Es bleibt bei sieben bis acht mancherorts ziemlich trockenen Programmen
mit schwacher Sendeleistung, für die sich kaum jemand neue Empfänger
kaufen wird.
Stattdessen soll nun HD-Radio zum Zuge kommen. Ein System ähnlich
RDS, das einem normalen UKW-FM-Signal ein paar Digitaldaten mitgibt.
Das funktioniert jedoch nur in den USA mit wenigen Sendern, nicht in
unserem dicht belegten UKW-Band und, ähnlich Stereo, nur unter starkem
Reichweitenverlust (maximal –20 dB Pegel des Unterträgers). Webradio
ist auch nicht die Lösung: Server und Mobiltelefonnetze können Millionen
von Hörern gar nicht versorgen.
Ebenso wie Analog-TV ist die Abschaltung von Analog-Radio durch die EU
bereits beschlossen: Spätestens 2020 ist FM Geschichte − und damit auch
HD-Radio. Aus derzeitiger Sicht bliebe uns Radio lediglich über Satellit
erhalten − digital. Man darf gespannt sein, was sich die deutsche Medien-
landschaft bis dahin einfallen lässt.
Wolf-Dieter Roth, DL2MCD
Gemeinschaft zählt
Gemeinschaften im Internet − die so genannten Virtual Communities–
verzeichnen ständig steigende Nutzerzahlen. Dies gilt besonders für
themenzentrierte Gruppen, die heute eine wichtige Informationsbörse
im weltweiten Datennetz sind. Der Grund für ihren Erfolg, so das wenig
überraschende Ergebnis von Studien, sind ein erkennbares gemeinsames
Ziel und das Interesse der Teilnehmer. Letztlich bedient das Internet damit
ein Bedürfnis nach Austausch, das auch vor seiner Verbreitung bereits
bestanden hat, und das die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten − nun
eben gegen laufende Übertragungsgebühren − befriedigen.
Für die Gemeinschaft der Funkamateure ist der Informationsaustausch
über Kommunikationsnetze seit jeher Alltäglichkeit − ob per Morsetaste,
Mikrofon oder PC-Tastatur. Dabei dominieren weiter drahtlose Wege, doch
ist auch das Internet für viele Funkamateure eine mittlerweile wichtige Platt-
form zur Informationssuche und zum Erfahrungsaustausch. Während
Packet-Radio an Bedeutung verloren hat, entstehen gleichzeitig, etwa
mit der zunehmenden Verbreitung von D-STAR, neue Funknetze. Die von
uns genutzten Technologien entwickeln sich weiter und das hält unser
technisches Hobby lebendig. Es lebt vom Austausch zwischen Funkama-
teuren, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen gerne weitergeben.
Dazu bestand auf der Ham Radio und beim Bodenseetreffen der Funk-
amateure wieder reichlich Gelegenheit, in diesem Jahr zum 60. Mal. Wer
nun aber erwartete, in den zahlreichen Vorträgen auf Europas größter
Amateurfunkmesse würde deshalb der wehmütige Blick zurück auf ein
vergangenes vermeintliches „goldenes Zeitalter“ des Amateurfunks, in dem
alles besser war, dominieren, der war zu pessimistisch. Vielmehr wurde das
bereits Erreichte als solide Basis und Ausgangspunkt für künftige Heraus-
forderungen, denen wir Funkamateure uns zu stellen haben, gewürdigt.
Herausforderungen gibt es genug: beispielsweise die zunehmende Be-
drohung unserer Frequenzen durch Störungen aus dem Stromnetz etwa
mit der Verbreitung von PLC oder vom unzureichend abgeschirmten
Fernseher des sonst so elektrosensiblen Nachbarn. Hier müssen wir mit
Berichten an die BNetzA selbst noch wesentlich aktiver werden, damit
diese die Hersteller technisch minderwertiger Geräte zur Verantwortung
ziehen kann. Die Verbände können zwar allgemein auf die Störproblematik
hinweisen, doch um die Mitteilung des konkreten Falls müssen wir uns
selbst bemühen. Von allein ändert sich nichts.
Zu den Herausforderungen gehört weiter das Gewinnen von Nachwuchs
für den Amateurfunk. Auch das können wir nur als Gemeinschaft vor Ort
mit Aktionen bewältigen, die den besonderen Reiz unseres vielseitigen
Hobbys herausstellen und bekannter machen. Der Arbeitskreis Amateur-
funk und Telekommunikation in der Schule (AATiS e.V.) bemüht sich seit
15 Jahren unter anderem mit regelmäßigen Lehrerfortbildungen erfolgreich
darum, das Thema Amateurfunk in den Physikunterricht der Schulen zu
tragen und so bei den Schülern Begeisterung für Technik zu wecken.
Dieses ehrenamtliche Engagement wurde nun auf der Ham Radio mit der
Verleihung des Horkheimer-Preises verdient gewürdigt. Wir alle können
es unterstützen, indem wir das geweckte Anfangsinteresse der Schüler
aufgreifen und ihnen etwa in unseren Klubstationen vermitteln, was Ama-
teurfunk in der Praxis bedeutet.
Über alle Grenzen hinweg hat es der Amateurfunk immer verstanden,
Menschen mit einem gemeinsamen Interesse zusammenzuführen. Das
zeigt sich nicht nur einmal jährlich in Friedrichshafen, sondern täglich auf
den Bändern und zählt zu unseren Stärken.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Jetzt also Glorioso!
Rundherum nichts als Meer und irgendwo im Nirgendwo drei, vier Felsen,
so klein, dass erst einmal ein Zimmermann eine Plattform für ein Trans-
ceiver-Tischchen und ein Operator-Stühlchen draufstellen muss. Das ist
Scarborough Reef. Heißt BS7H, ist sooo klein und doch bereits ein voll
gültiges Radioterritorium − oder vielmehr eines von derzeit 338 DXCC-
Gebieten weltweit. Ein anderes ist Nordkorea. Das ist dreimal so groß
wie Bayern, hat 24 Mio. Einwohner, heißt P5 und ist ein offizieller Staat.
Oder das UNO-Hauptquartier in New York. Es heißt 4U1UN, ist bloß ein
Gebäude und gilt trotzdem fürs DXCC. Oder Glorioso, eine hübsche Insel
namens FR/G im Indischen Ozean.
Eines haben diese vier gemeinsam: Sie sind Raritäten. Scarborough, weil
ungeheurer logistischer und finanzieller Aufwand erforderlich ist, um es
zu aktivieren. Nordkorea, weil dessen Machthaber das Land vom Rest der
Welt abschotten. Die UNO, weil man ihre Klubstation nur ausnahmsweise
betreiben darf. Und Glorioso, weil dort die Fremdenlegion stationiert ist
und keine Besucher mag.
Manche Länder sind so häufig in der Luft wie Stechmücken an einem
Sommerabend und folglich uninteressant für Kampffunker − also für DXer
oder Länderjäger oder Funksportler, das klingt harmloser. Ins Kampfge-
tümmel werfen sie sich trotzdem. Sie kämpfen gegen Konkurrenten, die
mehr Power, eine bessere Antenne, einen besseren Standort und mehr
Glück haben. Sie kämpfen stunden-, ja tagelang um ein Five-Nine oder
um ein 5nn, wenn getastet wird. Sie werden gebeutelt von Herzkrämpfen,
Wutanfällen und euphorischen Glückszuständen − je nachdem.
Und welchen Sinn soll das alles haben?
Wer ein Steckenpferd reitet oder bis zur Verbissenheit malträtiert, fragt nicht
nach dem Sinn, darf nicht nach dem Sinn befragt werden. Welchen Sinn
macht es denn auch, ohne Sauerstoff den Mount Everest zu besteigen,
blaue Rosen zu züchten oder in Yanacocha nach einer Schwarzbrust-Berg-
tangare zu spähen?
Da aber zu einem Duett bekanntlich zwei gehören, braucht der DXer als
Partner DXpeditionäre − Enthusiasten, die ebenso süchtig nach dem Pile-
Up sind. Jeder der beiden wäre ohne den anderen aufgeschmissen. Daher
frage man auch nicht, welchen Sinn es macht, unwillige Administrationen
für Sendegenehmigungen zu bezirzen, eine Menge Geld zu investieren,
vielleicht sogar Kopf und Kragen zu riskieren, Tonnen an Ausrüstung in
unwirtliche Weltwinkel zu schaffen, sich von rabiaten Möwen auf den Kopf
hacken und sonst was zu lassen, nur um bis zum Umfallen Five-Nine zu
brüllen oder 5nn zu tasten.
Und dennoch, Freunde, ja, das alles ist sinnvoll! Es hat jenen Sinn, den
wir diesem Thema als Stück unserer Lebensgestaltung zubilligen.
Amateurfunk war einmal eine rein technische Angelegenheit. Das ist sie
immer noch, aber nicht „nur“, sondern „auch“. Das DXCC lockte seinerzeit
als schönste aller Utopien hinterm Horizont. Heute ist vieles Alltag, außer
vielleicht die Morsetaste in Eigenfabrikation. Oder das erste QSO via PSK31.
Oder eine QSL von Bouvet.
Ist doch prima: Für jede(n) von uns gibt es auf diesem riesigen Spielplatz
einen maßgeschneiderten Winkel. Und jede(r) hat die Wahl: Kopfschütteln
oder Mitmachen.
Jetzt also Glorioso! Was für ein glorioses Vergnügen!
Wolf Harranth, OE1WHC
ist Kurator im Dokumentationsarchiv Funk in Wien. Dort sind aus acht Jahr-
zehnten sieben Millionen Beweise für die Faszination des Amateurfunks
versammelt. Und ganz aktuell zum Thema: www.dokufunk.org/glorioso
Begeisterung ist der Schlüssel
Ich bin 20 Jahre alt, funk- und elektronikbegeisterter Schüler an einem
beruflichen Gymnasium mit der Fachrichtung Elektrotechnik und habe u. a.
im FA 3/08, S. 300, die Modifikation eines BOS-Funkgeräts beschrieben.
Als Angehöriger einer vermeintlich nicht mehr für den Amateurfunk zu
begeisternden Generation melde ich mich hier erneut zu Wort.
Überall klagt man im Bereich der Elektronik und anderen technischen
Wissenschaftsbereichen über Nachwuchsprobleme. Eine Erklärung für
dieses Problem ist schnell gefunden: die „bösen“ Computerspiele, mit
denen Kinder und Jugendliche ihre Zeit viel lieber verbringen. In der
Vergangenheit war der Grund das übermäßige Fernsehen…
Man sollte sich besser einmal Gedanken machen, wieso Computerspiele
so beliebt sind: Sie führen schnell zu Erfolgen, die Heranwachsende
anderswo leider immer weniger erleben.
So fand ich es immer wieder merkwürdig, dass sich meine Lehrer an der
Berufsfachschule wunderten, wieso Schüler nicht begeistert sind, wenn sie
nach zwei Monaten trockener Theorie über das ohmsche Gesetz eine LED
zum Leuchten bringen dürfen. Würde man die LED zuerst zum Leuchten
bringen (Erfolgserlebnis) und erst dann Hintergründe untersuchen, wäre
eine ganz andere Motivation gegeben. Jede „Was-passiert-wenn-Frage“
sollte von einem Praxisbeispiel begleitet werden. Der Aufwand ist dabei
oft geringer als alles Gerede über die Theorie, das dann noch dreimal
wiederholt werden muss, weil keiner dem Unterricht folgt…
Warum zweifelt niemand die eigene Methodenkompetenz an und versucht,
sie modernen Erfordernissen anzupassen? Einfach zu sagen, dass die
Jugendlichen nicht mehr für wissenschaftliche Themen zu begeistern sind
und es dabei zu belassen, ist zu einfach. So ist es leider auch in dem
ansonsten sehr sehenswerten Kurzfilm des WDR über Amateurfunk vom
18. April 2009 geschehen, der in dessen Mediathek hoffentlich beim
Erscheinen dieser Ausgabe noch über tinyurl.com/covxn3 verfügbar ist.
Je praxisnäher etwas demonstriert wird, desto einfacher ist es, Jugendliche
zu begeistern. Die Wheatstone-Brücke mit vier Widerständen und einem
Voltmeter ist nicht halb so attraktiv wie eine nach demselben Prinzip auf-
gebaute Temperaturanzeige! Jedes noch so langweilige Thema mit einem
interessanten Praxisbeispiel zu würzen, ist mit Sicherheit der richtige Weg.
Die Frage nach dem „Warum“ kommt dann aus Neugier schon von ganz
allein! Und wenn Sie selbst Kinder haben, sollten Sie nicht vergessen,
dass gerade Ihr Vorbild und Ihre Aufmerksamkeit für die Ausprägung der
Interessen Ihres Nachwuchses von immenser Bedeutung sind.
Haben die Ortsverbände in den vergangenen Jahren wirklich alle Möglich-
keiten ausgeschöpft, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren? Wenn ein
Jugendlicher nicht aktiv danach sucht, kommt er mit Themen wie Ama-
teurfunk eher nicht in Berührung. Es ist, als ob man ein Produkt verkaufen
wollte, ohne dafür zu werben. Dass etwas so nicht funktioniert, mussten
schon viele Unternehmen schmerzhaft erfahren.
Lassen Sie es nicht so weit kommen. Überdenken Sie Ihre Methoden-
kompetenz und betreiben Sie aktiv Werbung für unser Hobby! Gehen Sie
mit Ihren OV-Kollegen in die Schulen − Gelegenheiten gibt es sicher genug,
man muss es nur wollen und die eigene Begeisterung weitergeben.
Sebastian Westerhold
IOTA − das etwas andere Programm für den Sommer
Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen zeigen es: Der Frühling ist zurück
und noch wärmere Tage im Sommer stehen uns bevor: Die beste Zeit, sich
aktiv oder passiv am IOTA-Programm (www.rsgbiota.org) zu beteiligen. Was
war IOTA noch einmal …? Unter IOTA (Islands On The Air − zu Deutsch
„Inseln in der Luft“) versteht man, kurz und knapp gesagt, Funkkontakte
zu Inseln rund um den Globus herzustellen.
Das Programm hat in den vergangenen zwanzig Jahren gewaltigen Zu-
spruch erhalten; die Statistiken sprechen für sich. Durch die straffe sou-
veräne Führung der RSGB und die interessanten Zielsetzungen hat sich
das Programm weltweit etablieren und zu einem der erfolgreichsten Be-
tätigungsfelder der Funkamateure entwickeln können. Vier Gründe für
diesen Zuspruch habe ich ausgemacht: zum Ersten die Beschäftigung mit
den Inseln an sich, wie dem Kennenlernen der aktuellen wie historischen,
geografischen und politischen Gegebenheiten. Zweitens fragen sich nicht
wenige OMs, was für sie nach dem DXCC-Programm kommt. Drittens
geht ein gewisser Reiz (oder nennen wir es eine „Magie“) davon aus, diese
oder jene Insel „bezwungen“ zu haben. Viertens, und das ist vielleicht
der wichtigste Grund, ist eine aktive Mitwirkung am Programm auch mit
kleinstem Budget möglich.
Betrachten wir die aktive Komponente. Das heißt: Ich gehe auf eine Insel
und funke von dort ganz nach Gusto, egal, ob im 59-Contest- oder im
Urlaubsstil, mit Namensnennung und allem, was dazugehört. Ich bringe
diese Insel also „in die Luft“, und das Schöne ist, dass ich nicht unbedingt
bis in den Pazifik reisen muss, um „erhört“ zu werden. Gleich, ob mit ge-
ringer oder hoher Sendeleistung, Dipol oder Richtantenne, ob als Gruppe
oder Einzelkämpfer − man wird erstaunt sein, wer alles einen Kontakt mit
der IOTA-Insel haben möchte. Allein Europa zählt momentan 189 Inseln,
(korrekter gesagt Inselgruppen) davon gibt es allein in Deutschland sechs,
zu denen z. B. Borkum, Helgoland, Sylt, Fehmarn, Rügen und Usedom
zählen.
Das Betätigungsfeld, selbst auf unseren Kontinent beschränkt, ist also
riesig. Weltweit waren es am 31. 3. 2009 exakt 1078 zählbare Inselgruppen.
Alle zu besuchen ist, manchmal schon allein ihrer Lage oder Zugangs-
beschränkungen wegen, schier unmöglich. Auch nur Verbindungen mit
sämtlichen IOTA-Inseln zu erreichen, ist eine kaum lösbare Aufgabe.
Die meisten europäischen Inselgruppen sind dagegen bewohnt und be-
sitzen eine Infrastruktur, die eine Inselaktivität erleichtert. Den Schwierig-
keitsgrad legt jeder selbst fest, ob nah oder fern. Alles ist möglich. Jetzt
im Frühjahr und dem näher rückenden Sommer sind die Bedingungen für
die Aktivierung einer europäischen Insel sehr günstig. Das IOTA-Programm
bietet prima Möglichkeiten, die neue Portabelantenne, den neuen Trans-
ceiver oder die neuen Solarzellen auszuprobieren bzw. einfach nur die
Geselligkeit einer Gruppe zu erleben. Selbst wenn uns momentan der
24. Sonnenzyklus sprichwörtlich „im Regen stehen lässt“ − Funkverbin-
dungen mit Europa gehen immer. Die Condx können uns also gar nicht
hindern, in Sachen IOTA, unabhängig ob als Neueinsteiger oder erfahrener
Operator, aktiv zu werden. Nicht zuletzt wird man sich später angenehm
an diese oder jene Unternehmung erinnern und damit das Lebensgefühl
steigern. Probieren Sie es aus!
Mario Borstel, DL5ME
Die Klasse K kommt – wie weiter?
Seit Jahren beklagen wir Funkamateure einen eklatanten Mangel an
Nachwuchs. Wenn sich daran nichts ändert, wird es dem DARC e.V.
als der mitgliederstärksten Vertretung der Funkamateure in Deutschland
infolge Mitgliederschwunds zunehmend an Mitteln fehlen, um seine
satzungsgemäßen Aufgaben erfüllen zu können. Auch der RTA als Zusam -
menschluss von 17 Vereinen und Verbänden − neben DARC und VFdB
u. a. AMSAT, AGCW und AGAF − würde bei der Durchsetzung unserer
Interessen gegenüber Behörden weniger Gewicht haben.
Weniger Funkamateure und damit geringere Aktivität auf den Bändern
wecken zudem Begehrlichkeiten kommerzieller Funkanwender.
Allerhöchste Zeit also, effektive Wege zu finden, um diese Entwicklung zu
bremsen. Ob das im notwendigen Umfang überhaupt noch gelingen kann,
bleibt abzuwarten. Es ist ein offensichtliches Phänomen, dass junge Leute
moderne Kommunikationstechnik zwar bereitwillig konsumieren, ein tieferes
Eindringen in technisch-physikalische Zusammenhänge aber nicht angesagt
ist.
Was also tun? Herabsetzen der Amateurfunk-Prüfungsanforderungen bei
einer neuen Zeugnisklasse K? Das wäre sicher ein Weg, um die zahlen-
mäßige Präsenz von Funkamateuren zu erhalten. Das allein dürfte allerdings,
ähnlich wie die Einführung der damaligen Lizenzklasse 3, jetzt Zeugnis-
klasse E, nur zu einem Strohfeuer führen. Abgesehen davon gibt es in
allen DARC-Gliederungen erneut heftige Diskussionen über das Für und
Wider einer Klasse K – was zu einer Polarisierung führt, die wiederum dem
Verein schadet.
Was wir bräuchten, wäre ein langfristig angelegtes Konzept zur Verbes-
serung unserer Zukunftsaussichten. Dieses könnte auf Erfahrungen des
AATiS aufsetzen und das Potenzial Ganztagsschulen nutzen. Es sollte
möglichst viele Funkamateure einbinden und müsste so reifen, dass es
die überwiegende Mehrheit mittragen kann.
Der jetzt doch in ziemlich kurzer Zeit über die Mitgliederversammlung am
13./14. 12. 08 sowie die RTA-Sitzung am 25. 1. 09 (FA 3/09, S. 344) gefasste
Beschluss zugunsten der Zeugnisklasse K erscheint mir dagegen noch
recht unausgereift. So konnte man sich im RTA nur auf acht Eckpunkte
verständigen: Selbstbau zulässig, keine Änderung am AFuG, Upgrade-
Fähigkeit, Praktikum als Voraussetzung, EU-Harmonisierung, 10 W EIRP,
alle Sendearten, Bänder 80 m/10 m/2 m/70 cm/3 cm. Übereinstimmung
bestand bei den meisten RTA-Mitgliedern darüber, dass die ersten beiden
Punkte ein Muss sind.
Immerhin bietet dieser Beschluss die Basis für weitere Diskussionen. Das
sollten wir als Chance begreifen. Da die Würfel nun schon in Richtung
Klasse K gefallen sind, gilt es, die Randbedingungen im Sinne des oben
angemahnten Gesamtkonzepts mitzugestalten.
Liebe Leserinnen und Leser, beteiligen Sie sich an entsprechenden Diskus-
sionen, bringen Sie Ihre Vorstellungen mit ein! Diskutieren Sie aber bitte
nicht mit uns, der Redaktion, sondern im Ortsverband sowie mit den Funk-
tionären des DARC und den anderen RTA-Organisationen. Denn letztlich
sind es die Vertreter des RTA, die mit der Behörde die weiteren Gespräche
führen.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Eine Informationsplattform der Befürworter findet sich im Internet unter
www.lizenzklasse-k.de. Weitere Foren sind unter http://forum.db3om.de,
www.hamradioboard.de und www.amateurfunk.de erreichbar. Fundierte
Argumente gegen eine Zeugnisklasse K kann man auf www.agaf.de unter
„Aktuelles“ einsehen, und ihre eigenen Gedanken um die Zukunft des Amateurfunks
haben sich die Betreiber von www.proamateurfunk.de gemacht.
Armes Deutschland!
Eigentlich wollte ich am letzten Sonntag gegen 13 Uhr am Mittagstisch sitzen,
und für dieses Editorial schwebte mir auch ein anderes Thema vor. Doch
die Ökonomen der Telekom und ihrer die Funktürme verwaltenden Tochter,
der DFMG, warfen mit spitzen Bleistiften meine Pläne um und lieferten ein
Spektakel frei Haus. Das ließen sich neben mir, der ich unweit vom Ort des
Geschehens wohne, viele Tausende nicht entgehen. Angelockt durch einen
beliebten Berliner Hörfunksender, der seit Tagen für das Ereignis „Werbung“
machte, starrten wir also Punkt 13 Uhr wie gebannt auf den 359 m hohen
Sendemast in Berlin-Frohnau. Doch es passierte nichts! Für einen Moment
glaubte ich schon an eine Ente, wie damals vom RIAS, als die Rolling Stones
auf dem Dach des Hochhauses des Axel-Springer-Verlags spielen sollten.
Aber dann, gegen 13.10 Uhr, wurde das Absurde doch wahr und der Mast
fiel binnen weniger Sekunden in sich zusammen, während die Detonation
bei mir wegen der etwa 5 km Entfernung erst eine gefühlte Ewigkeit später
zu hören war. „Bildschön kollabiert“, titelte eine große Berliner Zeitung
und der Sprengmeister empfand sein Werk „fast besser als erwartet“;
„eine Meisterleistung“ − lobte denn auch der lokale Fernsehsender rbb.
Irgendwie umfängt mich Beklemmung. War es nicht eine viel größere Meis-
terleistung, dieses laut Wikipedia viertgrößte Bauwerk Deutschlands (nach
dem Berliner Fernsehturm, dem Sendemast Donebach in Baden-Württemberg
und dem Langwellensendemast im brandenburgischen Zehlendorf)
zu errichten? Als besonders schlimm empfinde ich, wie die Medien die
Begründung der Eigentümer, man habe für den Turm keine Verwendung
mehr, kritiklos nachplapperten und obendrein noch eine Volksbelustigung
mit Bratwurst und Bier daraus werden ließen.
Der 1979 in Dienst gestellte Sendemast diente seinerzeit der Kommunikation
zwischen Berlin-West und dem Bundesgebiet, siehe FA 10/08, S. 1041 ff.
Er übertrug − vermeintlich abhörsicher − vor allem Telefonate via Richtfunk
und dürfte darüber hinaus der militärischen Funkaufklärung gedient haben.
Aber ausgerechnet im 20. Jahr des Mauerfalls, an den gerade in Berlin mit
großem finanziellen Aufwand erinnert wird, verarbeitet man ein derartiges,
den (Nord-)Berlinern ans Herz gewachsenes, Wahrzeichen Berlins, ein
weithin sichtbares Mahnmal an den Kalten Krieg, in 920 t Stahlschrott.
Dabei soll es um ganze 50 000 € jährliche Instandhaltungskosten gegangen
sein, die angeblich nicht aufzubringen waren − das ist weniger als ein
Hundertstel der Baukosten und für einen Großkonzern eine vernachlässigbare
Summe. Das ausgerechnet zu Zeiten, in denen Milliarden fließen, um
marode Banken zu retten, deren hoch dotierte Bosse das Geld ihrer Kunden
verspekuliert haben. Freilich ist mir klar, dass es sich hier um verschiedene
„Töpfe“ handelt, und sicher war die Entscheidung rein rechnerisch völlig in
Ordnung – zumindest für die kleine DFMG. Aber zählen denn hier zu Lande
gar keine anderen Werte mehr als der kaufmännische Buchwert, der nach
30 Jahren Abschreibung vermutlich wirklich Null betrug? Dass das Bauwerk
doch einen Wert hatte, merkt man vielleicht dann, wenn in 10 oder 20 Jahren,
aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise wieder ein hoher Turm
gebraucht wird. Und war der Mast mit seiner 324 m hohen Kabine, dem
höchs ten über dem Erdboden liegenden geschlossenen Raum im EU-Gebiet,
nicht ein einzigartiges technisches Denkmal?
Wie konnte eine solche Vernichtungsaktion überhaupt genehmigt werden?
Hier wären doch neben Telekom und DFMG auch die Landesregierungen
von Berlin und Brandenburg gefordert gewesen, behutsam und traditions-
bewusst nach einer vernünftigen Lösung zu suchen, anstatt Hals über Kopf
die Leistungen der Ingenieure, Techniker und Bauleute mit einer derartigen
Nichtachtung zu strafen. Im österreichischen Dobl (FA 10/06, S. 1016 f.) war
das beispielsweise möglich.
Man darf wohl gespannt sein, welche „kaufmännisch völlig korrekte“ Entscheidung
clevere Profit-Optimierer mit spitzem Bleistift als Nächstes fällen,
solange man sie lässt…
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Chapeau!
Welches sind denn eigentlich die herausragenden Leistungen im Dunst-
kreis unseres Hobbys? Sind es die 26,8 Mio. Punkte in einem Contest?
Sind es 4933 Bandpunkte von 160 bis 10 m in drei Jahren? Ist es eine
47-GHz-Vorstufe im Eigenbau, die nur mit 0,2 dB rauscht? Welches sind
denn die erdrutschartigen Amateurfunkereignisse, die uns vom Hocker
hauen? Wovor sollten wir denn den Hut der Bewunderung ziehen?
Ich habe viele und dabei ganz triviale Dinge im Bereich unseres Hobbys
gefunden, vor denen ich den berühmten Hut, genauer gesagt den Zylinder,
ziehe. Wenn ich jemanden vergessen habe, ist das kein böser Wille. Dann
ist es nur der Beweis dafür, dass es in Wirklichkeit noch viel, viel mehr
schätzenswerte Mitstreiter gibt, die in ihrer kostbaren Freizeit sich und
anderen einen Dienst erweisen. Also: Frisch ans Werk! Wer fällt mir da ein…
Uli Bihlmayer, DJ9KR, und Wolf Hadel, DK2OM, an der Spitze der DARC-
Bandwacht arbeiten fast rund um die Uhr für die Amateurfunkgemeinde,
um unsere Bänder zu schützen und zu erhalten. Mit viel technischem und
finanziellem Aufwand werden Bandplanverstöße identifiziert, dokumentiert
und in Zusammenarbeit mit den nationalen und internationalen Aufsichts-
behörden zu unser aller Nutzen „behoben“. Eine andere Gruppe von
Amateuren stellt allen Unkenrufen zum Trotz das Packet-Radio-Netz den
Amateuren zur Verfügung. Immer noch versorgt eine große Zahl von
Digipeatern unsere Zunft mit DX-Cluster-Zugriff, wenn es keinen DSL-
Anschluss im Shack gibt. Dann sind da die AATiS-Aktivisten, die nicht
müde werden, auf Veranstaltungen Jugendliche für Technik zu begeistern–
ist das die Technik, die begeistert? Dann gibt es publizistisch Begabte, die
eigene, kleine Periodika herausgeben und dabei ausgewählte technische
oder betriebstechnische Themen anpacken, die für die großen Magazine
zu speziell wären.
Eine andere Gilde von Enthusiasten hat sich der Entwicklung von Hard-
und dazu passender Software von Amateuren für Amateure verschrieben.
Die Resultate können sich sehen lassen. Gleich, ob Netzwerktester oder
Gigahertz-Technik aus dem Frankenland − es sind nahezu professionelle
Lösungen, die Amateure entwickeln. Auch die QRPer unter dem Dach der
QRP-AG haben sich mittlerweile europa-, ja weltweit mit Ihren Publikationen
und Bausätzen einen Namen gemacht.
Hat sich schon einmal jemand überlegt, wie viele Stunden ihrer Freizeit die
Auswerter unserer Conteste investieren, um die Ergebnislisten möglichst
schnell und exakt zu erstellen? Und wer macht die „Arbeit“ im OV? Da gibt
es die guten Geister, die OV-Transceiver und Antennen reparieren, warten
und verbessern, die das (hoffentlich noch vorhandene) OV-Heim in Schuss
halten…
Es ließen sich noch viel mehr Beispiele finden, die uns zeigen, dass unsere
Gemeinschaft von Eifrigen getragen wird, die ihre Energie in den Dienst der
Allgemeinheit stellen – ohne dafür bezahlt zu werden, und in vielen Fällen
leider sogar, ohne dafür ein Dankeschön zu bekommen.
Deswegen ziehe ich immer wieder tief den Hut vor all diesen engagierten
Kollegen, die mit ihrer Arbeit den Amateurfunk nicht nur am Leben erhalten,
sondern auch nach vorn bringen.
Den Chapeau zieht Peter, DL7YS
Peter John, DL7YS
Wir haben viel vor
Auch wenn Wirtschaft und Politik immer neue Hiobsbotschaften ver-
künden − das Team des FUNKAMATEUR hat allen Grund, optimistisch
ins Jahr 2009 zu starten. Die Zahl unserer Abonnenten steigt und der
Verleger ist erleichtert, dass sich die Kosten im neuen Jahr voraussichtlich
nur moderat erhöhen werden. Deshalb kann der Preis für ein Standard-
Abonnement (das monatlich kündbare, ohne Jahrgangs-CD-ROM) nun
schon das achte Jahr unverändert bleiben.
Im Leserservice arbeiten wir daran, das Sortiment zu erweitern. Vor allem
wollen wir Bauteile ins Programm nehmen, die für die großen Versand-
händler einfach zu speziell oder wegen zu geringer Stückzahlen uninte-
ressant sind. Daneben bereitet der Leserservice zusammen mit unseren
Entwicklern und den Redakteuren neue Bausätze vor.
So soll im Februar der Verkauf einer weiterentwickelten Version des be-
liebten FA-NWTs starten. Diese wurde von G. Borchert, DF5FC, mit einer
USB-Schnittstelle ausgerüstet und ihr DDS-Chip wird jetzt standardmäßig
mit 400 MHz getaktet. Wenig später wollen wir die ersten Bausätze für den
Spektrumanalyse-Vorsatz zum FA-NWT, der von R. Müller, DM2CMB, und
G. Richter, DL7LA, stammt, ausliefern. Und auch das 10-MHz-Frequenz-
normal von N. Graubner, DL1SNG, steht auf der Agenda.
SDR-Interessierte werden sich über das Selbstbauprojekt „Next-SDR“ von
K. Raban, DM2CQL, freuen. Sein neues softwaredefiniertes Radio setzt auf
dem SDR-Einsteiger-Kit auf und vereint einen IQ-Mischer mit dem BCC-
Preselektor und einem FA-SY No 1. Dadurch erschließt es den gesamten
KW-Bereich für PC-basierte Empfangsexperimente. Für Versuche mit SDR-
Sendern soll der Bausatz einen gesonderten Oszillatorausgang erhalten.
Noch für das 1. Quartal planen wir einen preiswerten Bausatz für einen
GPS-Empfänger, den sich O. Dröse, DH8BQA, ausgedacht hat. Mit diesem
einfachen Gerät kann man sich auf Reisen u. a. den aktuellen Locator
anzeigen lassen.
Neuauflagen, meist überarbeitet oder sogar verbessert, haben wir uns
für die legendäre DL-QRP-PA, das von vielen erwartete D-STAR-Modem,
das PIC-Frequenzdisplay, den externen Dynamikkompressor für den
FT-817/-857/-897, unseren 2-m-FM-Einkanalempfänger, der demnächst
auch mehr Kanäle haben kann, und den 2-m-FM-Transceiver vorgenom-
men − vieles also, worauf sich bastelnde Amateure, Amateurfunkausbilder
und Ortsverbände freuen können, und viel zu tun für uns.
Trotz aller Bemühungen läuft leider manches nicht immer so, wie wir es uns
wünschen. Da unsere Mitstreiter die Bausätze nur „nebenbei“ entwickeln,
kann es aus vielerlei Gründen zu unerwarteten Verzögerungen kommen.
Erschwerend ist, dass viele Bauelemente inzwischen lange Lieferzeiten
haben oder überraschend abgekündigt werden. Die Distributoren erwarten
oft Mindestbestellmengen, die wir weder finanzieren noch in absehbarer
Zeit verarbeiten können. Für das von Ihnen in der Vergangenheit aufge-
brachte Verständnis und die gezeigte Geduld möchten wir uns an dieser
Stelle herzlich bedanken.
Zum Schluss noch eine Bitte. Wenn Sie ein nützliches Projekt in der Schub-
lade haben oder an einem arbeiten, das das Zeug zum Bausatz hat, sollten
Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Zusammen mit Ihnen prüfen wir, ob es sich
kommerziell verwerten lässt. Das kann sich für Sie lohnen und für unsere
Leser allemal.
Ihr
Dipl.-Ing. Peter Schmücking, DL7JSP
Leserservice
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Notfunk steht uns gut zu Gesicht
Die Ereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass wir uns hier in Europa
nicht mehr auf die ruhigen Sommer und Winter vergangener Jahre verlas-
sen können. Unwetterkapriolen wie zum Beispiel Kyrill oder die Schnee-
katastrophe 2005 im Münsterland sind nur Vorboten von Ereignissen, auf
die wir uns in Zukunft einstellen müssen − sofern man sich auf die Vorher-
sagen der Klimaexperten verlassen kann.
Umso wichtiger wird es, sich auch mit dem Bereich des Katastrophen-
funks, dem Notfunk, näher zu beschäftigen. Die Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) − also Feuerwehren, Hilfsorganisa-
tionen (JUH, DRK u. a.), das THW und weitere in privater und öffentlicher
Hand − sind für die alltägliche Gefahrenabwehr gut gerüstet, aber auch sie
stoßen bei Naturkatastrophen oder Großereignissen an Grenzen.
Genau dann sind wir Funkamateure gefragt, diese Lücke mit unserem
Wissen und unserer Technik zu schließen. Unterstützung ist dann in viel-
fältiger Weise möglich: Wir können den Behörden und Organisationen
mit unserem Knowhow über Funk- und Elektrotechnik zur Seite stehen.
Unsere Amateurfunkgeräte lassen sich einsetzen, um Nachrichten in digi-
taler oder analoger Form, durch Sprechfunk oder mit Bildübertragung zu
übermitteln.
Den Amateurfunk auf diese Weise ins öffentliche Bewusstsein zu rücken
führt auf lokaler, aber auch auf Landes- und Bundesebene zu einer Stei-
gerung seines Ansehens; man wird unsere Belange bei Gesetzgebungs-
prozessen eher berücksichtigen, und auch die Nachbarn sehen unsere
Antenne dann vielleicht in einem anderen Licht. Das erfordert selbstver-
ständlich entsprechende Aktivitäten von Funkamateuren an der Basis.
Gerade unsere Fachkompetenz und unsere flexiblen Möglichkeiten, Fre-
quenzen und Übertragungsarten nach Ausbreitungsbedingungen oder
zu überbrückender Entfernung auszuwählen, macht uns zu einem Ass im
Ärmel des Katastrophenschutzes, das immer dann gezogen werden kann,
wenn die standardisierten Systeme versagen.
Dabei muss klar sein, dass man beim Einsatz für den Notfunk nicht erst
tätig werden kann, wenn es ernst wird. Für die Amateurfunkstation hat es
große Bedeutung, dass sie unabhängig vom Stromnetz und schnell an
einen anderen Ort verlegbar ist. Dies kann eine Feuerwache oder auch
die Unterkunft einer Hilfsorganisation sein. Und nicht zuletzt sollte sich der
Funkamateur bereits mit dem Thema auseinander gesetzt haben, denn das
gibt Sicherheit beim Notfunkbetrieb.
Deshalb beschäftigen sich Funkamateure seit Jahren in verschiedenen
Vereinen mit dem Notfunk. Neben den Bemühungen im DARC e.V. gibt es
u. a. den Verein Notfunk-Deutschland e.V., einen gemeinnützigen Verein,
der sich zum Ziel gesetzt hat, Funkamateure für den Notfunk sowie für die
Tätigkeit im Katastrophenschutz auszubilden. Unter anderem stehen Ge-
fahren an der Einsatzstelle und die Struktur des Katastrophenschutzes
auf dem Lehrplan. Neben der Ausbildung hat Notfunk-Deutschland e.V.
das Ziel, aktiv im Notfunk mitzuwirken. So wurden bereits Kooperations-
verträge mit dem Landesverband Hessen des Deutschen Roten Kreuzes
geschlossen und ein Einsatztrupp fest in der Gefahrenabwehr des Land-
kreises Groß-Gerau integriert. Einen Beitrag über Notfunk-Deutschland e.V.
können Sie auf Seite 1348 der aktuellen Ausgabe lesen.
Entscheiden Sie nun selbst, ob der Notfunk nur eine weitere Fassette
unseres vielseitigen Hobbys ist oder ob doch etwas mehr dahintersteckt…
Sebastian Schlubeck, DM1SW
Ausbildungsleiter, Notfunk-Deutschland e.V.
Gute Zeiten für den Eigenbau!
Ich gehöre noch zur Generation der Radiobastler, die auf Mutters Kohlen-
herd in einem Eisentiegel Blei geschmolzen und dann unter Flammen-
entwicklung Schwefel dazugemischt haben. Anschließend wurde das Blei
in kaltem Wasser abgeschreckt und fertig waren Bleiglanzkristalle, die ich
für den Bau eines Detektors brauchte. Nebenbei verschwand noch der
Fingerhut aus Mutters Nähkasten, den ich für die Halterung benötigte.
Bald merkte ich, dass nicht jeder Draht zur Kontaktierung geeignet war.
Ich hatte keine Ahnung vom PN-Übergang und seiner Schwellspannung,
Spule und Kondensator konnte ich nicht dimensionieren, und warum lange
Antennen nicht immer besser waren als kurze, blieb mir schleierhaft.
Kurzum: Aus Problemen wurden Fragestellungen und bei späteren Ant-
worten war der Einbrenneffekt umso gründlicher. Aus meiner kindlichen
Bastelei ist schließlich zielgerichtet mein Beruf geworden.
Jetzt, im Rentenalter, kann ich wieder basteln, ohne Termindruck im Nacken
zu haben. Woher aber handliche Messgeräte nehmen, ohne die Haushalts-
kasse übermäßig zu strapazieren? Mit Aufmerksamkeit beobachte ich seit
Jahren das Angebot des FA-Leserservice sowie einschlägiger Elektronik-
Versandhändler wie Conrad, Pollin oder Reichelt. Angefangen habe ich
mit einem digitalen LC-Meter. Das ist eine unschätzbare Hilfe beim Selbst-
wickeln von Spulen. Über Induktivitäts- und Kapazitätsmessung gelingt
es sogar, den Wellenwiderstand unbekannter HF-Leitungen schnell zu
berechnen − Möglichkeiten, von denen ich in jungen Jahren nur träumen
konnte.
In meiner betrieblichen Praxis musste ich sehr viel Selektionsmittel aus-
messen. Da wurde gewobbelt, was das Zeug hielt. Der interessierende
Frequenzbereich wurde im 50-Hz-Rhythmus durchlaufen; das Ergebnis
erschien auf einer Bildröhre. Zur Dokumentation musste die Kurve abge-
zeichnet oder abfotografiert werden.
Wenn man nun den Quantensprung zum Netzwerktester FA-NWT sieht
und obendrein die Preise ins Verhältnis setzt, ist hier von Amateuren für
Amateure ein erstklassiges Messmittel geschaffen worden, dessen Mög-
lichkeiten ich mir in meiner Jugend nicht einmal hätte vorstellen können.
Jetzt kann die Selektionskurve in weiten oder kurzen Frequenzschritten
durchlaufen, sofort ausgedruckt, mit Bemerkungen versehen und gegebe-
nenfalls übers Internet versandt werden. Außerdem ist noch eine Gene-
ratorfunktion mit fünf wählbaren Frequenzen vorhanden, die man gut beim
Abgleich eines Superhet-Empfängers gebrauchen kann. Zusätzliche Bau-
gruppen wie der Reflexionsmesskopf, das schaltbare HF-Dämpfungsglied,
das Leistungsdämpfungsglied und andere ergänzen den Netzwerktester
zu einem hochkarätigen HF-Messplatz für den Eigenbauer. Selbst die
Untersuchung der Anpassung von Antennen − und seien es gekaufte −
wird damit wesentlich erleichtert.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Es liegt mir fern, hier Werbung für
den Leserservice des FUNKAMATEUR zu machen. Ich möchte lediglich
auf den unschätzbaren Wert dieses kleinen, äußerst universellen Mess-
geräts hinweisen. Als ich nämlich kürzlich auf einem Amateurfunktreffen
in Sachsen-Anhalt den FA-NWT und seine Einsatzmöglichkeiten vorstellte,
musste ich feststellen, dass viele Funkfreunde, früher emsige Bastler, heute
vor dem Selbstbau kapitulieren und dabei einen sehr schönen Aspekt
unseres Hobbys vernachlässigen.
Also: Start frei für die kommende Weihnachtszeit mit Freude am Eigenbau!
Horst Siegismund, DL1XR
„Grüne Woche“
Was bei Kühlschränken schon seit Jahren Standard ist, sollen künftig
auch Fernseher schaffen: ihre Aufgabe mit geringerem Energieverbrauch
bewältigen. Während auf der IFA 2008 die meisten Hersteller im Wesent-
lichen verbesserte Weiterentwicklungen schon bekannter Produkte und
Ideen zeigten, war das in den Messehallen verbreitete Bekenntnis zu ge-
steigerter Energieeffizienz tatsächlich eine Neuentwicklung. Ob sich damit
der Einfluss der erstmals auf einer IFA präsenten Haushaltsgeräte − der
weißen Ware − bemerkbar machte, die längst per Standardaufkleber mit
geringem Energieverbrauch für sich werben?
Bislang galt die moderne Unterhaltungselektronik als übler Energiever-
schwender, darunter besonders der Fernseher samt integriertem oder
beigestelltem DVB-Empfänger mit meist ständig laufendem Bereitschafts-
modus. Damit soll nun Schluss sein und alle namhaften Hersteller be-
mühten sich in Berlin nach Kräften, die Messebesucher in Präsentationen
von ihren ökologischen Strategien zu überzeugen: Branchenführer wie
Panasonic mit einer aufwändigen Multimediaschau, die es mühelos mit
einer Veranstaltung im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf auf-
nehmen konnte, andere mit gut sichtbar installierten Stromverbrauchs-
messgeräten aus dem Baumarkt zwischen der Steckdose und dem spar-
samen neuen Fernseher.
Die Notbremse beim Energieverbrauch kommt nicht zu früh. Denn die
massenhaft verkauften Flachbildfernseher versprechen nicht nur bessere
Bilder, sie benötigen trotz bereits gesteigerter Energieeffizienz je Quadrat-
zentimeter Bildfläche dank größerer Bildschirmdiagonalen letztlich doch
mehr Strom als zuvor die vielerorts ausrangierten − und eben kleineren −
Röhrengeräte. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts prognostiziert, dass sich
der Energieverbrauch der TV-Geräte in Deutschland bis zum Jahr 2010
verdoppelt. Und europaweit warten 170 Millionen weitere Röhrenfernseher
auf ihren großbildflächigen Ersatz. Da ist es nicht zuletzt angesichts regel-
mäßig steigender Strompreise eine gute Nachricht, wenn etwa Grundig und
Panasonic mittels neuer Technologien den Energiehunger ihrer jüngsten
Fernseher fast halbieren oder im Bereitschaftsmodus auch ohne Druck auf
den Netzschalter auf nahezu Null bringen. Damit wir uns beim Kauf nicht
mehr allein auf die Werbeaussagen der Hersteller verlassen müssen, tragen
künftig immer mehr Geräte der Unterhaltungselektronik ein Energielabel −
wie schon heute Waschmaschinen und Kühlschränke.
Im Telekommunikationsbereich ist das Thema längst angekommen, wenn
auch zunächst hauptsächlich bei den Netzbetreibern, die über einen redu-
zierten Energieverbrauch ihre Betriebskosten senken. Doch jetzt mini-
mieren auch neue DECT-Telefone ihre Sendeleistung im Ruhezustand oder
schalten in der Ladeschale ganz ab. Diese Entwicklung ist ganz im Sinne
der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), die zuletzt im Juni in London
ein Symposium über Telekommunikation und Klimawandel durchführte.
Die Überarbeitung technischer Standards für den Telekommunikations-
bereich gehörte zu den diskutierten Themen und ein Vertreter der euro-
päischen Normierungsorganisation ETSI kündigte an, dass der sparsame
Energieverbrauch in künftigen Festlegungen ein zentraler Faktor ist.
Wir Funkamateure setzen die Idee eines energieeffizienten Betriebs längst
um. Etwa, wenn wir mit einer Kombination aus QRP-Leistung, CW oder
digitalen Betriebsarten sowie geübter Betriebspraxis drahtlos Nachrichten
mit anderen Kontinenten austauschen. Oder wenn wir Antennen opti-
mieren, um unsere Sendeenergie zielgerichtet einzusetzen. Das tun wir
auch ohne Energielabel.
Harald Kuhl, DL1ABJ
CE oder CE?
Seit dem 1. 1. 1993 müssen sich CE-Kennzeichnungen auf verschiedenen
Produkten finden lassen, auch auf solchen, die nicht technischen Bereichen
entstammen. Auch Kinderspielzeuge werden z. B. damit versehen. CE ist
dabei vom französischen Conformité Européenne (etwa Übereinstimmung
mit EU-Richtlinien) abgeleitet.
Bringt ein Hersteller dieses Zeichen auf seinen Produkten an, so bestätigt
er damit, dass es den geltenden europäischen Richtlinien entspricht. Hat
der Hersteller seinen Sitz innerhalb der EU, ist er für diese Kennzeichnung
selbst verantwortlich. Wollen Hersteller außerhalb der EU ein Produkt
innerhalb der EU vertreiben, ist ein in der EU niedergelassener Bevoll-
mächtigter erforderlich. Kommt ein Hersteller außerhalb der EU seiner
Pflicht nicht nach, geht diese Verpflichtung an seinen Beauftragten in der
EU, den Importeur oder letztlich an den Verkäufer über. Umgehen kann man
es im Regelfall nicht. Das Zeichen muss mindestens 5 mm hoch und fest
am Produkt angebracht sein. Eine richtlinienkonforme Darstellung der
CE-Kennzeichnung ist z. B. bei http://de.wikipedia.org nachzulesen.
Außerdem ist die Angabe von Name und Anschrift des Herstellers oder
seines Bevollmächtigten bzw. Importeurs in der EU obligatorisch.
Das CE-Kennzeichen allein lässt keine Rückschlüsse darauf zu, ob und bei
wem das Produkt auf die Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde. Ist
nach der CE-Kennzeichnung jedoch eine vierstellige Zahl angebracht, weist
dies auf die Einbindung einer so genannten „Benannten Stelle“, also eines
neutralen, unabhängigen Kompetenzträgers, in das Konformitätsbewer-
tungsverfahren hin.
Obwohl die CE-Kennzeichnung kein Gütesiegel oder Qualitätskennzeichen
darstellt, verlassen sich jedoch vermehrt viele Käufer auf die damit sugge-
rierte Sicherheit der gekennzeichneten Erzeugnisse. Aber blind sollte man
selbst bei europäischen Herstellern nicht darauf vertrauen.
Doch aus China gelangen seit einigen Jahren verstärkt technische Erzeug-
nisse auf den europäischen Markt, die ebenfalls mit den Buchstaben CE
versehen sind. Augenscheinlich wurde, um die missbräuchliche Verwen-
dung des CE-Kennzeichens zu umgehen und trotzdem ein dem CE-
Kennzeichen ähnliches verkaufsförderndes Logo am Artikel zu haben, von
chinesischen Firmen ein Logo für Chinese Export, kurz CE, ausgedacht.
Bei solchen Produkten ist das aufgebrachte CE fast nicht von der Original-
CE-Kennzeichnung zu unterscheiden. Dies kann kein Zufall sein! Aufgrund
von Eingaben zu dieser Verwechslungsproblematik diskutiert man zurzeit
im EU-Ausschuss für internationalen Handel über mögliche Maßnahmen.
Bei genauem Hinsehen sind die Logos dieser bewussten Irreführung
am zu langen Mittelstrich des E und/oder am zu großen oder zu kleinen
Abstand der beiden Buchstaben zu erkennen.
So lange, bis ein verbessertes Erkennen derartiger Nachahmungen mög-
lich ist, sollten Sie beim nächsten Kauf eines technischen Geräts einmal
genauer auf das angebrachte Kennzeichen sowie die vorgeschriebenen
Zusätze, s. o., achten. Ansonsten kann es Ihnen passieren, dass Sie, wie
der Autor des Beitrags auf Seite 930, ein Gerät benutzen, das zwar die
Buchstaben CE trägt, aber keineswegs die eigentlich angenommene
Qualität erreicht. Das CE-Kennzeichen ist zwar kein Garant dafür, dass
z. B. beim Betrieb des neuen Netzteils der Funkempfang nicht beeinträch-
tigt ist, doch mindert es die Wahrscheinlichkeit, dass der Störenfried in
den eigenen vier Wänden sitzt.
Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
Wir können das
Gelegentlich fragen mich Freunde oder Bekannte, was Amateurfunk über-
haupt ist und was man damit so machen kann. Dann stellt sich für mich
die Frage: Womit fange ich an und wie erkläre ich ein derart vielfältiges
Hobby, ohne mich dabei vor lauter Begeisterung gleich zu Beginn in
Details zu verlieren und Außenstehende damit letztlich mehr zu verwirren
als zu informieren? Das Gesprächsthema ist dann schnell gewechselt
und eine Chance vertan, dass aus allgemeinem Interesse künftig mehr
wird. Denn im Zeitalter von allgegenwärtiger Funktechnik, Flatrate und
Internet beeindruckt allein die Aussicht auf weltweite Kontakte weniger,
der mögliche Betrieb ohne jegliche Infrastruktur schon eher.
Die Vielfalt unseres Hobbys war am letzten Juniwochenende erneut auf
der Ham Radio erlebbar, wie auch unser Messebericht in dieser Ausgabe
zeigt. Europas größte Amateurfunkmesse stand in diesem Jahr unter dem
Motto „Amateurfunk im Weltraum“, üppig mit Inhalt gefüllt durch eine
Ausstellung, eine Podiumsdiskussion, mehrere Fachvorträge sowie
unzählige Gespräche am Stand der AMSAT-DL. Nicht zu vergessen die
beeindruckenden Vorführungen von ON6GU, siehe unser Titelbild, der
mit vergleichsweise einfacher Ausrüstung allen Besuchern einen weiten
Blick in unser Sonnensystem ermöglichte und das Signal einer Raum-
sonde empfing. Letzteres war nicht nur zu hören, sondern dank der
Spektrumanzeige eines nachgeschalteten SDR-Empfängers zudem
deutlich sicht- und damit auch für Nichtfunker (be)greifbar.
Diese interplanetare Spielart des Fernempfangs gewinnt offenbar rasch
an Zuspruch und veranschaulicht, was mit heutiger Empfangstechnik
machbar ist. Sie belegt aber auch die Innovationsfreudigkeit des Ama-
teurfunks, der Experimente mit neuen Technologien nicht scheut und
dabei Bewährtes fortführt. Funkamateure bauen seit rund 50 Jahren
Kommunikationssatelliten und entwickeln derzeit eine eigene Marsmission.
Damit steht uns das Tor zum Hochtechnologiebereich Raumfahrt offen,
was in dieser Praxisnähe kein anderes Hobby von sich behaupten kann.
Wir tun gut daran, dieses öffentlichkeitswirksame technologische Aus-
hängeschild des Amateurfunks zu pflegen und die Nachricht davon mehr
als bisher zu verbreiten. Dies gilt auch unter dem Aspekt der Sicherung
unserer Frequenzen vor eventuellen Begehrlichkeiten anderer Funkdienste
sowie nicht zuletzt, um potenziellen Funkernachwuchs − gleich, welchen
Alters − für unsere Sache zu begeistern.
In einem ganz anderen Bereich der Skala unserer vielfältigen Möglichkeiten
stehen Funkverbindungen um die halbe Welt mit 5 W auf Kurzwelle, ob mit
einem Arktisforscher auf einer treibenden Eisscholle, mit einem Farmer am
Orinoko oder mit dem Schiffsfunker eines Öltankers im Golf von Aden, der
zugleich Funkamateur ist. Und dies womöglich unter Verwendung selbst
gebauter Antennen und Transceiver, dank Batteriespeisung von einem
beliebigen Standort. Auch das sind für mich fesselnde Erlebnisse, die mir
kein anderes technisches Hobby bietet.
Wir Funkamateure haben die technischen Möglichkeiten, das Wissen sowie
die behördliche Erlaubnis, dies alles mit eigenen Mitteln zu realisieren:
Auf unseren Frequenzen, mit selbst gebauten Geräten und ganz ohne
Knebelverträge von Mobilfunk- oder Internetanbietern, die für jedes Extra
gerne zusätzlich kassieren und einen bei Störungen trotzdem in der Service-
leitung hängen lassen. Schließlich können wir bei Bedarf unsere Erfahrung
und unsere flexiblen Funkwege im Katastrophenfall anbieten, um auf An-
forderung die Kommunikation der professionellen Helfer zu unterstützen.
Mobiltelefon und Internet haben dann längst abgeschaltet.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Sommer, Sonne − Funkaktivität!
Neulich abend besuchte ich einen Funkfreund, um ihm ein geliehenes
Messgerät zurückzubringen. Günter, ein ambitionierter Selbstbauer, lud
mich kurzerhand auf seine Terrasse ein, und wir kamen ins Gespräch.
Er erzählte mir von seinem neuesten Bauprojekt, einem QRP-Funkgerät
für Kurzwelle mit SSB und CW. Es ist für Portabelbetrieb geeignet, und
mit glänzenden Augen berichtete er mir, wie er es im Rucksack auf einen
Berg mitgenommen, 10 m Draht nach beiden Seiten ausgeworfen und
dann mitten aus der Natur die schönsten QSOs geführt hat.
Merken Sie was? Günter ist ein geradezu vorbildlicher Funkamateur. Er
verbringt seine Zeit nicht nur im stillen Kämmerlein mit der Tüftelei an
neuen Geräten, sondern setzt diese auch unterwegs an diversen anderen
Standorten ein. Er beherrscht nicht nur die Technik, sondern kann auch
morsen und mit geringer Leistung sowie vermutlich nicht perfekten
Antennen spannende Verbindungen herstellen.
Damit nicht genug, zeigt er auch Ham Spirit, indem er anderen Amateuren
Geräte leiht. Zu Beginn meiner „Karriere“ bekam auch ich von ihm und
anderen Bauteile, die wiederum meine Basteltätigkeiten voranbrachten.
Was heißt das für uns? Nicht jeder mag den Umgang mit dem Lötkolben,
und schon gar nicht jeder kann ein komplettes Funkgerät selbst entwickeln.
Ich wiederum verspüre wenig Befähigung zum Morsen. Doch das alles
sind nur Facetten unseres vielfältigen Hobbys! Man muss nicht eine große
DXpedition wie VP6DX oder TI9KK auf die Beine stellen − aber wie wäre
es mit einer kleinen auf den nächsten Berg oder an einen See, um die
Ausbreitungsbedingungen und Verbesserungen durch Lage, Bodenleitfähig-
keit und minimalen Störpegel hautnah zu erleben?
Wie man mit industriell hergestellter Ausrüstung durch intelligente Kombi-
nation und Planung ein Maximum an Spaß erzielen kann, hat HB9TQG
im vorigen FA auf den Seiten 676 und 677 ausführlich beschrieben. Aber
es geht noch minimalistischer, einfach mit einem Handfunkgerät und viel-
leicht einer zusätzlichen Antenne. Bauanleitungen dazu gibt es genug.
Es muss ja nicht das High-End-Funkgerät mit der High-End-Endstufe und
dem eindrucksvollen Antennenturm sein, wenn eine solche Ausrüstung
auch Ehrfurcht gebietet und durchaus ihren Reiz hat, etwa Icoms neuer
IC-7700 (s. S. 716).
Doch zurück zum Sommer: Einfach nur zu sagen, ein schlechter Standort,
ein Antennenverbot hindere am Funkbetrieb, ist eine Ausrede, die zu dieser
Jahreszeit schlichtweg nicht mehr gilt. Schauen Sie einmal in Ihren Fundus,
was dort an kleinen Geräten, an Zubehör wie Antennen, Akkumulatoren
und Kabeln zu finden ist, und stellen Sie Ihre persönliche Portabelaus-
rüstung zusammen. Und dann hinaus in die freie Natur! Die langen Som-
merabende laden nicht nur am Wochenende zum Funkbetrieb ein…
Vielleicht erweist sich gerade das schon dick verstaubte Gerät aus der
dunkelsten Ecke des Schranks als der Knüller für unterwegs, mit dem bei
passender Gelegenheit und am geeigneten Ort der schönste Funkbetrieb
möglich wird. Oder es eignet sich für ein neues Projekt, etwa ergänzt mit
dem in dieser Ausgabe beschriebenen DV-Adapter für D-STAR-Betrieb
oder zum Aussenden der Position via APRS. Oder schlichtweg dazu,
jemand anderem eine Freude zu machen.
Auch der FUNKAMATEUR ist ein ultraportables Medium, das Sie bei jeder
Gelegenheit ganz ohne Stromversorgung und zusätzliches Gerät lesen
können, sei es auf einer Wanderung oder im Urlaub.
Bei all diesen Aktivitäten viel Vergnügen wünscht Ihnen
Ulrich Flechtner, DG1NEJ
Denglisch − nein, danke!
Ich blättere nach dem Frühstück noch etwas in der Zeitung samt Werbe-
beilagen. Da lese ich zum x-ten Mal von einem Quartz-Uhrwerk. Warum
zum Kuckuck Quartz und nicht Quarz? Das ist ja nicht einmal kürzer
als das deutsche Wort, was so häufig als Begründung für angewandte
Anglizismen herhalten muss.
Es ist schon skurril, was uns die Werbe-Fachleute tagtäglich unter die
Weste jubeln wollen. Englisch gilt als schick und soll insbesondere
jugendliche Käufer anlocken. Da dies seit Jahren praktiziert wird, weiß
manch einer wohl schon gar nicht mehr, dass man zu einem Ereignis,
bei dem man sich trifft und sitzt, um miteinander etwas zu besprechen,
außer „Meeting“ auch noch „Sitzung“ oder „Besprechung“ sagen kann.
Um nicht missverstanden zu werden: Jede Sprache unterliegt äußeren
Einflüssen und wandelt sich − das ist sogar sehr wichtig, damit sie auf
neue Herausforderungen reagieren kann. Wir wollen da weder Maschinen
stürmen noch Windmühlen mit der bloßen Hand anhalten. So werden
wir aus dem Englischen kommende Begriffe wie etwa „Website“, für
die es keine sinnvolle deutsche Entsprechung gibt, nicht mit „Netzsitz“
künstlich verdeutschen! Internet-Seite wäre hier übrigens voll daneben,
denn das englische „site“ meint schon den Sitz, den Platz oder die Stelle,
wo halt die Internet-Präsentation zu finden ist − nicht jedoch eine einzelne
Seite. Den „Wettbewerb“ wollen wir daher gern als „Contest“ belassen,
ganz bestimmt aber nicht als „Kontest“, denn ein solches Wort gibt es
vermutlich in keiner Sprache der Welt.
Doch wenn dann ein „Trainer“, obschon zweifelsohne englisch genug,
jetzt „Coach“ heißen soll, sich jeder Laden plötzlich „Shop“ nennt und
man im Strandbad neuerdings „Beachhandball“ spielen kann, beginnt
es meines Erachtens bedenklich zu werden. Und den „coffee to go“ be-
stellt der Berliner, zumindest meiner Beobachtung nach, immer noch mit
den Worten „’n Kaffe zum Mitnehm’“. So finden wir es auch nicht be-
sonders wissenschaftlich, wenn im Rundfunk statt von globaler Erwärmung
in angeblichem „Fachdeutsch“ von „global warming“ gesprochen wird.
Noch schlimmer, wenn denglische Formulierungen Einzug halten, das
sind z. B. englische Wörter, die deutsch gebeugt werden, wie das viel
strapazierte „downloaden“ − wie heißt da eigentlich die Vergangenheits-
form, „downgeloadet“ oder „downgeloaded“? Herunterladen geht doch
auch, nicht wahr? Eine besonders pikante Form von Denglisch haben
wir beim Handy vor uns, wo doch dasselbe Gerät auf Englisch „mobile
phone“ oder „cellular phone“, niemals jedoch „Handy“ heißt. Nicht die
aufgeführten Einzelbeispiele empfinden wir als Besorgnis erregend, wohl
aber die geballte Form ihres Auftretens.
Der Fairness halber ist einzuräumen, dass sich dieser Trend im seriösen
Schrifttum in den vergangenen Jahren erfreulicherweise umzukehren be-
ginnt. Seriöse Werbung kommt wieder in der Sprache der Kunden daher,
weil sie diese sonst nicht erreicht. Das gilt selbst für die Computertechnik,
so heißt die „Control“-Taste schon lange wieder Steuerung („Strg“), zu
„Page Up“ kann man genauso gut Bild aufwärts sagen und die Reiterkarte
im Internet-Explorer heißt wieder Registerkarte und nicht „Tab“.
In dem für mich wirklich lesenswerten „Wörterbuch überflüssiger Angl-
izismen“, das Sie auf S. 589 rezensiert finden, wählen die Autoren die
nicht zu übertreffende Formulierung: „Englisch bzw. Denglisch ist da-
gegen … zur Hochstapelsprache geworden. Wer nichts zu sagen hat,
sagt es auf Englisch.“ Liebe Leser, seien Sie gewiss, dass wir Ihnen auch
weiterhin wirklich genug zu sagen haben, und dies ganz bestimmt auf
Deutsch!
Werner Hegewald, DL2RD
D-STAR und die Folgen
Die Digitalisierung in der HF-Technik ist nicht unumstritten. Auch ich
sehe sie mit gemischten Gefühlen. Das kommt einerseits daher, dass
die Technik nicht mehr so greifbar ist. Weder begreifbar noch ohne
Weiteres selbst zu bauen. Andererseits werden versprochene Verbes-
serungen oft nicht erfüllt. Das Überall-Fernsehen DVB-T beispielsweise
führt dazu, dass terrestrisches Fernsehen eben nicht mehr überall zu
empfangen sein wird. Und wenn man dann einmal nichts mehr emp-
fängt, woran liegt es? Zunehmendes Rauschen, Flattern, Störsignale −
das alles ist ja nicht mehr zu hören. Die Signale sind steril, eben digital:
Es geht oder es geht nicht.
Nun also D-STAR. Und schon brechen neue Freund-Feind-Debatten
aus. „Fortschritt“, sagen die einen, „Unfug“ die anderen. Als ich das
erste Testgerät erhalten hatte, wusste ich noch nicht, was mich da
erwartet. Doch bald begann ich es zu ahnen: D-STAR ist eine Chance,
und zwar eine riesengroße. Erstmals kann man bei einem Funkgerät wie
dem IC-E92D zwischen analoger und digitaler Übertragung auswählen.
D-STAR bietet viele halbautomatische Funktionen, funktioniert oft genug,
ohne dass man zunächst weiß warum. Um das zu ändern, finden Sie in
dieser Ausgabe einen Grundlagenbeitrag auf S. 521. Nach wie vor muss
− oder darf − man selbst die Frequenz aussuchen, kann direkt bzw. über
Relaisfunkstellen oder gar mittels Gateway und Internet interkontinen-
tale Verbindungen aus der hohlen Hand aufbauen, und zwar rauschfrei,
weil digital. Manchmal geht das auch nicht, und dann muss man eben
herausfinden, warum.
Es ist ein spannendes Betätigungsfeld. Und es fordert von allen Betei-
ligten Ham-Spirit, gerade auch von den OMs, die mir bei meinen Tests
geholfen haben oder vielleicht sogar von Experimenten genervt waren.
Da ist zum Beispiel DL8NCE, der dank D-STAR nun weiter reichende
UHF-Verbindungen schafft als mit analogem FM-Funk. Mit ihm ging
ein rauschfreies QSO über 65 km durch HF-mäßig eher widrige Mittel-
gebirgslandschaft störfrei vonstatten, während das FM-Signal schon
massiv verrauscht war. Andererseits ist gerade in einem solchen Gelände
analoger Funkbetrieb oft vorteilhafter − Experimentieren somit angesagt!
D-STAR bedeutet nicht einfach nur die Anschaffung eines neuen Funk-
geräts, sondern eine ganz neue Technologie. Und um damit Erfahrungen
und Kenntnisse zu sammeln, um sie begreifen zu können, braucht es un-
bedingt ein Miteinander. Der bisweilen etwas dröge UKW-Funk gewinnt
wieder an Spannung und Lebendigkeit.
Erinnern Sie sich noch an Ihre allererste Funkverbindung? An diese Auf-
regung, ob es funktioniert und ob man ja alles richtig macht? D-STAR
lässt solche Gefühle wieder aufleben, zumindest mir geht es so.
Wenn aufgrund der Verfügbarkeit von Technologien wie D-STAR und
der Internetkopplung analoger Funkbetrieb und die Kurzwellenbänder,
weil überflüssig, abgeschafft würden, wäre das tatsächlich ein uner-
träglicher Verlust. Mancher fürchtet solche Entwicklungen, zudem es
ganz klar kommerzielle Begehrlichkeiten für die knappe Ressource
Funkfrequenzen gibt.
D-STAR indes löst den analogen Funk mit Sicherheit nicht ab und ist eine
Bereicherung, die sicher langfristig ihre Nische finden und noch manch
weitere Entwicklung anstoßen wird – in friedlicher Koexistenz mit den
analogen Funkbetriebsarten.
Ulrich Flechtner, DG1NEJ
Fortschritt und Toleranz
Leser fragten, ob man denn mit einem softwaredefinierten Transceiver
VP6DX wirklich schneller ins Log bekäme und warum wir dem Thema
SDR so viele Seiten opfern würden. Nein, bekommt man nicht − unter
bestimmten Umständen aber vielleicht doch!
Andere können sich trotz bereits erfolgter Diskussion des Themas
Echolink auf den Leserpostseiten nicht damit abfinden, dass wir dem
in der Ausgabe 2/08 soviel Raum widmeten – es hätte doch rein gar
nichts mit Amateurfunk zu tun. Hat es unseres Erachtens doch, denn
der Kerngedanke von Echolink ist ja, über Relaisfunkstellen zu funken,
die per Internet verlinkt sind. Der von den Kritikern bemängelte reine
Computerfunk ähnlich Skype oder Netmeeting ist lediglich ein Abfall-
produkt. Demgegenüber empfanden andere Leser selbst diese Spielart
von Echolink, wie übrigens auch QsoNet (siehe FA 11/06), kaum als
Abfallprodukt, sondern vielmehr als Wohltat, erlaubt sie doch sogar unter
amateurfunkwidrigsten Bedingungen noch, den Kontakt zu anderen
Funkfreunden aufrechtzuerhalten.
Die begonnene Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen, gehen doch
täglich per E-Mail, Telefon oder Post bei uns Wortmeldungen von Ihnen,
liebe Leser, ein. Für jede einzelne davon sind wir dankbar. Dazu gehört
selbstredend auch sachliche Kritik. Nur so erfahren wir ja, was Sie in der
Gesamtheit bewegt und was wir besser machen können − auch wenn
es bei dem breiten Themenspektrum dieser Zeitschrift nie gelingen wird,
alle Leser gleichermaßen zufrieden zu stellen.
Was uns aber zunehmend auffällt, ist die mangelnde Toleranz gegenüber
Themen, die einen selbst nicht interessieren, wohl aber vielleicht andere
Leser. Dabei ist gerade diese Form der Rücksichtnahme ein Wesens-
merkmal des Amateurfunks! Das ist bereits sinngemäß in dem von Paul
M. Segal, W9EEA, 1928 formulierten „The Amateur’s Code“ auf den
ersten Seiten eines jeden ARRL Handbook, auf www.arrl.org/acode.html
sowie eingedeutscht z. B. auf der Website des DARC-OV S27 nachzulesen.
Dieser Ehrenkodex beinhaltet obendrein einen weiteren Aspekt, nämlich
die ständige Vervollkommnung des eigenen Wissens zur Optimierung
der Stationsausrüstung, um einen möglichst effizienten Funkbetrieb
durchführen zu können. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den
Beitrag von Michael Höding, DL6MHW, in dieser Ausgabe auf S. 400
hinweisen, der möglicherweise von Vertretern des handgemachten,
„reinen“ Amateurfunks als ein nächster Schritt in die falsche Richtung
aufgefasst werden könnte.
Technikinteressierte und bastelnde Funkamateure haben hier sozusagen
in Grundlagenforschung etwas entwickelt, was nun durch funkende
Funkamateure genutzt werden kann: Bei der Software CW Skimmer
ermöglicht es die SDR-Technologie erstmalig, nahezu sämtliche Tele-
grafiesignale eines ganzen Bandsegments gleichzeitig und in Echtzeit
zu decodieren. Für DXer und Contester stellt dies die Nutzung von
verfügbaren und erlaubten Technologien dar, um die Ziele, DX-QSO
oder Contest-Multiplikator, bestmöglich zu erreichen. Auch „reiner“
Amateurfunk entwickelt sich weiter, und insoweit ist dieser Beitrag die
„geopferten“ drei Seiten unbedingt wert. Übrigens hat Michael dank
CW Skimmer VP6DX tatsächlich schneller in sein Log bekommen…
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
SDR für jedermann?
Die Zahl der Nutzer von softwaredefinierter Technologie (SDR) im
Stationstransceiver steigt ständig. SDR-Empfänger werden immer zahl-
reicher angeboten. Dennoch haben die „Big Boys“ unter den Amateur-
funk-Geräteherstellern noch keinen softwaredefinierten Transceiver in
Reinkultur auf den Markt gebracht; sie beschränken sich gegenwärtig
auf die partielle Einbringung der SDR-Technologie. Der bisher einzige
kommerziell hergestellte softwaredefinierte Transceiver − von Nach-
bauten einmal abgesehen − stammt von FlexRadio Systems aus den
USA. Demnächst kommt der ADT-200A von Hans Zahnd hinzu.
Woran mag das liegen? Vermutlich warten die großen Firmen ab,
inwieweit dieser Technikwandel im Amateurfunk auf Akzeptanz stößt.
Der für die Entwicklung leistungsfähiger und zuverlässiger Software
unabdingbare Aufwand mag ein weiterer Grund für die Zurückhaltung
der bedeutendsten Hersteller sein.
Denn technisch und betrieblich sind mit dem SDR deutliche Umstel-
lungen verbunden, die eine Bereicherung sind, aber auch als Reduzie-
rung auf „Computerfunk“ missverstanden werden können.
Dabei bietet SDR dem Amateurfunk im Grunde eine Rückbesinnung
auf seine Ursprünge, nämlich seinen technisch experimentellen
Charakter. Wenn der Funkamateur schon vor Jahrzehnten aus einzel-
nen Bauelementen etwas zusammenlötete und, sofern er etwas mehr
Fachwissen besaß, zuvor sogar als Schaltung konzipierte und berech-
nete − dann kann er nun sein SDR mittels fertiger Software den
verschiedensten Übertragungsverfahren und -parametern anpassen
oder sich sogar selbst Software maßschneidern. Das erfordert allerdings
− absolut nicht Amateurfunk-untypisch − den Willen zum Dazulernen!
Der erste Softwaretransceiver SDR-1000 erforderte dabei noch
überdurchschnittliche Lernbereitschaft des Nutzers. Kennzeichnend
für den ab Seite 251 dieser Ausgabe vorgestellten FLEX-5000A sind
dagegen die rasch mögliche Installation und Optimierung der Software
PowerSDR, was einen wichtigen Schritt in Richtung „plug and play“
oder dem „SDR für Jedermann“ bedeutet.
Auch im reinen Hobby-Bereich vollziehen sich interessante Entwick-
lungen. Über die Aktivitäten um das SDR-Projekt „SoftRock“, in
Deutschland federführend vorangebracht durch Bodo Scholz, DJ9CS,
haben wir bereits mehrfach berichtet. Einen anderen Ansatz verfolgt
Detlef Rohde, DL7IY, mit seinem Basisband-DSP-Transceiver, siehe
FA 5/07: Sein „Radio“ wird zwar auch durch Software definiert, läuft
im praktischen Betrieb jedoch ohne PC. Ab Seite 286 dieser Ausgabe
lesen Sie mehr über den zugehörigen DDS-VFO, der mit seinen
Parametern sogar die Obergrenze des heute mit Amateurmitteln
Machbaren repräsentiert.
Last but not least sei an das von Klaus Raban, DM2CQL, ins Leben
gerufene FA-SDR-Kit erinnert, für das weitere Ergänzungsbaugruppen
im Entstehen sind.
Gleich, ob Sie an einem hochwertigen Fertiggerät für den harten QSO-
Betrieb oder an einer kleinen Bastelei zum Erkenntnisgewinn interessiert
sind − SDR bleibt spannend, und der FUNKAMATEUR wird Sie auf dem
Laufenden halten!
Werner Hegewald, DL2RD
Messen heißt Wissen
Mit dem für die Amateurfunkprüfung erworbenen Wissen verfügt jeder
Funkamateur über die Grundlagen, um eine eigene Station verstehen zu
können. Und sei es, dass sie „nur“ aus fertigen Komponenten besteht.
Spätestens, wenn die theoretische Funktionsweise des Transceivers
und der Antennen nichts mehr mit ihrem praktischen Verhalten zu tun
haben, interessiert er sich für die Messtechnik. Aktive Bastler werden
hingegen ohne Mess- und Prüfgeräten ohnehin nicht auskommen. Eine
Schaltungsberechnung findet sich erst durch die praktische Funktion
und entsprechende Messungen bestätigt − oder auch nicht. Gerade
dann sind, wie bei einer Fehlfunktion eines Geräts von der Stange,
Messungen der Schlüssel zum Erkennen und Eingrenzen der Ursache.
Nun heißt es zwar selbstironisch „Wer misst, misst Mist“, was insbeson-
dere bei höheren Frequenzen an Bedeutung gewinnt. Und wenn auch
keine Messung hundertprozentig stimmt: Man kann abschätzen, wie
groß der Fehler ist und ob er letztlich Einfluss auf die Quintessenz der
Messung hat! Dazu sollte man wissen, wie das Messgerät sowie das zu
überprüfende Gerät im Großen und Ganzen funktionieren.
Dass das Interesse an moderner Messtechnik für unser Hobby groß ist,
beweisen neben unserer Leserumfrage von 2005 nicht zuletzt die immer
wieder per Leserbrief und E-Mail geäußerten Bitten, verstärkt Messtech-
nikprojekte zu veröffentlichen.
Für unsere Belange sind selten High-End-Geräte erforderlich und auch
Messungen mit Hobby-Instrumenten keinesfalls von vorn herein zum
Scheitern verurteilt. Gerade für übersichtliche Messungen bis in den
UKW-Bereich hinein ist ein Netzwerktester als sehr universelles und
kompaktes Gerät prädestiniert.
Bernd Kernbaum, DK3WX, baut schon seit Längerem solche Geräte für
den Kurzwellenbereich, die sich über einen PC steuern und abfragen
lassen. Auf dieser Basis konnten wir vor gut einem Jahr die ersten bis
zu 160 MHz einsetzbaren FA-Netzwerktester anbieten, für die Andreas
Lindenau, DL4JAL, die passende Software entwickelte. Seither ver-
zeichnen wir ein anhaltendes Interesse an diesem universell einsetz-
baren Gerät, insbesondere an Messzubehör. Nicht zuletzt hilft das von
Hans Nussbaum, DJ1UGA, verfasste Praxisbuch, die Möglichkeiten des
Netzwerktesters auszunutzen.
Über die Monate gesellten sich noch ein Reflexionsmesskopf, u. a. zum
Ermitteln des Stehwellenverhältnisses von Antennen und auf Koaxial-
kabeln, sowie ein 50-Ω-Zwischenstecker hinzu, durch die sich nun auch
Impedanzen bestimmen lassen. Außerdem erhielt die Software einige
neue Funktionen, die die Messmöglichkeiten erheblich erweitern oder
ihre Durchführung vereinfachen. Das Zubehör ergänzen wir ab Seite 166
dieser Ausgabe um ein feinstufig schaltbares Dämpfungsglied, sehr
wichtig, wenn geringere Signalpegel als vom FA-NWT abgegebenen
erforderlich sind oder eine variable Dämpfung in den Messkreis einge-
fügt werden soll.
Falls Sie sich für den FA-NWT interessieren, die Katze aber nicht im
Sack kaufen wollen, werfen Sie vorab einen Blick in das oben genannte
Praxisbuch und laden sich schon einmal die Software herunter, um
deren Funktionen kennen zu lernen. Sie werden erstaunt sein, wie sich
manch technisches Problem mit der passenden Messtechnik und
etwas Nachdenken quasi in Luft auflöst. Denn: Messen heißt Wissen.
Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
Bilanz zum neuen Jahr
In den 15 Jahren, die ich nun schon die verlegerische Verantwortung
für den FUNKAMATEUR trage, haben wir es im Team geschafft, die
Zeitschrift erfolgreich am Markt zu etablieren. Heute liest man diese
nicht nur in Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern,
sondern in der ganzen Welt.
Das beispielhafte technische Niveau des FUNKAMATEUR ist das hart
erarbeitete Resultat einer engen Kooperation der Redaktion mit den
Autoren. Unsere Zeitschrift findet eine hohe Anerkennung, wie wir
aus zahlreichen Leserzuschriften sowie aus persönlichen Gesprächen
wissen. Dabei haben die Redakteure jeden Monat eine schwierige
Aufgabe zu meistern − den Spagat zwischen den Interessen von
Funkamateuren und Elektronikern sowie gleichermaßen zwischen
Anfängern und Fortgeschrittenen.
Als Ergänzung zur Zeitschrift haben wir über die Jahre ein umfang-
reiches Serviceangebot entwickelt. Unser QSL-Shop als ein Teil davon
genießt dank hoher Qualität und günstiger Preise internationales
Ansehen und stattet immer wieder größere und kleinere DXpeditionen
mit den begehrten QSL-Karten aus.
Der FUNKAMATEUR-Leserservice ist längst dem Stadium eines simp-
len Versandbuchhandels entwachsen. Er kann auch viele besondere
Dinge liefern, die es kaum noch zu kaufen gibt, jedoch von aktiven
Funkamateuren benötigt werden. Transceiver und Antennen, die man
bei vielen Händlern bekommt, sind schließlich nicht alles. Neben
diversen HF-Spezialbauteilen und obsoleten Bauelementen stehen
seit ein paar Jahren auch Bausätze im Fokus unserer Bemühungen,
deren Entwicklung bis zur Marktreife jedes Mal eine neue Herausfor-
derung für alle Beteiligten darstellt. Und schließlich leisten wir dafür
noch Service und Beratung.
Auch im kommenden Jahr wollen wir interessante technische Beiträge
für den Nachbau aufbereiten. Außer weiterem Zubehör für unseren
Netzwerktester soll es auch Projekte geben, die sich in der Nach-
wuchsarbeit einsetzen lassen und zum Selbstbau anregen. Schließlich
fühlen wir uns diesbezüglich in der Pflicht, nachdem wir im deutsch-
sprachigen Raum seit zwei Jahren die einzig verbliebene Zeitschrift
sind, die regelmäßig, in hoher Auflage, preiswert und für jedermann
zugänglich auf den Amateurfunk aufmerksam macht und für dieses
interessante Hobby wirbt.
Unser Dank gilt allen treuen Lesern und selbstverständlich den
Autoren. Wir freuen uns nach wie vor über Anregungen, Ideen und
konstruktive Kritik. Auch unsere Maxime „Von Lesern für Leser“ gilt
unverändert. Wenn Sie etwas aus unserem Themenspektrum
entwickelt haben, von dem auch andere profitieren könnten: Zögern
Sie nicht – kontaktieren Sie die Redaktion!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesundes neues Jahr und
weiterhin viel Freude am Hobby.
Ihr
Knut Theurich
Herausgeber
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
DX-Highlights machen Appetit auf 2008
Für die DXer unter den Funkamateuren begann 2007 im Januar gleich
mit einem Paukenschlag, der lang ersehnten Aktivierung der Lakkadiven
unter VU7RG bzw. VU7MY (FA 5/07). Mehr als 110 000 Funkverbindungen
sprechen eine deutliche Sprache! Auch die BCC-Truppe unter
VK9DNX (FA 7/07) vollbrachte mit etwa 61000 QSOs eine tolle Leistung.
Norfolk war reif für eine größere Aktivität und die mehr als 23 000 Verbin-
dungen von 30 bis 160 m machten viele DXer glücklich. Im April folgte
eine der besten Südsee-Aktivitäten der „Neuzeit“: N8S vom Swains-Atoll
(Bericht folgt). Diese DXpedition wurde besonders von den europäischen
DXern herbeigesehnt, die bei der Erstaktivierung durch KH8SI (FA 2/07)
kein Jagdglück hatten. Das Warten wurde durch erstklassige Betriebs-
technik und herausragende OPs belohnt, die ihr Versprechen hielten und
ganz gezielt auf Europa hörten: Über 117 000 Funkkontakte fegten das
Swains-Atoll von Platz 1 der meistgesuchten DXCC-Gebiete der Welt
regelrecht hinweg. Ende April folgte ein weiterer Höhepunkt: Endlich
wurde Scarborough-Riff, BS7H, aktiviert (FA 8/07)! Das Team machte
45 820 Kontakte, wobei 17 884 Individualrufzeichen ins Log gelangten.
Die Signale waren in Mitteleuropa gut aufzunehmen, der Europa-Anteil
an den Gesamt-QSOs ist mit 35 % recht passabel.
Der obligatorischen Sommerpause folgte eine Mega-Aktivität der Fünf-
Sterne-DXer von St. Brandon unter 3B7C (Bericht in FA 1/08). Mehr als
137 000 QSOs wurden aus dem Indischen Ozean getätigt, wobei auch
DXer mit einfacher Stationsausrüstung zum Zuge kamen. UKW-DXer
freuten sich über 1A4A (Gratulation an DF2ZC zur Erstverbindung auf
144 MHz) sowie D44TD von den Kapverden (FA 11/07). Anfang Oktober
meldete sich Sigi, DL7DF, mit seinem Team aus Burundi und legte unter
9U0A wieder einmal eine tolle Leistung hin (S.1273). Es macht einfach
Spaß, derartige DXpeditionen zu arbeiten! Unvergessen ist auch die
26-monatige Mammuttour von UA4WHX durch Afrika. Seine Aktivitäten
führten nicht nur zu fast 310 000 Kontakten aus 21 DXCC-Gebieten,
sondern auch zum Verlust zweier Funkgeräte sowie eines Fingers…
Zusammengefasst: Wenn man bedenkt, dass 2007 mit Scarborough,
Swains und den Lakkadiven gleich drei Top-5-Länder aktiviert wurden,
dürfen wir uns über einen Mangel an rarem DX nicht beklagen.
Auf welche seltenen DXCC-Gebiete können wir uns 2008 freuen? Nun,
größere DXpeditionen von Ducie, VP6DX, Cocos, TI9K, und Clipperton,
TX5C, sind angekündigt. Auch eine Aktivierung von Nordkorea scheint
durch die Änderung des geopolitischen Umfeldes wahrscheinlich. Ge-
rüchte um mögliche Aktivitäten aus Jemen und von Bouvet halten sich
hartnäckig. Um eine geplante DXpedition nach Glorioso ist es nach
Übernahme der Hoheitsgewalt durch zivile Behörden still geworden,
doch ist die Aktivierung nicht abgesagt, sondern lediglich verschoben.
DX-Sorgenkinder sind leider weiterhin Navassa und Desecheo (Interview
mit NA5U: S.1368). Die Insel Marion, ZS8MI, rückt in der Liste unauf-
hörlich nach oben; mit wenig konkreter Aussicht auf eine Aktivierung in
näherer Zeit.
Doch wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt! Ich wünsche
Ihnen weiterhin ordentlich Spaß auf den Bändern, viel seltenes DX und
wenig QRM.
Dr. Markus Dornach, DL9RCF
Messen oder nicht messen?
Gelegentlich erreichen uns Fragen von Lesern zu unseren Testberichten
− warum der Transceiver X zwar getestet, aber nicht gemessen wurde,
wo denn der längst überfällige Bericht zum Handfunkgerät Y bliebe,
warum man denn dem Mobilgerät Z so viel Platz gewidmet habe usw.
Daher möchten wir heute zu diesem Thema etwas ausführlicher Stellung
nehmen.
Wir gehen bei den Gerätevorstellungen nach einem Stufenprogramm
vor: So gut wie alle Geräte bekommen ihren Platz auf den Marktseiten,
teilweise schon lange vor Verfügbarkeit auf dem hiesigen Markt. Das
soll auch Gerüchten Fakten entgegensetzen. Soweit es die verfügbaren
Daten hergeben, entwickelt sich daraus ein Typenblatt, das wir etwa
zeitgleich mit der Markteinführung zu platzieren versuchen. Langjährige
Abonnenten dürften bereits über einen satten Fundus an derartigem
Datenmaterial verfügen, das übrigens auch die Grundlage des beliebten
Buches „Preise und Daten“ bildet.
Wenn ein Gerät durch besonders interessante Eigenschaften Furore macht,
stellen wir dieses in knapper Form möglichst frühzeitig vor. Hierbei geht
es nicht um eine Wiedergabe des Herstellerprospektes, sondern um
eine nüchterne Beschreibung der neuen Funktionen und das Klarmachen
von Unterschieden zu Vorgängern sowie Pendants der Mitbewerber.
Diese Berichte beruhen auf intensivem Handbuchstudium und der
Verifizierung an einem Mustergerät, wobei wir besonderen Wert auf
Feinheiten legen, die in den Werbeschriften oft verloren gehen. Der
Beitrag zum FTM-10 in FA 9/07 ist ein typisches Beispiel dafür.
Was die neuen Funktionen wirklich wert sind, ist dagegen Gegenstand
von Praxistests: Hier vergleichen erfahrene Operateure Neues mit
Bewährtem und halten gegebenenfalls mit Kritik nicht hinterm Berg.
Wir hoffen, dass wir Sie beim FT-450 und beim IC-E2820 in der vorigen
bzw. in dieser Ausgabe nicht enttäuscht haben.
Nur dort, wo wirklich ein allgemeines Interesse zu vermuten ist, setzen
wir noch einen drauf und geben Messungen in Auftrag. Das betrifft
Geräte, die technologisch einen deutlichen Schritt nach vorn machen,
die wegen ihres einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnisses im Fokus
stehen oder als Dauerläufer prädestiniert sind. Messungen wie am
IC-R9500 in FA 7/07 oder beim FT-450 ab S.1165 erfordern allerdings
viel Zeit, und teilweise müssen spezielle Messhilfsmittel erst beschafft
oder hergestellt werden. Das können nur Enthusiasten bewerkstelligen,
die selbst als aktive Funkamateure ein brennendes Interesse an der
Durchführung derartiger Aktionen mitbringen.
Freilich ist so etwas nicht zum Nulltarif zu haben, was es uns jedoch
wert ist, um Ihnen den Geräteeigenschaften adäquate Untersuchungen
präsentieren zu können. Ungeachtet von im Hinblick auf die Vergleich-
barkeit identischen Messverfahren möchten wir Ihnen keine „Fließband-
arbeit“ anbieten. Dabei haben wir selbstredend nicht dieselbe Power
wie die QST mit ihrer durch die Größe der USA bedingt etwa vierfachen
Auflage, weshalb uns in manchen Fällen lediglich ein Verweis auf die
dort gewonnenen Ergebnisse bleibt.
Wir sind froh, in Christian Reimesch, DL2KCK, einen zuverlässigen und
kompetenten Partner gefunden zu haben, der nun bereits seit mehr
als zwölf Jahren für uns Messungen durchführt und sich damit dem
legendären Niveau von Günter Schwarzbeck, DL1BU, nähert.
Werner Hegewald, DL2RD
55 Jahre FUNKAMATEUR
In diesen Tagen feiert der FUNKAMATEUR seinen 55. Geburtstag.
Sicher kein Anlass zu einer großen Story*, für uns dennoch ein Grund,
den mehreren Tausend Autoren, die über diese lange Zeit zum Gelingen
der Zeitschrift beitrugen, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Dank gilt
freilich auch Ihnen, liebe Leser, die Sie der Zeitschrift als Abonnent oder
Kioskkäufer und vielleicht unserem Leserservice als Kunde mehr oder
weniger lange die Treue gehalten haben.
Als wirtschaftlich völlig selbstständiger Verlag müssen wir darauf be-
dacht sein, dass Sie unsere Produkte akzeptieren, sodass wir uns an
Ihren Interessen orientieren. Durch Ihre Willensäußerungen und Ihre
Kritik, zum Ausdruck gebracht in unzähligen Zuschriften, bei Leser-
umfragen und während persönlicher Kontakte, haben Sie, liebe Leser,
in der Gesamtheit, über die Jahre hinweg das Antlitz dieser Zeitschrift
mitgeprägt! Das gilt gleichermaßen für unsere Autoren, denn die Vielfalt
der eingereichten Manuskripte widerspiegelt ja die Interessenlage der
Leserschaft.
Auf der anderen Seite wollen Sie von uns als den fachkundigen Redak-
teuren über neueste Entwicklungen und Trends informiert werden, und
Sie erwarten von uns sicherlich auch eine eigene Meinung. Schließlich
unterliegen Amateurfunk und Hobbyelektronik weltweit einem stetigen
Wandel.
Obgleich der Amateurfunk inzwischen wirklich wieder im Vordergrund
steht, was in unserer langen Geschichte keineswegs immer der Fall war,
sprechen wir auf bewährte Weise zusätzlich Leserkreise an, die sich
für andere Funkanwendungen oder − traditionell − reine Elektronik inte-
ressieren. Das ermöglicht hier und da einen Blick über den Tellerrand
des eigenen Interessengebiets, wenn auch der eine oder andere be-
stimmte Seiten eher überblättern wird. Auf regelmäßig etwa 90 redak-
tionellen Seiten hoffen wir dennoch, jedem Leser weiterhin genügend
Interessantes bieten zu können, wobei wir stets bestrebt sind, leichte
Kost mit Anspruchsvollem zu paaren.
Selbstverständlich wenden wir uns gern den Anfängern zu, ebenso den
Neueinsteigern auf bestimmten Frequenzbereichen. Gerade dazu bedarf
es jedoch der Mithilfe der „alten Hasen“ − schicken Sie uns Ihre Tipps
und Tricks, auch wenn sie Ihnen eher profan erscheinen, und lassen Sie
die weniger Erfahrenen an Ihrem Wissensschatz teilhaben! Ferner sind
Bauanleitungen für Mess- und Prüfmittel im Shack sowie andere kleine
Helferlein im Alltag des Funkamateurs gefragt!
Unterstützendes Material zur Manuskripterstellung finden Sie auf unserer
Website unter „Mitmachen“ − und keine Angst, unsere Forderungen sind
in dieser Hinsicht minimal, ein paar wenige Dinge sind jedoch, druck-
technisch bedingt, einzuhalten. Letztlich entstehen die Beiträge auf
dieser Basis im Zusammenwirken zwischen Autoren und Redaktion,
deren Mitglieder sich in unserem Falle aus aktiven und gut ausgebil-
deten Funkamateuren rekrutieren, die sich entsprechend einbringen.
In diesem Sinne freue ich mich mit Ihnen auf viele weitere interessante
Jahre des vielfarbigen FUNKAMATEUR!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
* sechsseitige FA-Story siehe Ausgabe 10/02, noch im Leserservice erhältlich;
Story als PDF-Datei gratis auf www.funkamateur.de → über uns
Alles wird digital − nur das Radio nicht?
Die Deutschen sind so manches Mal Weltmeister im Schlechtreden −
insbesondere bei Erfindungen aus dem eigenen Land. Ob nun MP3 die
Musikindustrie ruiniert, Handys impotent machen − oder „kein Mensch
Digitalradio braucht“.
Natürlich fragen sich Kulturpessimisten, ob Radio und Fernsehen lebens-
notwendig sind. Doch beide Medien sind eingeführt und werden nicht
mehr verschwinden, auch nicht durch das WWW. DAB − Digital Audio
Broadcasting − wird dagegen totgeredet, seit es existiert: „Dead and
buried“ − tot und begraben −, so wird das Kürzel gerne übersetzt. Dabei
gedeiht DAB in England bestens: Nur die Kanäle 1 bis 4 der BBC werden
auf UKW übertragen, der Rest ist nur über DAB zu empfangen und
dennoch beliebt. Ebenso gibt es viele englische kommerzielle Radio-
stationen nur auf DAB. So viele, dass die Bandbreite nicht reicht und die
Bitraten deshalb nicht immer Hi-Fi-tauglich sind. Doch der Absatz von
DAB-Empfängern ist in England auch im iPod-Zeitalter nie ins Stocken
gekommen. Sie werden auch auf der IFA Berlin 2007 wieder auf zahl-
reichen Ständen zu sehen sein.
In Bayern ist DAB schon seit 1995 empfangbar, viel früher als in Eng-
land. Bis zum Jahr 2000 hätten alle anderen deutschen Bundesländer
nachziehen sollen. Doch gibt es von deutschen Herstellern bislang aus-
schließlich DAB-Autoradios und das System wurde in Norddeutschland
abgelehnt, weil es aus Bayern kommt − stattdessen sollte DVB-T, das
terrestrische Fernsehen, die Radioversorgung mit übernehmen. Als
Nächstes störte einige Intendanten, dass in DAB die Privatsender mit
weniger Sendeleistung und somit weniger Kosten die gleichen Reich-
weiten erzielen könnten wie die teuren 100-kW-UKW-Senderketten der
öffentlich-rechtlichen Anstalten. Schließlich sorgte die Bundeswehr für
„bedingte Empfangsbereitschaft“: Sie räumt die geplanten DAB-Kanäle
13 A bis F nicht und erzwingt eine Leistungsbeschränkung im Kanal 12
auf 1 kW. Wieder ein völlig nebensächlicher Grund, den Tod des Systems
herbeizuschreiben.
Wer als Fachjournalist positiv über DAB schreibt, muss mit Attacken durch
die erwähnten Intendanten rechnen und sich Bestechlichkeit durch die
nur in den Phantasien der Kollegen existierende „DAB-Lobby“ vorhalten
lassen. Trotzdem wurden weltweit bereits zwölf Millionen DAB-Radios
verkauft, 600 000 davon in Deutschland. Neu zugeteilte Frequenzen er-
lauben über 50 Programme in bester Qualität bundesweit, neue Kodie-
rungsverfahren noch mehr.
Satellitenfernsehen − samt Satellitenradio − ist längst auf Digitaltechnik
umgestellt, für HDTV geben Millionen Haushalte viel Geld aus, obwohl nur
wenige Sender zu empfangen sind, die meisten davon kostenpflichtig.
Währenddessen rauscht das Radio weiter analog und wartet auf DVB-H
oder DRM in Pseudo-Stereo, obwohl DAB inzwischen sogar 5-Kanal-
Surroundsound und AAC/MPEG4 beherrscht und längst landesweit in
Hi-Fi-Qualität zu empfangen ist.
Digitaltechnik wird beim Radio ebenso kommen wie bei Funktelefonen,
Fernsehen, Amateur- und Polizeifunk. In anderen Ländern werden mittler-
weile angesichts der DAB-Stagnation andere, schlechtere Digitalradio-
Standards entwickelt. Wird sich am Schluss wie bei den Videorecordern
(VHS) das schlechteste System durchsetzen?
Dipl.-Ing. Wolf-Dieter Roth, DL2MCD
Vom Transistor zum Controller
Das ganze neumodische Zeug verstehe ich nicht. Da lobe ich mir meine
gute alte Technik, die ich noch bis ins kleinste Detail nachvollziehen kann.
So oder ähnlich denken und reden leider noch viele Funkamateure und
Elektroniker. Doch die Zeiten, in denen massenhaft einzelne Transistoren
verbaut wurden, sind vorbei. Ohne die Nutzung von Schaltkreisen würden
wir einiges an Bedienkomfort und technischen Möglichkeiten verschen-
ken. Das fängt schon bei einer Frequenzanzeige an und hört beim Keyer
noch lange nicht auf. Auch die Möglichkeiten der digitalen Signalerzeu-
gung und -bearbeitung sowie die Nutzung der digitalen Betriebsarten
an sich wären dann undenkbar.
Wer nun fürchtet, in die Ecke der so genannten Steckdosenfunker abzu-
rutschen und nur noch Fertigprodukte verwenden zu können, den frage
ich, ob er denn in seinem High-Tech-Transceiver noch selbst Fehler
suchen und beseitigen kann, wenn denn ein Stromlaufplan vorhanden
wäre. Zu Ihrer Beruhigung: Selbst die Spezialisten können nicht mehr
vollständig erklären, was warum und wie in ihren Geräten abläuft. Bau-
gruppen- oder Schnittstellendenken ist da gefragt. Wenn mir klar ist, was
eine bestimmte Stufe oder ein IC leistet und wie ich dies beeinflussen
kann, habe ich meines Erachtens möglicherweise mehr gekonnt als
derjenige, der zum Beispiel die Werte aller Bauelemente in einer belie-
bigen konventionellen Stufe genau bestimmen kann.
Wir sollten uns daher von der Zwangsvorstellung lösen, die von uns
verwendeten oder gebauten Geräte bis zum Innenleben des letzten
Bauteils hin verstehen zu wollen. Dies ist im Zeitalter der immer stärker
in die Technik Einzug haltenden, hochintegrierten Schaltkreise gar nicht
mehr möglich. War es dem Interessierten in den Zeiten der TTL-Schalt-
kreise noch möglich, etwas über die Einzeltransistoren der verwendeten
ICs zu erfahren, so können einem heute sogar die Hersteller kaum mehr
sagen, was in ihren Chips ganz genau steckt. Sie geben lediglich den
Automaten vor, welche Funktionen implementiert sein sollen und diese
stellen ein optimiertes Layout für die Halbleiterfabrikation her. Diese
technische Evolution in der Elektronik wird durch die stetig fortgetrie-
bene Miniaturisierung immer stärker beeinflusst.
Zwar ist es uns Amateuren nicht möglich, selbst die Masken für ICs her-
zustellen, doch dies ist gar nicht nötig. Die Industrie bietet heute eine
Vielzahl von konfigurierbaren Schaltkreisen an, deren Arbeitsweise sich
durch ein wie auch immer geartetes Programm flexibel gestalten lässt.
Musste bei den an IC-Gräbern anmutenden Schaltungen früherer Tage
bei Änderungen noch umständlich die Verdrahtung verändert oder gar
eine neue Leiterplatte entworfen werden, ist die Anpassung an neue
Arbeitsaufgaben oder die Fehlerbeseitigung bei Controllern durch das
simple Einladen einer neuen Firmware möglich.
Nun will ich Ihnen nicht auferlegen, sich die Programme für jeden denk-
baren Controller selbst zu schreiben. Doch etwas Mut zu Neuem sollten
Sie als Experimentalfunker schon besitzen. Wie wäre es, im ersten Schritt
bereits fertig programmierte Exemplare zu verwenden? Die „Programmie-
rer von nebenan“ oder im OV können dabei bestimmt helfen − bei ICs für
die im FA veröffentlichten Beiträge häufig auch der Leserservice.
Der Appetit kommt bekanntlich beim Essen. Vielleicht gewinnen Sie ja
auf diese Art Geschmack an der Sache und wagen es, später die Pro-
grammierung selbst zu übernehmen oder gar kleine Steuerungen mit
Controllern, z. B. in BASIC, zu entwerfen. Einfache und gar nicht so teu-
re Entwicklungsoberflächen à la BASCOM & Co. machen den Einstieg
leicht. Trauen Sie sich!
Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
Keine Amateurfunkfrequenzen mehr?
Die Hiobsbotschaften überschlagen sich. 23 cm in Gefahr, 13 cm so
gut wie weg, 9 cm ist tot! Sind bald alle Frequenzen verloren? Stirbt
deswegen der Amateurfunk? Nein. Wenigstens wegen der Begehrlich-
keiten der kommerziellen Funkdienste wird er nicht sterben. Er wird
sich verändern. Ein Beleg dafür ist das 70-MHz-Band. Dort, wo der
öffentliche und nicht öffentliche kommerzielle Funk jahrzehntelang mit
FM-Technik aus der Nachkriegszeit seine Besitzstände gepflegt hat,
reift nun die Erkenntnis, dass das ineffizient, Ressourcen fressend und
geprägt von voluminösen Antennen ist. Als Folge geben die kommer-
ziellen Nutzer ihre Ansprüche in diesen Bereichen schrittweise auf und
der Amateurfunkdienst fasst dort Fuß. Neben den britischen Stationen,
solchen aus Gibraltar und von den britischen Basen auf Zypern tummeln
sich dort kroatische und slowenische Funkamateure; Ungarn und Polen
stehen in den Startlöchern.
Wir erinnern uns: In den Anfängen der drahtlosen Kommunikation in den
20er-Jahren herrschte die Meinung vor, dass sich alles oberhalb von
200 m Wellenlänge nicht für eine professionelle, kommerzielle Nutzung
eignet. Punkt. Fast das gesamte genannte Terrain stand den Funkama-
teuren zur Verfügung. Nicht einmal 30 Jahre später waren uns nur einige
wenige Megahertz in diesem Bereich geblieben. Der kommerzielle Krake
hatte fast das komplette Spektrum annektiert. Und das, obwohl man
damals mit Frequenzen noch kein Geld verdiente.
Und heute? Trotz digitaler Rundfunktechnik wird die Kurzwelle bestimmt
nicht von Funk à la 01111011 usw. okkupiert werden. Mittelwellen- oder
Kurzwellensender mit 500 MW und mehr wird es in Zukunft in der bisher
gekannten Dichte allerdings nicht mehr geben. Die Stabantenne am
Kofferradio mit AM-Teil wird durch eine kleine Flächenantenne für Direkt-
empfang vom Satelliten oder via HotSpot und Internet ersetzt. Und wer
gar kein Kofferradio mehr benutzen will, der hört (schon heute) mit dem
Handy seinen Lieblingssender.
Wir müssen wohl damit leben, dass unentgeltliche Frequenzzuweisungen
von einigen hundert Megahertz an den Amateurfunkdienst im Bereich
oberhalb 1 GHz der Vergangenheit angehören. Und es nützt wenig,
darüber nachzudenken, ob die dort Platz greifenden Nutzungen sinnvoll,
von öffentlichem Interesse, für die Anwender optimal oder elegant sind.
Denn diese Anwendungen werden im Gegensatz zu den unseren bezahlt!
Wer in dem Zusammenhang von den „bösen“ Kommerziellen redet,
sollte bedenken, dass wir in Wirklichkeit selbst indirekt eine Mitschuld
tragen, denn jeder „böse“ Kommerzielle erzielt seine Umsätze und Erlöse
mit uns, eben den Anwendern! Wir bestimmen so die Nachfrage, und die
bestimmt die Preise.
Was lehrt uns Funkamateure das? Andere Wege gehen? Eventuell die
Vernetzung der PR-Knoten via Internet und/oder oberhalb 10 GHz und
PR-Duplex-Zugänge zu unseren Digipeatern auf den vielleicht „kom-
menden neuen“ Amateurfunkbändern 220 oder 70 MHz? Warum nicht!
Eine Vertikal für 70-MHz-Packet-Radio oder ein 50-MHz-Dipol für die
FM-Funke ist das kleinere Übel als gar kein Packet-Radio oder gar kein
OV-Kanal mehr.
Der Amateurfunk hat bislang immer seine (Frequenz-)Nischen besessen.
Er wird auch in Zukunft seine Nischen finden, und es wird auch in Zukunft
Frequenzen für die Funkamateure geben. Nur eben vielleicht andere als
heute.
Peter John, DL7YS
Rückwärts in die Zukunft?
Als ich die Texte für das Packet-QTC auf S. 686 zusammenstellte, ergriff
mich Beklemmung: Waren es bisher nur Hiobsbotschaften von gelegent-
lichen Rechnerabstürzen, Plattencrashs und Antennenproblemen, so
fällt diesmal in fast jeder Meldung das Wort Rückbau. Dasselbe in einer
„Klarstellung zu Relais-Rück- und -Abbauten“ auf der Website des
DARC-Distrikts Berlin sowie in der entsprechenden Packet-Radio-Rubrik.
Zur Erinnerung: Mittels Packet-Radio können Funkamateure mit ihren
üblichen UKW-Funkgeräten untereinander Daten austauschen. Um die
Reichweite zu erhöhen und europaweite Kommunikation zu ermög-
lichen, wurde ein Netz aus Relaisstationen, so genannter Digipeater,
unter (seinerzeit wohlwollend geförderter) Mitbenutzung der Funktürme
der (ehemaligen) Deutschen Bundespost deutschlandweit in privater
Initiative flächendeckend aufgebaut.
Zwar hat Packet-Radio selbst über die Jahre an Bedeutung verloren,
weil das Internet in vielerlei Hinsicht das bessere Mittel zum Zweck ist,
aber gerade für Funkamateure in ländlichen Regionen, wo DSL und
UMTS noch Fremdwörter sind, blieb die Datenkommunikation über
Packet-Radio ein Segen. Das galt in besonderem Maße für Portabel-
einsätze von Contest-Teams, ist es doch vor allem auf den Gigahertz-
Bändern unabdingbar, potenzielle Gegenstationen per DX-Cluster
oder ON4KST-Chat zum Drehen der Antennen zu inspirieren.
Gegenwärtig genießen die Relaisstationen unseres Netzwerkes zwar
weiter Gastrecht auf den Funktürmen der Deutsche Telekom bzw. ihrer
Tochter Deutsche Funkturm, aber wir müssen mit ganz erheblichen
Einschränkungen leben. Die Zukunft bleibt dabei ungewiss.
Ein Ausweg besteht dabei in der bereits praktizierten Vernetzung über
das Internet (I-Gate). Sie füllt die entstandenen Lücken im Netz aus,
nützt denjenigen, die nun ihre Einstiegsmöglichkeiten per Funk einbüßen,
allerdings gar nichts. Zudem ist das Internet ein drahtgebundenes Netz-
werk. Wie sicher eine solche Hightech-Infrastruktur jedoch wirklich ist,
haben uns unlängst Elbhochwasser und Orkan Kyrill vor Augen geführt
− und wenn man den Klimaforschern Glauben schenken darf, war das
erst der Anfang! So gesehen kann unser drahtloses Datennetzwerk eine
ganz wesentliche Rolle im Katastrophenschutz spielen.
Leider steckt der Notfunk hierzulande, beispielsweise im Gegensatz
zu den USA, noch völlig in den Kinderschuhen. Das ihm innewohnende
Potenzial weiten Kreisen der Bevölkerung und insbesondere Entschei-
dungsträgern in Staat und Wirtschaft nahezubringen, ist m. E. eine
dringliche Aufgabe des RTA. Andererseits sollten auch die Ortsverbände
des DARC dazu wesentlich mehr als bisher auf lokaler Ebene durch
Beteiligung an geeigneten Events beitragen und auf die essenzielle
Bedeutung des Amateurfunkdienstes aufmerksam machen.
Bei allem Verständnis für die heutigen Finanznöte der Deutsche Funk-
turm sei den an den Schalthebeln sitzenden Betriebswirtschaftlern ferner
ans Herz gelegt, mit an die Zukunft zu denken. Findige, kompetente
sowie flexibel einsetz- und belastbare Ingenieure und Techniker, die
für das Wohl der Kommunikations-Infrastruktur dieses Landes sorgen,
rekrutieren sich immer noch zu einem wesentlichen Teil aus Kreisen
der Funkamateure − zum Beispiel solcher, die heute begeistert den
SHF- und EHF-Bereich erschließen und an den erwähnten Contesten
teilnehmen.
In diesem Sinne vorwärts und nicht rückwärts in die Zukunft!
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Haben Normen noch Sinn?
Als Funkamateur ist man gewohnt, sich an Regeln zu halten. Bevor wir
unser schönes Hobby ausüben dürfen, müssen wir Prüfungen ablegen
und Bewilligungen einholen. Gleichzeitig hat der Funkmessdienst
ständig ein Auge auf uns. Doch schauen wir uns einmal an, wie sich
die europäische Rechtsordnung im Sinne des gemeinsamen Marktes
um uns entwickelt hat. Da wurden „liberalisiert“ (Freiheit für den Funk-
amateur?) und Handelshemmnisse entfernt. Da sich einige Staaten
noch immer wehrten, hat Brüssel zum Werkzeug der EU-Richtlinie
gegriffen. So gilt eine Richtlinie (RTTE- bzw. EMV-Direktive) auch dann,
wenn sie fehlerhaft in nationales Recht umgesetzt wurde.
Herstellern steht sofort der gesamte europäische Markt offen, und wenn
ein in Verkehr gebrachtes Produkt den „grundlegenden Anforderungen
der Richtlinie“ nicht entsprechen sollte, kann die Behörde nationale
Aufsichtsmaßnahmen ergreifen und muss diese in Brüssel melden.
Um das Produkt vom europäischen Markt zu entfernen, müssten alle
Einzelstaaten separate Aktionen ergreifen. Ein sehr ineffizientes Vorgehen
in der Exekution der Bestimmungen. Engagiertes Vorgehen kennen wir
nur, wenn es darum geht, den Einzelnen zu kontrollieren und die Bürger-
rechte durch Pauschalverdächtigung mittels Vorratsdatenspeicherung
unserer Telefongespräche oder Internetaktivitäten einzuschränken.
Zurück zu den technischen Normen. Da ringen Experten jahrelang in
Gremien (DKE, CENELEC) um Grenzwerte für harmonisierte Normen
für Elektrogeräte, Multimediageräte oder Funkanlagen. Doch die EU-
Kommission hat schon die Lösung parat: Ein Hersteller benötigt künftig
weder den Nachweis, dass ein Gerät einer harmonisierten Norm ent-
spricht, noch muss eine zertifizierte Stelle die Konformität mit den
grundlegenden Anforderungen der Richtlinien bestätigen. Der Hersteller
kann sich dies selbst bestätigen und muss dazu keinerlei technische
Standards heranziehen, weil die Definition der so genannten „grund-
legenden Anforderungen“ in den Richtlinien völlig unklar ist.
Welchen Zweck das Anbringen eines CE-Zeichens noch hat, soll an
folgendem hypothetischen Beispiel gezeigt werden: Neuerdings gibt
es kleine FM-Sender, die die Musik vom MP3-Player im Bereich von
88 bis 108 MHz übertragen und damit den lokalen Empfang im Auto-
radio erlauben. Es wäre die RTTE-Richtlinie anzuwenden, und die
Allgemeingenehmigung erlaubt nur 50 nW. Würde (hypothetisch) ein
chinesischer Hersteller jedoch ein Gerät anbieten, das die Musik draht-
gebunden über die 12-V-Stromversorgungsleitung vom Zigaretten-
anzünder zur Batterie und von dort zum Radio leitet, so könnte er even-
tuell mehrere Watt einspeisen (und ungewollt abstrahlen). Der Empfang
wäre nicht nur im eigenen Auto glasklar, sondern auch die EMV-Normen
würden nicht greifen, da es sich ja um ein Nutzsignal handelt, das man
bei den Messungen ausnehmen könnte. Es wäre kein Funkgerät und
völlig bewilligungsfrei.
Wenn nun der rechtstreue Funkamateur fragend einwendet: „Aber was
ist, wenn das Gerät schädliche Funkstörungen verursacht?“ wird er
unglaubliche Antworten erhalten. Zuerst wäre noch wichtig, dass der
Hersteller größere Stückzahlen auf den Markt bringt. Dann könnte man
vermuten, dass sich keine Behörde mehr zuständig erklärt. Die Mark-
tüberwachung der BNetzA würde die formale Rechtmäßigkeit des
angebrachten CE-Zeichens bestätigen und auf die EU-Kommission
verweisen. Könnte es sein, dass Liberalisierung die Existenz des Ama-
teurfunkdienstes bedroht?
Ing. Michael Zwingl, OE3MZC, Präsident des ÖVSV
In eigener Sache
In den jüngsten sieben Ausgaben des FA finden Sie gleich drei hoch-
interessante Selbstbauprojekte: den FA-Netzwerktester, den PC-
unabhängig arbeitenden Antennenanalysator von DL1SNG sowie das
USB-Transceiver-Interface mit Soundchip von DC2PD und DC6JN, das
bei der 51.Weinheimer UKW-Tagung als Gesamtsieger des Selbstbau-
wettbewerbs hervorging.
Alle diese Bauprojekte stellen Spitzenleistungen dar, basieren auf
modernsten Bauelementen, haben für den Anwender hohen Nutzwert
und werden daher viele Interessenten finden. Nachbauen wie früher
lässt sich so etwas freilich kaum noch. Otto Normalamateur kann weder
die Platinen selbst ätzen noch bekommt er die Bauteile in absehbarer
Zeit zusammen. Von den handwerklichen Tücken des Verlötens kleinster
Vielbeiner einmal ganz abgesehen.
Obwohl das für eine Zeitschrift eher unüblich ist, bereiten wir für diese
Projekte Bausätze mit industriell teilweise vorbestückten Platinen vor,
die wir über den Leserservice vertreiben. Wenn alles gut geht und die
Lieferanten die Termine einhalten, ist mit einer Verfügbarkeit im April
(Antennenanalysator) bzw. Mai (USB-Interface) zu rechnen.
Damit unsere Leser zum Erfolg kommen, die Geräte letztlich funktio-
nieren, erstellen wir gemeinsam mit den Entwicklern mit größter Sorg-
falt umfangreiche Bauanleitungen. Das schließt freilich nicht aus, dass
Fragen offen bleiben bzw. der Nachbauer Ideen hat, das Ganze oder
Details zu verbessern. Und hier liegt ein Problem: Bitte wenden Sie
sich mit allen Fragen zu unseren Bausätzen direkt an den FUNK-
AMATEUR-Leserservice und möglichst nicht an die kreativen Köpfe
selbst. Die nämlich sind voll berufstätig, haben Schaltungen und Pla-
tinen in ihrer Freizeit erdacht und könnten die vielen Anfragen kaum
bewältigen, die solche Projekte nach sich ziehen. Das würde schon
für ihren häuslichen Frieden eine ernsthafte Bedrohung darstellen.
Insofern gibt es zwischen Bausätzen vom FA und beispielsweise
ELV gravierende Unterschiede: Die Entwicklungsarbeit bei den FA-
Projekten ist Hobby und soll Hobby bleiben. Also alle Fragen und
Anregungen bitte nur an die unten genannten Kontaktmöglichkeiten
und vorzugsweise schriftlich, d. h. per E-Mail, Kontaktformular oder
Fax. Wir sammeln sie und leiten sie komprimiert weiter. Gleichzeitig
kommen Informationen, die von allgemeinem Interesse sind, auf eine
spezielle Support/FAQ-Seite unseres Online-Shops, die wir dieser
Tage einrichten.
Es gibt aber ein weiteres Problem. Was geschieht, wenn der Bausatz
fertig zusammengelötet ist, aber nicht so funktioniert, wie er soll?
Unsere Haltung dazu ist eindeutig: Wir verkaufen Bausätze und keine
Fertiggeräte. Für bei uns oder während der industriellen Bestückung
entstandene Fehler stehen wir selbstverständlich ein. Der Rückblick auf
überschaubare Misserfolgs-Einzelfälle zeigt jedoch, dass es sich fast
immer um Fehler beim Zusammenbau oder um Defekte infolge un-
sachgemäßen Umgangs handelt. Wenn bei uns kalte Lötstellen oder
Lötbrücken gesucht und beseitigt werden müssen, geht das verständ-
licherweise nur, wenn der Kunde die Arbeitszeit und die Ersatzteile
bezahlt, wobei unsere Preise in vertretbarem Rahmen bleiben.
Peter Schmücking, DL7JSP
E-Mail: shop@funkamateur.de oder
www.funkamateur.de → Kontakt → Warenversand/Online-Shop
Fax (030) 44 66 94 69; Tel. (030) 44 66 94 72
Die DOs kommen auf die Kurzwelle
Die jährliche QSO-Party im Februar ist gelaufen. Es war wieder ein
Funkaktivitätstag für den „kleinen Mann“ − abseits vom Contest-
Leistungssport, ohne eine Platzwertung. Sieger sollte hier jeder
mit seinen QSO-Erlebnissen und vielleicht eigenen Zielsetzungen
sein. Dafür bot die Party eine gute Grundlage. Die Begeisterung
war entsprechend groß.
Diesmal kamen der Party zwei Dinge besonders entgegen: Das
80-m-Band bot ganztägig beste Chancen auf Verbindungen und
auf diesem Kurzwellenband waren nun auch die Funkfreunde mit
Einsteigergenehmigung dabei. In den eingereichten Logs fanden
sich insgesamt 1880 deutsche Rufzeichen, darunter immerhin
350 DOs, von denen wiederum 45 % auch auf Kurzwelle funkten.
Zwei DO-Stationen bevorzugten sogar Telegrafie-Betrieb.
In zwei 80-m-Logs mit 370 bzw. 332 QSOs tauchten sogar 17 bzw.
15 % dieser von manchem Artgenossen voller Skepsis gesehenen
Einsteiger-Rufzeichen auf. Unter den Party-Log-Einsendern mit
mehr als 100 QSOs befinden sich übrigens sechs DO-OMs und
eine DO-YL. Das erinnert an das Debüt der ehemaligen Klasse-2-
Inhaber auf Kurzwelle. Zurückhaltung bis Ablehnung sind inzwischen
weitestgehend gewichen und DCs & Co. auf den KW-Bändern eine
nicht mehr wegzudenkende Selbstverständlichkeit.
Ein anderer Fakt ist nicht minder interessant: Bei der Party werden
Rapport und Alter als Kontrollzahlen ausgetauscht. Diese Offen-
legung persönlicher Daten macht die Kontakte häufig individueller;
ältere Funkamateure erfahren so vielfach besondere Anerkennung
und Würdigung, wie ja mancher von ihnen stolz auf seine funke-
rischen Leistungen im hohen Alter ist. Auch junge Leute spüren
hier mehr Entgegenkommen als bei anderen QSO-Gelegenheiten.
Das Durchschnittsalter der Teilnehmer lag bei 53,5 Jahren; die DOs
waren im Durchschnitt 10 Jahre jünger. Auch die Funkamateure
mit DB- bis DG-Rufzeichen haben die KW-Funkgemeinde verjüngt.
Lediglich für Ausbildungszwecke und die damit verbundene Auf-
frischung des Teilnehmerfeldes wird die Party wenig genutzt.
Knapp 20 Stationen traten diesmal an, und nur etwa ein Drittel der
Ausbilder veranlassten ihre Schützlinge zum Anfertigen eines Logs,
sodass die verbleibenden auf ihre Party-QSL verzichten müssen.
Sollte dies womöglich der wahre Spiegel der Amateurfunk-Aus-
bildungstätigkeit in Deutschland sein?
Zurück zu den Funkaktivitäten. Fünf Monate nach der Zulassung
der Einsteiger auf der Kurzwelle sind sie unüberhörbar präsent.
Wer die technischen Voraussetzungen hat, kann sich auch ein Bild
der Aktivität der DO-Station in den digitalen Betriebsarten machen.
Der Amateurfunk ist für sie eine Computeranwendung, weltoffen
und nicht anonym, eine Herausforderung in jeder Hinsicht. Von
dieser Gruppe dürfen wir neue Impulse und vielleicht auch neue,
zeitgemäße Inhalte für den traditionsreichen Amateurfunk erwarten.
Zusammengefasst: Die DOs kommen nicht erst auf die Kurzwelle −
sie sind schon längst da!
Hardy Zenker, DL3KWF
Freunde, kommt runter von der Insel und rein ins Boot!
Zugegeben, man tut sich wirklich schwer, etwas Kritisches zum Thema
DARC-Führung zu schreiben − aus lauter Angst, gleich mit der AGZ-
Kanone erschossen zu werden. Wer mich kennt, weiß aber, dass
ich für meinen DARC eintrete und Mauern einreißen statt aufrichten
möchte. Es tut manchmal schon weh zu erleben, wie schwer Ihr Euch
damit tut, seit Jahren erkannte Probleme zu lösen.
Ein Beispiel: Die Jahreshauptversammlung 2003 stellte fest, dass,
obwohl der DARC zwar den größten Zusammenschluss deutscher
Funkamateure darstellt, die Kompetenz im Amateurfunk inzwischen wo-
anders zu finden ist. Ob AATIS, AGAF, AMSAT-DL, BCC, DL-QRP-AG,
Jugendtechnikschule usw. − überall haben sich begeisterte Funkama-
teure zusammengefunden, die in Arbeitsgemeinschaften außerhalb
des DARC für den Amateurfunk arbeiten. Auch der FUNKAMATEUR
und wir Redakteure und Autoren gehören dazu!
Ist es nicht schlimm, wenn auf der jüngsten Sitzung eines Arbeits-
kreises im Januar 2005 die „Öffnung des DARC gegenüber anderen
Verbänden“ wieder einmal „zurück gestellt“ wurde? Ihr wisst genau wie
ich, dass in den Kernbereichen des DARC mehr Arbeit von den AGs
geleistet wird als vom DARC selbst. „Wir fördern den Amateurfunk und
die Amateurfunktechnik in Deutschland durch Aus- und Weiterbildung“,
schreiben wir stolz in unseren DARC-Broschüren. In Wirklichkeit wird
die Arbeit von einzelnen, begeisterten Funkamateuren durchgeführt,
doch meist vom Verband ignoriert und nicht unterstützt, weil die Schüler
ja schließlich keine Verbandsmitglieder sind.
Die Mitgliederzahl als einziges Kriterium zu sehen wäre ein verhängnis-
voller Fehler. Nur Aus- und Weiterbildung im Jugendbereich bieten
kurzfristig die Chance, in Politik und Öffentlichkeit einen positiven Ein-
druck zu erzielen. Glücklicherweise haben das die Praktiker in unseren
Referaten längst erkannt. Besonders AJW (Ausbildung, Jugend und
Weiterbildung) hat in den vergangenen beiden Jahren eine erstaunliche
Wandlung durchgemacht und überrascht mit modernen Konzepten.
Und ebendieses Referat soll womöglich aus Kosten- und Struktur-
gründen aufgelöst werden? Das werden die Weitsichtigen unter meinen
ehemaligen Amateurratskollegen hoffentlich verhindern.
Langfristig werden aus den Jugendlichen diejenigen 35-Jährigen,
die eine unselige Statistik uns als alleinige Zielgruppe vorschreiben
möchten, weil sie Vollzahler sind und länger Mitglied bleiben. Länger-
fristig werden wir so allerdings immer weniger 35-Jährige finden,
weil ein 35-Jähriger eher zu den Kaninchenzüchtern geht, wenn er
diese als Jugendlicher kennen gelernt hat.
Apropos Kaninchen, wir hatten auf dem Treffen der Kleintierzüchter
viel Spaß. Alle Kinder, die genug gestreichelt hatten, kamen an unseren
Stand ein wenig löten. Kein einziges ist daraufhin in den DARC ein-
getreten, aber der Kleintierzüchterverband möchte uns beim nächsten
Hähnekrähen auch wieder dabei haben.
Alle Welt redet von Synergien: Begrabt das Vereinsmeiertum, kommt
ins Boot! Wir aus den Interessen- und Arbeitsgemeinschaften, aber
auch die Mitglieder der Interessenorientierten, DARC OV „Freunde
des Chaos Computer Clubs“ D23 und „BIG-ATV“ D24, sind schon
mal losgefahren.
Peter, DL2FI; ehemaliger DV Berlin
Zuversichtlich ins 55. Jahr
Im Oktober 2007 werden wir das 55-jährige Bestehen des
FUNKAMATEUR feiern. Das ist an sich nichts Besonderes, wäre
er nicht seit nunmehr einem Jahr das einzige, noch im Handel ver-
bliebene Magazin für den Bereich Hobbyfunk im weitesten Sinne.
Dabei war unsere Ausgangssituation alles andere als gut, als wir
uns 1993 dem Wettbewerb mit „beam“, „funk“, „CB-funk“ und
vielen anderen stellen mussten. Statt Kapital hatten wir Ideen, die
mit hohem Risiko umgesetzt wurden. Dass dies gelang, verdanken
wir unseren Autoren, den Redakteuren und vor allem den Abon-
nenten, die uns in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben.
Womit wir bei einem wichtigen Thema wären. Sicherlich leuchtet
jedem ein, dass sich die erheblichen und ständig steigenden
Kosten bei der Herstellung der Zeitschrift durch die Anzahl der
verkauften Hefte teilen. Deshalb bemühen wir uns permanent um
neue Abonnenten, damit deren Anzahl − trotz altersbedingter
Kündigungen − stabil bleibt. Kleine Angebinde, ohne die in der
Abo-Werbung kaum noch etwas läuft, sollen die „Alt-Abonnenten“
natürlich keinesfalls verärgern. Weil wir aber verhindern konnten,
dass die Zahl der Abonnenten zurückgeht, ist der Heftpreis bereits
seit über fünf Jahren stabil ! Und davon profitieren alle, auch unsere
Stammleser.
Übrigens hat sich die kostspielige Übernahme der „funk“ als sinn-
voll erwiesen − sind doch die meisten Leser bei uns geblieben.
Wir haben Themenbereiche neu erschlossen und kompetente
Autoren, die sich bislang eher der „funk“ verbunden fühlten, für
den FUNKAMATEUR gewinnen können. Gleichwohl blieb es bei
unserem bewährten Konzept, über den Amateurfunk hinaus die
Gebiete Funk und Hobbyelektronik abzudecken. Dabei technisch
Anspruchsvolles mit leicht Verständlichem zu kombinieren ist ein
Spagat, der von den Redakteuren allmonatlich Fingerspitzengefühl
verlangt.
Mit einer Auflage in der Größenordnung der DARC-Klubzeitschrift
und seinem technischen Niveau gehört der FUNKAMATEUR
mittlerweile zur ersten Liga − weltweit! Wir nähern uns der Zahl
von 3000 Auslandsabonnenten, dazu kommen über 2000 Hefte,
die vor allem in Österreich, in der Schweiz sowie in den Benelux-
Ländern über den Zeitschriftenhandel verkauft werden. Daher darf
man inzwischen sagen, dass der FUNKAMATEUR − zumindest
in gedruckter Form − den deutschen Amateurfunk im Ausland
repräsentiert.
Wie wir das erreicht haben? Zum einen sind es unsere Mitarbeiter,
die mit Freude ihre hohe fachliche Kompetenz und langjährige
Erfahrung einbringen. Zum anderen erweist es sich als Vorteil,
dass die Zeitschrift unabhängig ist. Weder bestimmt ein Verein,
was wir drucken müssen, noch gibt es einen Mutterkonzern, der
über uns bestimmt.
So können wir die Zeitschrift und unser breit gefächertes Service-
angebot so weiterentwickeln, wie wir es − als Leser − selbst von
einer Amateurfunk- und Elektronikzeitschrift erwarten würden.
Knut Theurich, DG0ZB
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Datenstau
In den vergangenen zwölf Monaten war es recht still um Digital
Radio Mondiale (DRM), dem internationalen Sendestandard für
digitalen Hörfunk auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle. Noch auf der
IFA 2005 hatten sich führende Vertreter des DRM-Konsortiums
vor die internationale Fachpresse gestellt und versprochen:
Weihnachten 2005 kommen die ersten preisgünstigen DRM-
Kofferradios für den so genannten Massenmarkt. Denn die AM-
Bereiche sollen bald in Europa und später weltweit nicht länger
ausschließlich für Radiofreaks interessant sein, sondern dank
rausch- und störungsfreier Digitalqualität künftig wieder alle
Radiohörer erreichen.
Nun ist ein Jahr vergangen und das erste DRM-Kofferradio seit
Oktober im Handel. Offenbar hatten die DRM-Manager ihre
Rechnung ohne die softwaredefinierte Empfangstechnik gemacht,
deren Entwicklung weiter als erhofft von ihrer Marktreife entfernt
war − Toll Collect lässt grüßen. Die lange Wartezeit stellte nicht nur
die Hörer auf eine harte Geduldsprobe, sondern auch die quasi
unter Ausschluss der Öffentlichkeit digital sendenden Radio-
stationen. Das könnte sich nun ändern, denn mehrere Hersteller
arbeiten an weiteren Empfängern. Gleichzeitig steigt das Angebot
empfangbarer DRM-Programme internationaler wie nationaler Hör-
funkstationen. Hörfunkpionier RTL Radio arbeitet fürs kommende
Jahr an weiteren Projekten − lassen wir uns überraschen.
Trotz dieser positiven jüngsten Entwicklungen hat DRM nicht nur
Freunde unter den BCLs. So ist die Ellenbogenmentalität mancher
Frequenzplaner ein ständiges Ärgernis: Statt ihr permanent 10 kHz
breites DRM-Signal auf Frequenzen in den Randbereichen der nach
wie vor dicht belegten AM-Kurzwellenbänder zu legen, senden
Deutsche Welle, RTL & Co. mitten im Band. Damit beeinträchtigen
sie nicht nur den Empfang schwacher AM-Signale, sondern stellen
sich mitunter selbst ein Bein, wenn Gleichkanalstörungen von
Stationen aus anderen Regionen den Digitalempfang beenden. Die
von Radiohörern seit Jahren gegenüber dem DRM-Konsortium vor-
gebrachte Forderung nach getrennten Bandbereichen für analoge
und digitale Rundfunksignale stößt dort bislang intern beständig
auf Ablehnung − und wird offiziell ignoriert. Vielleicht bewirkt dem-
nächst die Empfangspraxis mit den neuen digitalen Kofferradios
ein Umdenken bei den Frequenzplanern, denn auf einer gestörten
Frequenz ist schnell Schluss mit dem Digitalempfang.
An anderer Stelle ziehen Hörer und Sender an einem Strang: Im
Stillen betreiben die im DRM-Konsortium versammelten Stationen
internationale Lobbyarbeit gegen die Verbreitung von PLC, also
der Datenübertragung per Stromleitung. Allerdings ist PLC im
häuslichen Störspektrum nur eine von vielen Spitzen in einem
Meer von Eisbergen. Hier sind wir alle gefragt, ob BCL, SWL oder
Funkamateur: Wir müssen offensichtlichen Störsignalen jetzt
konsequenter nachgehen, Verursacher identifizieren, Verkäufer
sowie Hersteller damit konfrontieren und auf Wandlung drängen.
Immer wieder.
Ich wünsche uns allen künftig einen störungsfreieren Empfang.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Amateurfunkprüfung „echt easy“ − und dann?
Durch die neuen Prüfungsbedingungen in Deutschland wird die
Attraktivität der E-Klasse zweifellos erhöht. Bei Genehmigung und
Errichtung der Antennenanlage wird sich der Newcomer jedoch
möglicherweise mit der Elektrosmoghysterie seiner Nachbarn kon-
frontiert sehen. Diese Probleme bestehen auch in anderen Industrie-
ländern; Amateure weltweit haben inzwischen Mittel und Wege
gefunden, um trotzdem funken zu können. Einige davon lasen Sie
schon im FA.
Wenn trotzdem die Anzahl der Funkamateure zurückgeht, liegt das
u. a. an zunehmend starken Empfangsstörungen. Amateurfunk ist
eben Experimentalfunk und spielt sich oft an der „Grasnarbe“ ab.
Beispielsweise ist der Bereich 144,000 bis 144,050 MHz in Bal-
lungsgebieten nicht mehr verwendbar, weil sich da die Oberwellen
sämtlicher Computerquarze „treffen“. Die dort tätig gewesenen
EME-Freaks sind auf andere Frequenzbereiche ausgewichen.
Besonders krass sind ungesetzliche Störungen durch PLC. In Mann-
heim z. B. wurden 2003 von der RegTP Störfeldstärken von 30 dB
über den NB30-Grenzwerten gemessen. Trotzdem sperrte die
Behörde bisher die PLC-Anlagen von Energieunternehmen nicht.
PLC wird sich wegen Unattraktivität und Unwirtschaftlichkeit tot-
laufen, aber leider nur langfristig. Ein weiteres Problem stellt die
In-Haus-PLC-Technik dar, die aber teilweise − dank Initiative der
Funkamateure − Amateurfunkbereiche ausspart. Äußerst verwun-
derlich ist hier allerdings, wieso sich die öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten, die im KW-Bereich auch innovative Verfahren
wie DRM einsetzen, nicht massiv dagegen zur Wehr setzen.
Zusätzlich machen es Bandeindringlinge jeder Art den Funkamateu-
ren schwer. Die DARC-Bandwacht, die solche Informationen sam-
melt und Verstöße dankenswerterweise anprangert, braucht die
Unterstützung aller Funkamateure! Und schließlich stören ja nicht
nur Schwarzfunker mutwillig auf den KW- und UKW-Bändern.
Gegenmaßnahme: Keinesfalls antworten!
Es ist bereits vorgeschlagen worden, nach technischen Lösungen
gegen bestimmte Arten von Funkstörungen zu suchen, z. B. compu-
tergestützte Signalanalysen einzusetzen oder von allen nutzbare,
abgesetzte KW-Empfangsstationen außerhalb der Ballungsgebiete
zu errichten. Gerade hier wären Newcomer gefragt, die ihr an Hoch-
und Fachschulen frisch erworbenes Wissen einbringen können! Und
die kommerziellen Hersteller von Amateurfunkgeräten werden sich
ebenfalls auf neue Herausforderungen einstellen müssen.
Vergessen Sie nicht, dass wir auch gemeinsam Möglichkeiten gefun-
den haben, der zunächst als existenzielle Bedrohung empfundenen
Pflicht zur Abgabe der „Selbsterklärung“ mit vertretbarem Aufwand
nachzukommen − und wir haben dabei obendrein eine ganze Menge
gelernt!
Werner Hegewald, DL2RD
Amateurfunk − elitär oder „echt easy“?
Eine niederländische Befragung unter Jugendlichen darüber, was ihnen
denn am Amateurfunk besonders läge, brachte als Ergebnis folgende
Reihung der Interessen: Conteste, Diplome, QRP, Funkgerät und PC,
Amateurfunk in Gruppen, Notfunk, Naturerscheinungen, Funk und As-
tronomie. Keine Technik (siehe Bericht über die Ham Radio im FA 8/06).
Eine Leserzuschrift dazu: „So etwas darf man nicht unkommentiert
stehen lassen. Der Technik gehört im richtigen Amateurfunk höchste
Priorität! Seiner Qualität wäre es zuträglich, wenn es keine kommerziel-
len Anbieter mehr gäbe und Funkamateure ihre Stationen wieder selbst
bauen müssten.“ Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Technik
ist sehr viel diffiziler und nicht zuletzt miniaturisiert geworden, sodass
Selbstbau praktisch nur noch für QRP-Geräte und Peripherie infrage
kommt und man in der Regel auf den Kauf ausweicht. Da darf dann
zum Technik-Verständnis wohl schon die gekonnte Bedienung eines
solch verzwickten Geräts zählen.
Ein anderer Vorwurf: „Die Jungen wollen sich nichts mehr erarbeiten“
ist sicher nicht zu verallgemeinern. Und was dran ist, werden wir Funk-
amateure bestenfalls zu einem geringen Teil kompensieren können.
Verbreitete Technikfeindlichkeit, gepaart mit der immer weiter fort-
schreitenden Kompliziertheit der Technik, machen es einem Anfänger
schwer. Sich zunehmend verbilligende Kommunikationsmöglichkeiten,
das Internet und immer mehr Freizeitangebote stehen in Konkurrenz
zum Amateurfunk. Wer wird sich also abplagen, hohe Hürden für ein
zunehmend weniger attraktives Hobby zu nehmen? Ungeachtet der
Bemühungen zur Nachwuchsgewinnung an vielen DARC-Ortsverbänden
und Schulen überaltert darum der Amateurfunk.
Hohe Ansprüche zu stellen, bedeutet unter diesen Bedingungen leider,
kaum Nachwuchs zu gewinnen − wodurch sich die Zahl der Funkama-
teure auf natürliche Weise reduziert. Kaum zu erwarten, dass der
Gesetzgeber solch einem schwindenden Häufchen weiter umfangreiche
Privilegien einräumt.
Anderer Weg: leichterer Zugang mit einem damit verbundenen ge-
wissen Niveauverlust. Eingeschränkte Betriebsmöglichkeiten für die
Einsteiger. Auch die von den Angelsachsen praktizierte Möglichkeit,
kaum Technikprüfung, dafür aber nur noch Betrieb mit zertifizierten
Geräten, scheint nicht so völlig abwegig. Daneben selbstverständlich
die herkömmliche Vollversion inklusive kompletter Rechte.
Ob es uns passt oder nicht: Wir müssen den Gegebenheiten ins Auge
sehen. Dass „Klasse statt Masse“ auf Dauer wirklich etwas bringt,
bleibt zu bezweifeln. Denn für einige wenige Klassefunker gäbe es
beim Frequenzhunger diverser Funkdienste vermutlich bald keinen
Platz mehr. Zur Beruhigung: Die Freigabe der Kurzwelle für Nichttele-
grafisten hat ja auch nicht zum Zusammenbruch des KW-Funkbetriebs
geführt.
Einzige Alternative: Selbst Jugendarbeit betreiben, auf die Interessen
der Jugendlichen (s. o.) eingehen und dabei dennoch versuchen, die
Liebe zur Technik zu wecken. Dann könnte es mit „Klasse und Masse“
etwas werden.
Bernd Petermann, DJ1TO
Vorsichtig klicken!
Nun hat es auch die Gemeinde der Nicht-Windows-Nutzer allmählich
erwischt: die täglichen Updates für ihre großen und kleinen Rech-
ner. Waren sie anfangs auf der Seite derer, die müde über die
Produkte aus Bill Gates’ Softwareschmiede lächelten, so gehören
die kleinen Programmkorrekturen mittlerweile unverzichtbar auch
zu ihrem Tagesprogramm.
Ständig werden neue Sicherheitslücken und Mängel in den für den
Betrieb eines modernen Rechners erforderlichen Softwarepaketen
entdeckt, die dieses Verfahren notwendig machen − sagen jedenfalls
die Softwarehersteller und Unternehmen, die sich mit der Sicherheit
im Internet befassen. Für Letztere stellt das Entdecken eines Mangels
einen gewissen Werbeeffekt und damit auch eine erhoffte Umsatz-
steigerung dar. Und den Leuten, die an der Entwicklung der Betriebs-
systeme und Programme beteiligt sind, bescheren solche Lücken
zusätzliche Arbeit.
Aus gutem Grund installieren seriöse IT-Administratoren daher auf
den ihnen anvertrauten Rechnern nicht sofort alle neuen Programme
und Patches, sondern testen sie erst auf ihre Kompatibilität zu den
schon verwendeten Hard- und Softwarekomponenten. Viele Nutzer
sind mit so einer Vorgehensweise verständlicherweise überfordert
und haben obendrein die Übersicht, welches Update was reparieren
soll, längst verloren. Überdies wird ihre genaue Bestimmung oft
genug nur nebulös oder gar nicht beschrieben.
Zwar lassen sich Sicherheitslecks und Fehlfunktionen bei den immer
komplexeren Programmen nicht völlig vermeiden − bei weniger Zeit-
druck wären aber sorgfältigere Tests vor den Veröffentlichungen
möglich, sodass die Käufer nicht als Beta-Tester herhalten müssten.
Denn gerade diese Tests machen ja auch die Hacker bei ihrer Suche
nach Angriffspunkten! Wird eine Sicherheitslücke dann noch auf
dem einen oder anderen Weg öffentlich, ruft sie weitere „Böse“ für
die Entwicklung von Viren, Trojanern und anderem, auf Seite 1004
genanntem elektronischen Ungeziefer auf den Plan. Also tut der
Nutzer gut daran, die Lücken, wenn auch mit dem Restrisiko eines
partiell verschlimmbessernden Sicherheitspatches, schnellstmöglich
mit den von den Herstellern angebotenen Mitteln zu schließen.
Bei Funktionspatches mag man es anders sehen.
Völligen Schutz vor Angriffen bieten Patches, Firewalls und Viren-
schutzprogramme nicht, denn gerade Letztere können nur zeitlich
verzögert dem Auftauchen neuer Schädlinge hinterhereilen. Und
oft genug sitzt ja die Ursache für einen Viren- oder Trojanerbefall
vor dem Bildschirm und bedient Tastatur und Maus: der Anwender
selbst. Also klicken Sie nicht gleich auf jeden noch so verlockenden
E-Mail-Anhang, laden sich nicht die zum Betrachten einer Webseite
anscheinend erforderliche Software herunter oder verzichten auf
die Installation des viel gepriesenen Super-Programms aus undurch-
sichtigen Quellen, das nun endlich alle anderen, ähnlich gelagerten
Programme überflüssig machen soll: Dann bleibt Ihnen so manches
Fiasko erspart. Überlegtes Handeln, sich nicht verleiten lassen − das
allein hält schon viele Angreifer auf Distanz!
Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
Bausätze sind zeitgemäß!
Trotz ihres breiten Betätigungsfeldes sind sich die meisten Funkama-
teure sehr ähnlich. Gleich, was sie besonders interessiert: Sie üben
ihr Hobby oft mit Leidenschaft und einem Hang zur Perfektion aus.
Letzteres führt jedoch leicht dazu, den Selbstbau hinten an zu stellen.
Mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten oder die Vermutung,
dass Selbstbau ohne komplett eingerichtete Werkstatt mit großen
Messplätzen gar nicht möglich sei, werden als Gründe angeführt.
Entgegen verbreiteter Erwartungen hat die Zahl der Funkamateure,
die zumindest einen Teil ihrer Ausrüstung wieder selbst bauen, in den
vergangenen Jahren zugenommen. Auf Treffen erweist sich, dass die-
ser Trend sogar weltweit zu beobachten ist. Das spiegelt sich auch
in den Mitgliederzahlen von einschlägigen Arbeitsgemeinschaften
und Klubs wider, die in allen Industrienationen im Gegensatz zu
denen der nationalen Amateurfunkverbände weiter steigen.
Ob kleines Zubehör, einfache Transceiver oder aufwändige Projekte:
Es wird wieder verstärkt selbst gebaut, was sich auch am wachsen-
den Angebot an Amateurfunkbausätzen zeigt. Warum ausgerechnet
Bausätze? Schaut man sich ihre Preise an, so kann es kaum darum
gehen, ein paar Euro gegenüber Fertiggeräten zu sparen. Es geht
eher darum, sich den Spaß am Selbstbau zu gönnen und in der
Praxis mehr über das Hobby zu erfahren. Guten Bausätzen liegt
eine Arbeitsteilung zugrunde; die Entwicklerteams haben die meis-
ten Klippen bereits umschifft und in den oft sehr ausführlichen Bau-
mappen beschrieben. Letztere helfen nicht nur beim Aufbau, sie
vermitteln auch eine gehörige Portion Wissen, was den Spaß am
selbst gebauten Gerät enorm erhöht. Bei seriösen Bausätzen steht
außerdem ein ausgefeilter Support zur Verfügung.
Bleibt als vermeintliches Hindernis für den Selbstbau nur noch die
Ausrüstung der Werkstatt. Hier ist zwischen den Entwicklerteams und
dem Funkamateur zu unterscheiden. Müssen Erstere durch Einsatz
entsprechender Messmittel während der Entwicklung alle möglichen
Eventualitäten ausschließen, darf der Bastler sich darauf verlassen,
dass bei Einhaltung der Vorgaben alles glatt geht. Notwendige Mes-
sungen beschränken sich auf einen Vergleich bestimmter Daten
bei geringen Anforderungen an die Genauigkeit.
Die meisten Funkamateure basteln heute zudem anders, als unsere
Väter es taten. Da es keine Händler mehr gibt, die das komplette Bau-
teilsortiment führen, greifen sie auf komplette Bausätze zurück, statt
mühsam Einzelteile aus der Bastelkiste oder bei mehreren Händlern
zusammenzusuchen. Kaum jemand bringt die Muße auf, sich monate-
lang mit der Beschaffung von Bauteilen zu beschäftigen − selbst Ent-
wicklern außerhalb von Arbeitsgemeinschaften fällt das inzwischen
schwer, weshalb einige gute Ideen nie realisiert wurden.
Lassen Sie sich nicht von Puristen abschrecken, die die Meinung ver-
treten, Basteln mit Bausätzen sei kein echter Selbstbau: Probieren
sie es aus! Vielleicht finden sie im Klub noch den einen oder ande-
ren, der dabei mitmachen möchte. Es ist doppelter Spaß, und Sie
können sich vielleicht einen Jugendtraum damit verwirklichen.
Peter Zenker, DL2FI
Der Weg in die Zukunft
Die drahtlose Übermittlung von Nachrichten hat etwas Geheimnis-
volles. Man sieht „die Wellen“ nicht und trotzdem funktioniert es
überall. Und so ganz genau weiß man selbst heute noch nicht, was
ein elektromagnetisches Feld wirklich ist. Gerade diese Magie ließ
mich 1971 zum Funkamateur werden.
In dieser Zeit wurde der UKW-Bereich erschlossen und die meisten
Funkamateure nutzten Selbstbaugeräte für AM oder FM. Der nicht-
öffentliche bewegliche Landfunk wechselte gerade auf das 25-kHz-
Raster, wodurch Unmengen alter mobiler Funkgeräte frei wurden,
die zum Aufbau des 2-m-Relaisfunknetzes dienten. Als dann 1974
mit einer Sondergenehmigung das Spandau-Relais DB0SP den er-
sten VHF-Linkbetrieb zum Elm-Relais DB0XC aufnahm, fühlte man
sich als Funkamateur wie ein kleiner König, denn vergleichbare
kommerzielle Dienste waren unerreichbar teuer.
Nun, viele Jahre später sieht das völlig anders aus: Funkamateure
werden von jedem jugendlichen Besitzer eines Mobiltelefons nur
müde mit den Worten „Nach Australien kann ich auch telefonieren!“
belächelt. Mit genug Selbstkritik stellt man fest: Der Selbstbau wird
mangels geeigneter Bauteile durch SMD zu einer Herausforderung
für die eigene Löttechnik, das textbasierte Packet-Radio-Netz ist
durch die Übermacht des DSL-Internets uninteressant geworden
und Hardware wird zunehmend durch Software ersetzt. Es ist keine
Frage: Gerade die Letztere löst einen neuen Boom im Amateurfunk
aus. Dafür stehen Betriebsarten wie PSK31, JT65, DRM, EchoLink
− aber auch Ham-Wi-Fi ist im Kommen.
Doch genau hier liegt heute die Faszination! Mit nachrichtentech-
nischen Rechneranwendungen kann man Newcomer sehr viel
leichter für unser Hobby begeistern. Entwicklungen wie SoftRock
haben das Potenzial eines 0-V-1 des 21. Jahrhunderts, wenn man
die Algorithmen für jeden Anwender begreif- und nachvollziehbar
macht. Ganz nebenbei bekommt man dann auch das Verständnis
für die Grundlagen von MP3, DATV, UMTS und weiteren kommer-
ziell genutzten digitalen Techniken. Und nicht Wenige könnten in
einigen Jahren dann wieder sagen, dass ihre berufliche Karriere
einmal mit dem Amateurfunk begann!
Es gibt aber noch ein zweites Standbein, und das ist die Freude an
der Kommunikation selbst. Hier sollten wir vielleicht einmal unser
Selbstverständnis etwas entstauben. Funk und Nachrichten-
übermittlung als Hobby ist nicht auf den Amateurfunk beschränkt!
Dieser Gedanke wird einigen ebenso wenig gefallen, wie der Weg-
fall der CW-Prüfung für den KW-Betrieb. Aber warum können nicht
CB-Funker, PMR-Talker, BC-Listener, Fernsteuer-Freaks, Internet-
Chatter, Podcaster und Funkamateure als Spezialisten in ihren Ge-
bieten, dem Wesen nach alle Kommunikationsamateure, sehr viel
enger zusammenarbeiten und voneinander lernen?
Bei beiden Gedanken habe ich den Eindruck, dass wir seit Jahren
den Weg in die Zukunft unseres Hobbys verschlafen. Stillstand ist
Rückschritt, und daher werden wir über kurz oder lang an beiden
Themen nicht vorbeikommen. Fangen wir doch einfach jetzt damit
an!
Dr. Thomas Schiller, DC7GB
SysOp DB0BLN, Stv.BVV Berlin-Brandenburg im VFDB
DOs auf der Kurzwelle
Was hörten wir vor kurzem aus dem BMWi? Unser 40-m-Band wird
größer, jeder darf auf 6 m, und die Neueinsteiger funken schon bald
auf den Kurzwellenbändern. Zwar nicht auf allen und selbstverständ-
lich nicht mit Kilowatts, was Skeptiker sicherlich nur zum Teil beru-
higen wird. Überraschend, dass man sich offenbar recht schnell für
eine ganze Reihe von Wünschen des Runden Tischs Amateurfunk
geöffnet hat.
Logisch, dass die Änderungen bezüglich des 40- und 6-m-Bandes
begrüßt werden. Und erwartungsgemäß führt die KW-Option bei DOs
zur Entrüstung einiger, die sich auf ihren Standardfrequenzen als
Gralshüter der Kurzwellen-Hochkultur fühlen. Parallelen zu der Zeit,
als für die „C-Lizenzler“ die CW-Hürde für den Zugang zu den Kurz-
wellenbändern wegfiel, sind unüberhörbar.
Es wird sich zeigen, ob ehemalige CB-Funker im 10-m-Band ihren
speziellen Funkbetrieb machen. Immerhin hat das Auftauchen von
DCs & Co. auf Kurzwelle ganz offenbar nicht zum Weltuntergang
geführt. Die Wellen haben sich schnell geglättet und man erkannt
die „Neulinge“ gemeinhin nur an ihren Präfixen; Neubezeugniste
ohne CW-Prüfung lassen sich ohnehin nicht mehr recht ausmachen.
Der Verfall der guten Sitten findet ohne besagte DCs & Co. auch
schon lange dort statt, wo „echte“ Funkamateure aktiv sind − z.B. in
den Pile-Ups großer DXpeditionen, wobei sich insbesondere die
Europäer durch Rücksichtslosigkeit und mangelnde Funkdisziplin
hervortun, oder auf Relais, die man am liebsten abschalten möchte…
Den „Neuen“ sei gesagt, dass freundliche Hinweise eher selten sind,
wenn man auf den Bändern Fehler macht. Denn bevor jemand etwas
sagt, hat sich im Allgemeinen schon allerlei Frust angestaut. Ein Ab-
stimmträger ist dann noch eine vornehme Geste, da wenigstens keine
Schimpfworte fallen. Es empfiehlt sich daher unbedingt, zunächst
eine gewisse Zeit auf den Bändern zuzuhören und sich mit dem KW-
Betriebsdienst vertraut zu machen. Nicht alles Gehörte ist allerdings
nachahmenswert. Bei kritischer Betrachtung lernt man jedoch bald,
die Spreu vom Weizen zu sondern und gute Beispiele von schlechten
zu unterscheiden. Wer dann weiß, wie es geht, dem kann kaum noch
etwas misslingen.
Ob die Erleichterung der Zugangsbedingungen dem Amateurfunk
noch einmal einen wesentlichen Schub geben kann, darf indes be-
zweifelt werden. Zum einem fand der massenhafte Zulauf Ende der
Neunziger statt, als die Klasse 3 geschaffen wurde. Zum anderen
werden die Prüfungen den neuen Möglichkeiten angepasst, also
schwieriger.
Die alten Hasen können übrigens auf ganz besondere Weise Nach-
wuchsarbeit leisten, indem sie den DOs mit Rat und Tat zur Seite
stehen, ob im QSO oder beim OV-Abend. Fühlen Sie sich mit verant-
wortlich dafür, dass eben diese DOs, die den Schritt auf die Kurz-
welle wagen, Amateurfunk so erleben, dass ihre Begeisterung er-
halten bleibt! Schließlich geht es den Funkamateuren im Besonde-
ren wie Deutschland im Allgemeinen − es mangelt an Nachwuchs.
Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
An der Realität vorbei
Am 24. März 2006 war es soweit: die EU-Richtlinie Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (WEEE) wurde in nationales Recht umgesetzt.
Den Herstellern, Händlern und Importeuren in Deutschland über-
trägt man jetzt mit dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz
ElektroG die volle Verantwortung für ihre Produkte − bis hin zum
Recycling. Der Verbraucher muss nun Altgeräte „nur noch“ bei
Sammelstellen der Kommunen abgeben.
Das Ziel dieses Gesetzes ist gut und nicht zu kritisieren. Und so
wird es auch in fast allen Medien gepriesen. Offensichtlich scheint
aber die damit verbundene Bürokratie nicht aufgefallen zu sein,
denn das Gesetz gilt ebenso für Kleinschrott wie elektrische Zahn-
bürsten oder Energiesparlampen. Diese muss der Verbraucher
selbst zu den Sammelpunkten bringen. Es ist zu bezweifeln, dass
sich ein Großteil der Bevölkerung daran hält.
Die größeren Probleme werden aber kleine und mittelständische
Unternehmen mit einem geringen Schrottaufkommen haben. Sie
müssen sich gegen eine Gebühr bei der Stiftung Elektro-Altgeräte
Register (EAR) registrieren lassen und dann im festgelegten Zeit-
raster die in Umlauf gebrachten Produktmengen zurückmelden.
Entsprechend der je Produktgruppe festgelegten Rücklaufquote
erhält der Hersteller irgendwann den Auftrag, einen ihm zugewie-
senen Container mit Elektronikschrott irgendwo in unserem Land
innerhalb weniger Tage abzuholen und fachgerecht entsorgen
zu lassen. Dafür sind je Tonne etwa 250€ fällig − die zusätzlichen
jährlichen Registrierungskosten liegen beim Vierfachen, egal wie viel
einstmals in Umlauf gebracht wurde.
Für einen großen Hersteller mit 100 t und mehr Produktionsvolumen
ist das sicher kein Problem. Doch manch Kleiner erzeugt jährlich nur
wenige Kilogramm oder importiert nur wenige Geräte. Eine Regis-
trierung ist jedoch auch dafür Pflicht. Die immer wieder genannte
Preiserhöhung von etwa 2 bis 3 % dürfte damit bei einigen Produkten
nicht haltbar sein. Eine quantitätsabhängige Registrierungsgebühr
hat der Gesetzgeber bisher ausgeschlossen.
Zudem kann es sein, dass diese in Umlauf gebrachten Mengen
gegenüber der EAR durch einen unabhängigen, zusätzlich zu be-
zahlenden Wirtschaftsprüfer bewiesen werden müssen. Obendrein
hat jedes EU-Mitglied auf der Basis dieser Richtlinie eigene Gesetze
geschaffen, sodass in jedem Land separate Registrierungen von
teilweise nur dort ansässigen Firmen erforderlich sind. Ein einfacher
Warenaustausch innerhalb der EU ist für kleine Firmen somit finan-
ziell nicht mehr möglich.
Bleibt das Gesetz in der bisherigen Form bestehen, wird es vor allem
Verbrauchergruppen treffen, die nicht dem üblichen Massenmarkt
entsprechen. Und dazu gehören auch Funkamateure und Hobby-
elektroniker. Es gibt jedoch Lösungen, die im Interesse der Ver-
braucher, kleiner Hersteller und der Umwelt sind. Die Kosten wären
fair. Fordern wir also, dass die Politik die Probleme zur Kenntnis
nimmt und schnell reagiert – ohne vorherige Gerichtsurteile, die
diesmal auf EU-Ebene angesiedelt wären.
Dr.-Ing. Klaus Sander
Technik auch mal zum Anfassen
Die CeBIT als weltgrößte Messe der Informationstechnik ist eine
Institution im Wandel. Anfang März präsentierten eine Woche lang
6262 Firmen aus 71 Ländern auf 310 000 m² Ausstellungsfläche
neue Produkte, Lösungen und Ideen. Die rund 450 000 Besucher,
so das Ergebnis einer Umfrage der Messeleitung, kamen vor allem
aus drei Gründen nach Hannover: Sie wollten ihr Wissen erweitern,
Informationen austauschen − und die Exponate aus eigener An-
schauung kennen lernen. Dies ist ein Gegenpol zu den immer auf-
wändigeren, virtuellen Darstellungen neuer Produkte im Internet. Ein
3D-Bild mag mehr sagen, als viele Worte, aber selbst ausprobieren
und im Wortsinn begreifen lässt sich offenbar durch nichts ersetzen.
Dazu hatten CeBIT-Besucher in diesem Jahr reichlich Gelegenheit.
Auch in der am Rand des Messegeländes gelegenen Halle 27 mit
einer Sonderschau unter dem Motto Digital Living. Dort waren etwa
die neuesten Mobiltelefone, Musik- und Heimkinoanlagen nicht wie
üblich in Glasvitrinen und Schaukästen eingesperrt, sondern standen
offen zugänglich und unter nahezu realen Bedingungen bereit zum
Ausprobieren. Realitätsnah deshalb, weil dort die Einzelkomponen-
ten etwa einer ausgestellten Heimkinoanlage nicht wie sonst auf
Messen üblich alle vom gleichen, sondern wie im wirklichen Leben
von verschiedenen Herstellern stammten und so ihr reibungsloses
Zusammenspiel beweisen mussten.
Umgehend meldeten sich Kritiker zu Wort und argumentierten, die
CeBIT sei doch eine Fach- und keine Endverbrauchermesse. Dabei
schließt das eine das andere nicht aus. Denn sogar Fachhändler
sind letztlich Endverbraucher und sollten aus eigener Erfahrung
wissen, wie sich die neue Unterhaltungselektronik bedienen lässt,
was sie in der Praxis leistet oder vielleicht auch nicht kann. Dank der
voranschreitenden Verschmelzung digitaler Technologien, die sich
heute primär in ihren Anwendungen für Beruf oder Freizeit unter-
scheiden, macht eine strikte Trennung beider Bereiche längst keinen
Sinn mehr. Der Vergleich von Halle 27 mit der vor acht Jahren ge-
scheiterten CeBIT home, damals eine Art Exil für Unterhaltungs-
elektronik, wäre daher heute verfehlt. Die Branche tut vielmehr gut
daran, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, ihre neuesten
Entwicklungen praxisnah zu erklären − zumal moderne Technik zu-
nehmend an Unbedienbarkeit krankt.
Mit immer neuen Empfangswegen für digitales Fernsehen und
Radio sowie Multimedia steigt in den Fachgeschäften der
Erklärungsbedarf, denn trotz aller Vorzüge hat die Digitaltechnik
im Wohnzimmer ihre Tücken. Zeigt der schicke Flachfernseher
auch hochauflösendes Fernsehen (HDTV) und hat er die richtigen
Schnittstellen zum Anschluss neuer HD-Recorder, sei es Blu-ray
oder HD-DVD? Empfängt Satellitenreceiver XYZ künftig verschlüs-
selte Programme?
Die anstehende Einführung von Internet- und Handy-TV stellt weitere
Anforderungen an die Mittler neuer Technologien. Auch deshalb ist
Digital Living ab 2007 integraler Bestandteil der CeBIT. Gut so.
Harald Kuhl, DL1ABJ
Von Burgen, Bergen und Leuchttürmen
Dem aufmerksamen Leser dürfte nicht entgehen, dass sich im
QTC-Teil dieser Ausgabe wiederum eine neue Rubrik etabliert −
das Leuchtturm-QTC. Was soll das denn nun wieder, könnten
einige wohl meinen. Gibt es nicht schon genügend QTC-Themen?
Ja, da gäbe es schon noch einige weitere Aktivitäten, die man
trefflich thematisieren könnte. Aber keine Bange, ein spezielles
EME-QTC dürfte es wohl auch in Zukunft nicht geben.
Es ist doch nicht zu bestreiten, dass viele der aktiven Funkama-
teure auch Stationen hinterherjagen, die nicht nur ein neues DXCC-
Gebiet (s. Editorial 11/05) für ihre Sammlung bieten. Da balgen
sich, vor allem in den Sommermonaten, die IOTA-Inseljäger auf den
einschlägigen Frequenzen um alles, was eine Nummer zu vergeben
hat. Neben dem IOTA-Programm existieren inzwischen weltweit
diverse weitere attraktive Insel-Sammelangebote. Nicht zu über-
hören sind auch Stationen, die Bergpunkte (SOTA) vergeben oder
von Burgen und Schlössern funken. Unbestritten leisten derartige
Aktivitäten ihren Beitrag zur spürbaren Belebung der Amateurfunk-
frequenzen und bessern oft genug das Image unseres Hobbys für
den jugendlichen Nachwuchs auf. Und das ist sehr wichtig!
Das Leuchtturm-QTC will sich daher in loser Folge mit den Funk-
aktivitäten von Leuchttürmen, selbst aus entlegensten Gegenden,
befassen. Unabdingbar erscheint dabei die Anbindung an das
WLOTA-Diplom. Das u.a. auf Initiative von F5SKJ und F5OGG
vor etwa zehn Jahren entstandene World Lighthouse On The Air
ist nicht nur ein einziges Diplom, sondern ein ganzes Programm.
Es soll etablierte Diplome wie DXCC, IOTA, WPX, WAZ usw. er-
gänzen. Am Anfang standen die Väter des WLOTA einer Liste von
mehr als 15 000 Leuchttürmen rund um die Erde gegenüber. Eine
Ausschreibung mit einer solch umfangreichen Liste als Grundlage
war jedoch nicht praktikabel. So entschied man sich, eine begrenzte
Anzahl von Leuchttürmen, die noch aktiv sowie für die Welt der
Marine repräsentativ sind, in die Wertung aufzunehmen.
Im Laufe der vergangenen Jahre stieg die Popularität des Funkens
von Leuchttürmen stetig − inzwischen existieren Dutzende weitere
internationale Leuchtturm-Diplome, und man veranstaltet ein Deut-
sches Insel- und Leuchtturmwochenende (dieses Jahr am 7. und
8. Mai) sowie ein internationales Leuchtturmwochenende (ILLW am
26. und 27. August).
Langer Argumentation, kurzer Sinn: Für ein Gespräch unter Be-
kannten machen die neuen Medien dem Amateurfunk zunehmend
Konkurrenz. Sammeln und Jagen im stets etwas unberechenbaren
Medium Funk bieten dagegen einen Touch von Abenteuer. Insbe-
sondere, wenn man selbst Berge, Leuchttürme oder vielleicht auch
Burgen aktiviert. Und wer sich dazu noch für die Hintergründe
interessiert, lernt Einiges dazu…
Beim Sammeln und Jagen (Conteste eingeschlossen) werden wir
sicher die Klön-QSOs nicht ganz aus den Augen verlieren − jeder
nach Gusto. Und das eine schließt ja das andere nicht aus.
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Amateurfunk wird nie langweilig
Bereits seit fast fünfzig Jahren fasziniert mich der Amateurfunk.
Mit Achtzehn konnte ich damals zufällig bei jemandem aus unserem
Ort Travemünde eine Telegrafie-Funkverbindung mit einem Funk-
amateur aus Amerika verfolgen. Das war für mich vor allem deshalb
faszinierend, weil man so kurz nach dem Krieg weder ins Ausland
reisen noch einfach telefonieren konnte. Wir lernten zwar Englisch,
hatten aber keine Chance, es anzuwenden. Via Amateurfunk hin-
gegen gelang es offenbar, sich mit gleich Gesinnten aus aller Welt
zu unterhalten!
Der Amateur zeigte mir seine Funkstation, die er aus alten Teilen
angefertigt hatte, denn seinerzeit war Elektronikmaterial kaum
käuflich zu erwerben. So bestand der einzige Weg darin, alte Geräte,
Radios und militärischen Schrott zu zerlegen und mit den Röhren
sowie anderen Spezialteilen daraus Sender bzw. Empfänger zu-
sammenzubauen.
Mein Klassenkamerad Hartwin Weiss und ich machten sich daran,
Funkamateure zu werden. Einen Lehrgang gab es nicht, aber ein
Buch „Radiobasteln für Jungen“ von Ing. Heinz Richter. Nach einem
Beispiel darin entstand aus einem alten Radio ein Einkreiser mit zwei
Röhren. Und tatsächlich: Wir konnten die Morsezeichen empfangen,
aber nicht verstehen. Also hieß es, Morsen zu lernen. Ein einfacher
Tongeber mit akustischer Rückkopplung, gebaut aus dem Hörer und
dem Mikrofon eines Telefons, diente dem Üben während der drei-
ßigminütigen Zugfahrten zur Schule. Einer gab die Zeichen, der
andere musste sagen, was er aufgenommen hatte. Nach kurzer Zeit
beherrschten wir so das Alphabet und konnten bald auch die Sendun-
gen der Funkamateure mitschreiben.
Klar, dass nun die Teilnahme am internationalen Funkverkehr lockte,
und bald stand die Prüfung an. Diese lief damals mündlich ab, frei-
lich zusammen mit einem Telegrafietest. Zu beantworten waren
überwiegend praktische Fragen zur Technik, z. B. wie ein Einkreiser
funktioniert, wie man eine Drosselspule wickelt, was ein Meißner-
Oszillator ist, wie lang eine Dipolantenne sein muss usw. In der
Woche nach der Prüfung entstand ein Sender mit 5 W Ausgangs-
leistung, und als nach einer Woche die Lizenz kam, funkten wir auf
80 m in CW unter DJ4UF und DJ4UG.
Heute ist vieles anders. Einsatzbereite, mikroprozessorgesteuerte
Geräte gibt es zu kaufen, selbst fertig konfektionierte Antennen sind
auf dem Markt. Damals steckte SSB noch in den Kinderschuhen und
Sprechfunk in AM war nicht sehr effektiv. Deshalb beherrschte der
Funkverkehr in Telegrafie die Szene. Heute können Technikinteres-
sierte ihre Geräte erweitern, Antennen selbst bauen, neue digitale
Betriebsarten mit Hilfe des Computers erschließen oder einfach nur
mit anderen Leuten sprechen. Da kommt keine Langeweile auf und
das Hobby bleibt interessant.
Der FUNKAMATEUR bietet, mit dieser Ausgabe beginnend, noch
nicht lizenzierten Interessenten einen Lehrgang an. Teilnehmer
könnten in etwa einem halben Jahr die Voraussetzungen für die
Prüfung zum Amateurfunkzeugnis der Einsteigerklasse erreichen.
Steigen Sie ein, machen Sie mit!
Eckart K. W. Moltrecht, DJ4UF
Neues aus Berlin
Diese Ausgabe des FUNKAMATEUR ist eine besondere, denn wir
begrüßen einige Tausend frühere Leser der funk, die sich hoffent-
lich schnell und gut mit uns anfreunden werden. Damit die „Neu-
en“ ihre Meinung kundtun können, haben wir vorübergehend
ein spezielles elektroniches Postfach eingerichtet. Bitte nutzen
Sie die E-Mail-Adresse funk@funkamateur.de, um uns mitzuteilen,
was wir Ihrer Meinung nach besser machen können. Auch wenn
sich nicht jede Mail beantworten lässt, wir lesen und beachten alle!
Etwas Besonderes ist bei diesem Heft auch die Jahrgangs-CD und
das gleich in mehrerlei Hinsicht. Zum einen bekommen alle, die ihr
Abonnement rechtzeitig auf ein Plus-Abo umgestellt haben, mit
dieser Ausgabe ihre Jahrgangs-CD 2005 frei Haus geliefert. Zum
anderen werden Sie als langjähriger FA-CD-Nutzer eine Neuerung
bemerken, wenn Sie die CD in das Laufwerk Ihres Computers ein-
legen. Sie hat − endlich − eine Browser-Benutzeroberfläche, mit
der man besser navigieren kann. Dass die Volltextsuche auch auf
MacOS- und Linux-Systemen funktioniert, sei nur am Rande an-
gemerkt und ist in erster Linie auf Fortschritte bei Adobe zurück-
zuführen.
Augenfällig, leider aber einmalig, dürfte auch sein, dass wir den
Jahrgang 2005 der funk mit auf die CD-ROM gebrannt haben.
Unsere alten und die neuen, von der funk hinzugekommenen Leser
können sich über diesen Mehrwert freuen.
Veränderungen bieten wir auch auf unserer Website. So wird es
den Abonnenten gefallen, dass sie − ab Januar 2006 − jeden Monat
eine private Kleinanzeige kostenlos veröffentlichen können. Sie darf
bis zu 200 Zeichen lang sein und muss online aufgegeben werden.
Dabei ist vorgesehen, dass man bis zum Anzeigenschluss noch
Veränderungen vornehmen kann – etwa wenn zwischenzeitlich
etwas schon anderweitig verkauft worden ist. Abonnenten loggen
sich dazu wie auf www.funkboerse.de mit Postleitzahl und Abo-
nummer ein.
Eine weitere Veränderung betrifft den Online-Shop, der in den
nächsten Tagen ein Update erhält. Für Sie soll damit insbesondere
der Komfort besser werden. Man wird künftig nicht mehr bei jedem
Einkauf seine persönlichen Daten neu eingeben müssen, sondern
es soll genügen, sich mit einem Passwort einzuloggen. Außerdem
wollen wir bei dieser Gelegenheit die Systematik der Warengruppen
verbessern, die Verfügbarkeit im Online-Shop an die im Warenwirt-
schaftssystem gespeicherten Bestände koppeln und, wo möglich,
auf logische Bestellnummern umstellen. Ein NE614 hat künftig nicht
mehr die Bestell-Nr. 6304, sondern heißt einfach „NE614“.
In diesem Sinne alles Gute für Sie im Jahr 2006!
Ihr
Knut Theurich, DGØZB
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Volle Kraft voraus!
Im Zuge einer Vereinbarung zwischen dem Verlag für Technik und
Handwerk, Baden-Baden, und der in Berlin ansässigen Box 73
Amateurfunkservice GmbH „…wird das Magazin funk ab Januar 2006
in den FUNKAMATEUR integriert und erscheint mit der Ausgabe
12/2005 letztmalig als eigenständige Publikation“. Soweit die Kern-
aussage der offiziellen Pressemeldung. Was heißt das im Klartext?
Es bedeutet, dass rund zehn Jahre nach der beam eine weitere
Amateurfunkzeitschrift vom Markt verschwindet. Diese Entwicklung
empfinden wir als bedauerlich, zumal die funk eine von der unsrigen
merklich abweichende Ausrichtung aufwies. So hatte sie ihren
Leserkreis, und nicht wenige funk-Leser kauften sich zusätzlich den
FUNKAMATEUR. Schade also, dass diese Wahlmöglichkeit nun
wirtschaftlichen Erfordernissen zum Opfer gefallen ist.
Für uns ist das freilich die Bestätigung, dass unser seit nunmehr
55 Jahren praktiziertes Konzept bei der Mehrheit der Leser nach wie
vor Anklang findet: Informationen rund um Amateurfunk und Elek-
tronik bieten und dabei fachlich anspruchsvolle Beiträge mit leichter
Kost paaren. Die unverkennbare Vielfalt unseres Magazins resultiert
auch daraus, dass Leser für Leser schreiben − eine Prämisse, die
schon auf unseren damaligen langjährigen Chefredakteur Karl-Heinz
Schubert zurückgeht.
An dieser Stelle möchte ich im Namen von Redaktion und Verlags-
leitung denjenigen, die sich als Autoren betätigten und mit kurzen
oder langen, einmaligen oder regelmäßigen Beiträgen das Fort-
bestehen dieser Fachzeitschrift möglich gemacht haben, herzlich
danken. Gleiches gilt freilich ebenso für Sie, liebe Leser, die Sie uns −
teilweise schon seit Jahrzehnten − die Treue halten.
Viel Zeit zum Resümieren bleibt indes nicht, denn im Ergebnis dieser
„Konzentration auf die Kernkompetenzen“, wie es im Verlautbarungs-
deutsch heißt, werden wir Ihnen ab der Januar-Ausgabe 2006
allmonatlich bei stabilem Heftpreis 16 Seiten mehr offerieren. Das
Potenzial der nun hinzukommenden funk-Autoren versetzt uns in die
Lage, Themenbereiche, wie fachbezogene Software, BC-DX und
Monitoring sowie Jedermann- und CB-Funk noch kompetenter bzw.
umfassender abzuhandeln. Ziel ist es ferner, auf den zusätzlich zur
Verfügung stehenden Seiten mehr einfache Bauanleitungen für Funk-
technik, Elektronik und Amateurfunk zu bieten.
FUNKAMATEUR-Leser werden künftig auf nichts zu verzichten brau-
chen, sondern in Gegenteil davon profitieren, dass wir zusätzlich
bislang vorrangig in der funk abgehandelte Themen integrieren.
Andererseits sind wir sicher, auf diese Weise auch den bisherigen
funk-Lesern einen Mehrwert zu bieten − und das sogar bei einem
günstigeren Preis.
Für uns als Redaktion der einzigen noch am Kiosk erhältlichen Zeit-
schrift für Funkelektronik im weitesten Sinne wächst die Verant-
wortung, insbesondere gegenüber Newcomern aller Altersklassen.
Dessen sind wir uns bewusst!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Sammler und Jäger
Immer, wenn ein besonders seltenes DXCC-Gebiet aktiviert wird,
herrscht auf Teilen der Amateurfunkbänder eine Art Ausnahme-
zustand. So auch während der Aktivität von K7C, dem DX-Ereignis
des Herbstes 2005. Kure Island, Ziel der Cordell-Expedition 2005,
um die 2000 km westlich von Hawaii, zählte bislang zu den meist
gesuchten DXCC-Gebieten der Welt. Für Europäer so rar wie Nord-
korea, die antarktische Peter-I.-Insel oder Scarbourough Riff im
Chinesischen Meer.
Was reizt uns daran, ins Log zu kommen und dafür stundenlang im
Pile-Up mit zu rufen? Es sind nicht nur sportlicher Ehrgeiz und Sam-
melleidenschaft, der den DXer Stunden am Gerät verbringen lässt.
Ein solches Ereignis ist eine gute Gelegenheit, die Kenntnisse über
die KW-Ausbreitung in der Praxis zu überprüfen und zu vertiefen,
vielleicht verschiedene KW-Ausbreitungssoftware einem Praxistest
zu unterziehen. Wie funktioniert der Signalweg über den Nordpol?
Arbeitet die Antenne optimal? Das Herumrudern im Pile-Up gibt es
gratis dazu. Dafür standen auf der anderen Seite zwölf Operatoren
oft rund um die Uhr zur Verfügung. Wann wird einem schon über
zehn Tage ein Signal für derartige Studien geboten?
Die Webseite der DXpedition stellte per Satellit eine recht sichere
Rückverbindung zur Außenwelt dar. Über „DXA“ ließ sich der Funk-
betrieb im Internet verfolgen, was Zehntausende nutzten. Die Website
bot fast simultan eine Rückmeldung. Sie zeigte, auf welchem Band
und in welcher Sendeart K7C gerade funkte, sowie die in den vergan-
genen 5 min gearbeiteten Stationen als Liste und auf einer Weltkarte.
Schließlich konnte jeder Funkamateur weltweit sehr zeitnah eine
Übersicht über die von ihm gearbeiteten Band- und Sendeartenpunkte
erhalten.
Ziemlich krass das Ganze: YL/OM plagt sich stundenlang gestresst
über die unzuverlässige Ionosphäre ab, um irgendwie auf Kure wahr-
genommen zu werden, wo es doch umgekehrt ganz easy über Inter-
net zurückgeht! So sind sie halt, die verrückten Funkamateure −
Motivation siehe oben…
Auch für mich war Kure bis dato noch ein weißer Fleck auf der Ama-
teurfunkweltkarte. K7C könnte mir das 320. DXCC-Gebiet in CW
bescheren. Ich versuchte, keine Gelegenheit dafür auszulassen.
Ungeachtet der solche DXpeditionen immer wieder begleitenden
Phänomene: Anrufer auf der Arbeitsfrequenz der DX-Station, Band-
polizisten, die diese Kanaillen unnötig lange und vielstimmig zur
Ordnung rufen. Und schlimmer noch die mutwilligen Störer.
Auch wenn die DXpedition nicht ihr erklärtes Ziel von 80 000 QSOs
mit 35 000 verschiedenen Rufzeichen erfüllt und nur 17 % der Verbin-
dungen mit Europa gefahren hat − vielen von uns bescherte sie ein
neues DXCC-Gebiet. Auch mir ist das ersehnte CW-QSO auf 30 m
geglückt. Meine verständnisvolle Frau hat sich darüber vielleicht noch
mehr gefreut als ich. Auf den Bändern und an der heimischen Station
ist wieder ein wenig mehr Ruhe eingezogen − bis zur nächsten großen
DXpedition. Per Amateurfunk schwierig ins Pazifikzentrum, per Internet
bequem zurück, es bleibt doch halt ein Kitzel, den die Handy-Telefonie
nicht bieten kann!
Enrico (Ric) Stumpf-Siering, DL2VFR
Wenn nichts mehr funktioniert
Kommunikation stellt einen Lebensnerv unserer Gesellschaft dar. Ohne
sie sind heutzutage nur noch sehr wenige Lebensbereiche funktions-
fähig.Das sollten besonders wir Funkamateure wissen, dreht sich doch
quasi unser ganzes Hobby darum. Besonders Mobiltelefone bieten
Möglichkeiten, von denen die Entwickler bei ihren drahtgebundenen
Urvarianten nicht einmal zu träumen wagten. Doch was geschieht,
wenn in lebensbedrohlichen Situationen aufgrund überlasteter Netze
oder funktionsunfähiger technischer Einrichtungen kein Kontakt zu
einer Funkzelle mehr möglich ist bzw. deren drahtgebundene Ver-
bindung zum Festnetz abreißt?
Hier können wir Funkamateure helfen. Zwar existieren hier und da
Pläne für den Ernstfall, doch in Deutschland gibt es, z. B. im Gegen-
satz zu den USA, keine größeren Bemühungen für sinnvollen,
koordinierten und ordentlich eingebundenen Notfunkbetrieb. Aber
selbst Amateurfunk-Gruppenlösungen mit Überleitungsoptionen in
öffentliche Netze würden eine Argumentationshilfe für den Sinn des
Amateurfunks bieten.
Zwar können wir auf ein landesweites Relaisfunkstellennetz zurück-
greifen. Pech nur, wenn auch die uns Funkamateuren zur Verfügung
stehenden technischen Mittel in Mitleidenschaft gezogen sind:
Sei es, dass das Repeaternetz mangels zerstörter Antennen bzw.
zusammengebrochenen Energienetzes ausgefallen oder die Diesel-
versorgung des für diesen Fall gestarteten Aggregats nicht mehr
gewährleistet ist. Dann hilft auch die beste Technik nicht weiter und
wir müssen das Mikrofon mit einem bedauernden Schulterzucken
aus der Hand legen. Müssen wir das wirklich?
Sehen Sie sich doch einmal in Ihrem Shack um. Lässt sich mit der
vorhandenen Technik aus dem Stegreif ein Notbetrieb über längere
Zeit realisieren, ohne dabei auf das Energienetz oder die nächste
Tankstelle angewiesen zu sein? Oft sind noch Akkumulatoren vom
Fieldday vorhanden, doch ist damit in den meisten Fällen aufgrund
der eher stromfressenden Hightech-Transceiver über längere Zeit
ohne Nachladen keine Versorgung möglich. Wie wäre es da mit
einfachen Geräten, die mit wenig Energie auskommen?
Und wie sieht es mit den Antennen aus? Ohne ausgewachsene
Exemplare werfen viele Hilfswillige schon vorher das Handtuch. Oft
tun es aber auch einfache Bauformen. Als positiver Nebeneffekt
sind für die dann erforderliche Technik auch nicht mehr drei Koffer
voll Equipment nötig. Außerdem werden Nicht-Funkamateure er-
staunt sein, mit welch geringen Mitteln man kommunizieren und die
verwendeten Geräte dank Solarpanel, Windrad oder Dynamo mit
Energie versorgen kann.
Frei nach dem Motto „Tue Gutes und berichte darüber“ sollten solche
Aktivitäten publiziert werden. Vielleicht können wir auf diesem Weg
das Ansehen von uns Funkamateuren in der Gesellschaft verbessern:
Weg von denen, die angeblich immer die Störungen im Fernsehgerät
des Nachbarn verursachen, und hin zu denen, die auch dann noch
Informationen übermitteln können, wenn ansonsten nichts mehr geht.
Ingo Meyer, DK3RED
Bildung tut Not
„Kaufen Sie bei uns ohne Mehrwertsteuer ein und sparen Sie auf diese Weise
16 %!“ So oder ähnlich tönte in diesem Sommer die Werbung. Warum ging
kein Aufschrei durch das Land ob dieses rechnerischen Fauxpas?
Möglicherweise hatte der Werbetexter gedacht, dass es wohl keiner merkt,
oder schlimmer − dass es kaum jemand zu vermitteln wäre, dass sich beim
rückwärts Herausrechnen von 16 % Mehrwertsteuer eben nur 13,8 % ergeben.
Einsteins viel zitierter, zur Eröffnung der IFA 1930 geäußerter Satz „Schämen
sollten sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft
und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh
von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst.“ (s. Editorial 4/03)
ist im Einstein- und IFA-Jahr 2005 aktueller denn je!
Oder der Reklamefachmann hat es selbst nicht besser gewusst − vielleicht
hat er ja erst vor nicht allzu langer Zeit eines unserer bundesdeutschen
Bildungssysteme absolviert. Wo Hochschulprofessoren nicht nur dramatisch
zurückgehende Studentenzahlen in technischen Fachrichtungen beklagen,
sondern auch, dass Studienanfänger eklatante Schwächen schon bei der
Prozent- sowie Bruchrechnung zeigen, wundert eigentlich gar nichts mehr.
Da ist es noch weit weniger erstaunlich, dass Industrie und Berufsschulen
für anspruchsvolle Lehrstellen keine geeigneten Bewerber mehr finden.
PISA hat ja wieder einmal bescheinigt: Deutschlands Kinder sind − in der
Gesamtheit gesehen − im Vergleich zu anderen Industrieländern zu schlecht
ausgebildet. Da hilft es nicht viel weiter, Argumente wie regionale Struktur-
schwäche oder, in Großstädten wie Berlin, mangelnde Integration von Aus-
länderkindern vorzuschieben.
Wenn die Bundesrepublik reihenweise Migranten ins Land holt(e), weil es
bei uns an Kindern mangelt, damit jemand später unsere Renten aufbringt,
müsste doch auch etwas dafür getan werden, Ausländerkinder zum eigen-
ständigen Broterwerb zu befähigen, anstatt sie zu Dauer-Sozialfällen ab-
gleiten zu lassen. Dass Kinder aus anderen Ländern sogar ausgesprochen
gut lernen können, hat ja PISA eben gerade gezeigt.
Und wenn uns einige Länder Asiens − da meine ich nicht nur Japan − tech-
nologisch längst überholt haben, dürfte dies zweifelsohne das Resultat eines
adäquaten Bildungssystems sein!
Gravierende Unterschiede tun sich auch innerhalb unseres Landes auf.
Föderalismus mag allerlei Vorteile haben, aber mehr als ein halbes Jahrhun-
dert davon hat gezeigt, dass beispielsweise Vielfalt von Bildungskonzepten
nicht zu optimalen Lösungen führte, sondern eher zu Kleinstaaterei mit
neuerdings sogar verschiedenen Schreibweisen! Und das in einem Land,
wo es immer weniger Arbeitsplätze gibt und Mobilität der Eltern mehr denn
je gefragt ist. Auch sonst wurden oft Wirrwarr, Unübersichtlichkeit, Selbst-
blockaden durch den Föderalismus bedingt oder zumindest gefördert. Sicher
einer schnellen wirtschaftlichen Entwicklung nicht förderlich.
In Teilbereichen unserer Bildungskonzepte gibt es bestimmt vieles, was
Bestand haben sollte. Was also läge näher, als das Positive aus jedem
Bundesland vorurteilsfrei in ein kongruentes Bildungssystem einfließen zu
lassen? Dazu bedürfte es freilich eines weitsichtigen Konzepts, denn durch-
greifende Wirkungen würden sich erst in 10 bis 15 Jahren abzeichnen.
Zu dessen Durchsetzung müssten Politiker allerdings parteiübergreifend
über eine Legislaturperiode hinausdenken.
Bis dahin bleibt uns nur, die Kinder unseres Umfeldes für physikalisch-
technische Zusammenhänge zu interessieren. Wenn das klappt, wird es
ihnen Spaß machen, zu erkunden, wie dieses oder jenes funktioniert, wie
ein Handy arbeitet oder warum auf einen MP3-Stick mehr Musik passt
als auf eine CD-ROM. Dazu haben wir Funkamateure und Elektroniker
schließlich gute Voraussetzungen.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
UKW-Fans feiern in Weinheim
Kaum ist der erklärte Jahreshöhepunkt der Funkamateur-Gemeinde
vorüber − die 30. Ham Radio in Friedrichshafen, allerorten bei etwa
18 000 Besuchern und 222 Ausstellern als großer Erfolg bewertet, da
steht schon das nächste Jubiläum der Funkamateure bevor − das
Weinheimer UKW-Treffen. Zwar wird es nun das zweite Jahr in Bens-
heim ausgetragen − das Treffen an sich aber jährt sich zum 50. Mal!
Welch eine lange Tradition und gleichzeitig Verpflichtung gegenüber
den UKW-Enthusiasten, die seit Jahrzehnten aus ganz Europa gern
den Weg ins Hessische fanden. Überhaupt keine Frage, ein Besuch
lohnt auf jeden Fall, zumal jetzt Kompetenzrangeleien der Vergangen-
heit angehören und die über viele Jahre bewährten Veranstalter un-
gestört ihre Vorbereitungen treffen können.
Vom 10. bis 11. September 2005 gibt es in der Karl-Kübel-Schule
in Bensheim ein umfangreiches Rahmenprogramm mit vielen inte-
ressanten Vorträgen und Aktivitäten, die nahezu alle Facetten des
Amateurfunks berücksichtigen, sowie eine Geräte- und Bauteilemesse,
auf der etliche namhafte Hersteller und Firmen vertreten sein werden.
Natürlich gehört auch ein großer Flohmarkt zur Veranstaltung.
Am Sonntag, dem 11. 9., feiert man im Klubheim von DL0WH in Wein-
heim das Jubiläum weiter. Dort kann man technische Vorführungen
verfolgen, eine HF-Bauteile-Börse beschnuppern und den Start
eines Wetterballons miterleben. Diskussionsrunden z. B. zu Themen
wie Meteor- oder Regenscatter sind dabei genauso obligatorisch wie
Expertenrunden zum Selbstbau bis in den SHF-Bereich.
Die persönlichen Begegnungen sind immer wieder das Salz in der
Suppe. Unvergesslich bleiben mir die „Zelt-Klön-QSOs“ mit den
Teammitgliedern von GM4ZUK oder die schier nie enden wollenden
gemütlichen Runden am Klubheim-„Baumstamm“-Feuer, wobei
nach Verkostung der lokalen Rebsorten manche Themen ziemlich
ungezwungen zur Sprache kamen…
Die Weinheimer UKW-Tagung lebt nicht nur von einer langen Tradition;
sie bietet auch jedes Mal Innovatives. Davon kann sich der Besucher
sicher auch in diesem Jahr überzeugen.
UKW-Funk lebt, selbst wenn es manchmal nicht den Anschein hat.
Seit geraumer Zeit geben JT44, JT65 & Co. neue Impulse. Neben
Sporadic-E-Ausbreitung, die in diesem Jahr wahrlich nicht mit spek-
takulären Bandöffnungen geizt, kann man ständig im Bereich ein-
schlägiger VHF-Frequenzen mit aufregenden Aktivitäten rechnen.
Und wer mit seiner 6- oder 2-m-Antenne bei seinen Nachbarn in-
zwischen zu auffällig wurde, kann eventuell auf die höherfrequenten
Bänder wechseln – bis hin zu den Millimeterwellen. Der ausführliche
Beitrag auf S. 802 über einen erschwinglichen 23-cm-Transverter-
Bausatz von DB6NT dürfte dafür einen prima Einstieg bieten.
Wer dort erst einmal Blut geleckt hat, wagt sich bestimmt
noch höher hinaus…
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Genug Ideen für unser Hobby
Bei der Leserumfrage in Heft 3/2005 baten wir Sie auch darum, uns Ideen
für Selbstbauprojekte zu übermitteln. Unser Leserservice, den wir gerade
personell stärken, soll künftig jedes Jahr ein paar Projekte bis zu verkaufs-
fähigen Bausätzen entwickeln. Das liegt nicht nur im Trend zum Selbstbau,
sondern erspart Ihnen auch den Beschaffungsstress.
Dabei haben Firmen wie Elecraft und LDG in den letzten Jahren ein be-
achtliches Niveau erreicht, an dem sich hiesige Bausatzanbieter messen
lassen müssen. Solche Qualität ist natürlich nur bei entsprechenden
Stückzahlen zu akzeptablen Preisen erreichbar.
Inzwischen sind wir so weit, dass sich der FUNKAMATEUR mit QRPproject
abstimmt, um Doppelentwicklungen zu vermeiden. So steht ein Dipmeter
auf Ihrer Wunschliste ganz weit oben. Daran arbeitet bereits Peter Solf,
DK1HE, und die Bauanleitung wird bei uns erscheinen, sobald seine Ent-
wicklung veröffentlichungsreif ist.
Den immer wieder gewünschten Netzwerktester passt zurzeit Bernd Kern-
baum, DK3WX, an die veränderte Bauelementesituation an. Wir stehen mit
ihm in Kontakt und sind voller Hoffnung, demnächst einen erschwinglichen
Bausatz anbieten zu können.
Gleich mehrere Vorschläge zielten auf einen guten DRM-Empfänger −
ein Projekt, das auch bei uns Priorität hat. In Vorbereitung ist eine Variante
Empfänger mit Ringmischer und geregelter, schmalbandiger 21,4-MHz-
ZF, die auf 12 kHz umgesetzt wird. Dazu kommt ein DDS-Oszillator-Board,
das sich u. a. über USB steuern lässt.
Weniger ergiebig war die Ausbeute bei reinen Elektronikprojekten. Hier
scheint sich der Überfluss aus den Katalogen von Conrad & Co. negativ
auf die Bastelei auszuwirken, denn bei Vielem muss man einfach sagen
„Gibts schon“, und zwar meist perfekt und ziemlich billig. Das heißt aber
nicht, dass unsere Elektronikleser wunschlos glücklich wären. Viele sind
auf der Suche nach ganz speziellen Lösungen − für Bildübertragung, Ge-
wächshausbewässerung, Fernsteuerung usw. Statt eigene Entwicklungen
dafür in Auftrag zu geben, sind wir hier auf Ihre Manuskripteinsendungen
angewiesen. Schreiben Sie uns bitte, wenn Sie eine Schaltung entwickelt
haben, die auch für andere von Interesse sein könnte.
Wegen der Fülle der Vorschläge* war es sehr schwer, die besten heraus-
zufinden. Über je 50 € Urlaubsgeld können sich freuen:
P. Eichler, DJ2AX; Dr. J. Hajdu; G. Guthaus, DG0CBV; J. Hinze, DL1RNO;
R. Maier, DL7TO; D. Noack; S. Stein, DM2AT; B. Schalz; H. Schmuhl,
DL8QS, und R. Schoonens, PA3FGA
Vielen Dank allen für die Ideen. Es bleibt noch viel zu löten!
Ihr
Knut Theurich, DGØZB
PS: Der witzigste Vorschlag kam von der Ehefrau eines Funkamateurs.
Sie wünscht sich etwas, mit dem sie seine Station „neutralisieren“ kann,
sobald das Essen auf dem Tisch steht … Gibts auch schon. Versuchen
Sie es doch einmal mit dem Sicherungskasten.
*) Zusätzlich zu den ausgelobten Geldprämien haben wir uns entschlossen, weiteren
zehn Teilnehmern je ein druckfrisches Buch „Software für Funkamateure“ zuzusenden.
Wir baten um Ihre Meinung
Dreieinhalb Jahre waren seit der 2001er Leserumfrage vergangen. Höch-
ste Zeit also, wieder einmal zu überprüfen, ob Sie, verehrte Leser, mit
Ihrer Zeitschrift zufrieden sind, und herauszufinden, wie sich Ihre Inte-
ressen verändert haben, was wir künftig besser machen müssen.
Die Teilnahme an der Umfrage war wieder enorm, sodass die brieflich und
online eingegangenen Formulare ein repräsentatives Bild ergeben. Dass
unser Themenmix, der Spagat zwischen Amateurfunk und Elektronik, den
Interessen der Leser sehr nahe kommt, verdeutlicht eine Grafik, die ins-
besondere die vielen Mehrfachnennungen berücksichtigt.
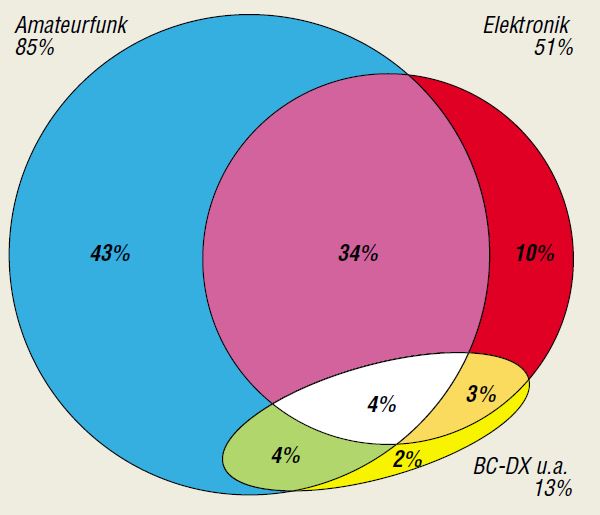
Ihre Antworten auf „Was schätzen Sie am FUNKAMATEUR?“ weichen
kaum vom Jahr 2001 ab. Die fachliche Kompetenz der Redaktion und
die thematische Vielfalt der Zeitschrift würdigen 92 bzw. 87 % der
Leser. Weniger wichtig sind die Aufmachung (42 %), der günstige
Preis (41 %) und der Internetauftritt (22%). Stolze 95 % haben sich
für die Beibehaltung des Layouts ausgesprochen − den Lesern des
FUNKAMATEUR ist vielseitige, kompetente Information eben wicht-
iger als platzfressende Grafikspielereien! Und so verwundert es auch
nicht, dass nur 2% der Meinung waren, wir sollten für das Heft bes-
seres Papier verwenden.
Bei den Wünschen für die Zukunft wollten 19 % der Leser die Jahr-
gangs-CD mit abonnieren. Darauf haben wir bereits mit der Variante
„Plus-Abo“ reagiert, bei der man für 6 € Aufschlag zum Jahresende
die CD portofrei erhält. 46 % möchten ihre Kleinanzeigen kostenlos
veröffentlicht haben − ein Wunsch, den wir gern erfüllen. Allerdings
müssen wir noch überlegen, wie dies mit wenig Aufwand machbar ist
und wie der verfügbare Platz gerecht verteilt werden kann − Details
dazu demnächst. Den teureren Versand, eingeschweißt in Folie, wün-
schten sich 6 % der Leser, siehe auch S. 542.
Eine ganze Reihe von Zusendungen war mit teils seitenlangen Vorschlä-
gen und kritischen Bemerkungen ergänzt, für die wir uns herzlich be-
danken. Wir werden diese wie auch alle weiteren Erkenntnisse gewissen-
haft auswerten und dort, wo notwendig und machbar, Veränderungen
herbeiführen. Ihre Bonus-Ideen für Selbstbauprojekte waren übrigens
so zahlreich, dass wir die besten Vorschläge noch nicht isolieren konnten.
Die Gewinner dieser 50-€-Prämien müssen wir daher auf das nächste
Heft vertrösten.
Je 50 € für die Teilnahme an der Umfrage wurden ausgelost für: F. Cimpl,
OE6FCD; K. Dabrowski, OE1KDA; R. Fischer (Schwerin); J. Fövenyi, DG1NDE;
S. Fritzsche, DD5SF; W. Gehrmann, DH0PAW; P. Gerike, DL9NDX;
A. Henriksen, OZ7AHR; K. Hirschi, HB9BZC; H.-P. Hoffmann (Dresden);
H. Keppler, DG0OEA; V. Kilinski, DL5AKF; M. Kinschus, DL6JFT; J. Kledtke,
DH9JK; H. Kuyper, PA3HK; N. Liss, DO8SD; H. Meschnark, OE8MEQ;
K.-D. Prior, DO1FD; A. Puppe, DL1CMM; J. Reinicke, DO1TRJ; A. Schar-
fenberg, DL1MK; T. See, DJ1RL; R. Sehlen, DF9XI; J. Stumpp, DO1TSI,
und R. Suffa (Limburgerhof).
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Alles neu macht der Mai
Die kalte Jahreszeit gilt unter Funkamateuren im Allgemeinen als
günstig für das Hobby. Man verkriecht sich, so man hat, ins kleine
Shack unterm Dach oder in die dunkle Bastelecke im Keller, sodass
die Familie ihr funkendes Mitglied während dieser Zeit eher selten
zu sehen bekommt.
Zwar legen Funkamateure Tausende von Kilometern zurück, jedoch
meist nur per Funkwellen. So bleibt es nicht aus, dass man das eine
oder andere Kilogramm zulegt. Kommt das Frühjahr mit wärmeren
Tagen, nehmen sich viele vor, einerseits etwas gegen den Winter-
speck zu tun, andererseits der Familie mehr Zeit zu widmen. Da tritt
die Funkerei dann eher in den Hintergrund. Doch das muss nicht
zwangsläufig so sein.
Das bessere Wetter verlockt doch gerade dazu, neue Antennen aus-
zuprobieren. Da sprießen nicht nur die Knospen an den Bäumen,
auch die Antennenideen treiben ungeahnte Blüten. Leider bleiben
diese Ideen aufgrund bau- oder mietrechtlicher Zwänge bei vielen
Funkamateuren nur Phantasie − müssen sie aber nicht.
Wie wäre es, einen kleinen Transceiver nebst Stromversorgung, Draht
sowie Schnüren einzupacken und mit den Lieben einen Ausflug zu
unternehmen? Während dieses Nachmittagsspaziergangs, an dem
der funkende Teil nach möglichen Abspannpunkten und der Rest der
Familie nach geeigneten Rast- oder Spielmöglichkeiten Ausschau hält,
kommen beide nicht zu kurz. Schnell lässt sich ein für alle geeigneter
Platz finden. Der Nachwuchs wird begeistert sein, beim Befestigen
der Antennendrähte in den Bäumen helfen zu können, denn Papa sitzt
mal nicht in seiner dunklen Funkerbude.
Während die (X)YL in der Sonne es endlich schafft, das zu Weihnach-
ten geschenkt bekommene Buch zu lesen, und die Harmonischen nach
dem Absinken des Interesses am Antennenaufbau gefahrlos im nahe
gelegenen Wald oder auf der Wiese herumtollen, kommt auch der OM
zu ein paar netten QSOs. Und ich garantiere, dass Ihnen die so
erreichten Funkverbindungen länger im Gedächtnis erhalten bleiben
als das schnelle QSO zwischen Abendbrot und Tagesschau im heimat-
lichen Shack. Außerdem bieten sich oft bessere Funkbedingungen als
in den störungsreichen und vollgebauten Stadtgebieten.
Oder haben Sie unterwegs nicht schon oft Orte gefunden, von denen
es sich super funken lassen müsste − und das nicht nur auf UKW?
Die wachsenden Aktivitäten rund um SOTA beweisen, dass so etwas
zunehmend populärer wird.
Aber auch in der Gruppe kann man Hobbyaktivität und Familienleben
verbinden. Viele Fielddays weisen schon ein so genanntes Rahmen-
programm für mitangereiste Nichtfunker auf. Wäre so etwas nicht
auch etwas für die eigene Klubstation?
Wie man sieht, gibt es viele Wege, die Familie nicht zu kurz kommen
zu lassen und trotzdem dem Amateurfunk zu frönen. Es braucht nur
ein wenig Initiative. Viel Spaß beim familienfreundlichen Funkbetrieb
in der freien Natur wünscht
Ingo Meyer, DK3RED
ehrenamtlicher Redakteur der Zeitschrift QRP-Report
Technik-Highlights und der Selbstbau
Just lieferte die CeBIT wie jedes Jahr Unterhaltungs- und Informa-
tionstechnologie vom Feinsten. Raffinessen in einer kaum noch
überschaubaren Vielfalt.
Also jede Menge sich miteinander unterhaltender Spielekonsolen,
drahtloser Musikabspielgeräte, telefonfähiger Digitalkameras,
als Handy getarnter PDAs und dergleichen mehr. Sensationen
am laufenden Band!
Allen PISA-Studien zum Trotz scheinen große Bevölkerungsteile
mit der Bedienung solch komplexer Geräte erstaunlich gut zurecht-
zukommen. Wenn es wohl auch niemandem mehr gelingt, sämtliche
Funktionen zu nutzen und zu verstehen − wozu auch?
Fragen Sie doch einmal jemanden, wie sein neues Spielzeug über-
haupt funktioniert. Wie kommt das Bild ins Telefon, wie kommt es
von diesem zu einem anderen? Wie speichert eine DVD Bilder und
Daten? Was bedeutet eigentlich MP3?
Sie, liebe Leser, haben ja zumindest eine Ahnung davon und können
wenigstens die eine oder andere Funktion sogar detailliert erklären,
sei es die Signalverarbeitung, -aufbereitung oder was der Controller
bewirkt. Andere Sachen kann man nicht wissen, etwa, wie lange die
Bilder auf der DVD halten werden. Oder ob es dann überhaupt noch
Abspielgeräte dafür gibt und ob die abgespeicherten Daten dann noch
interessieren. Aber der Großteil der fleißigen Anwender weiß ja nicht
einmal, was da im Hintergrund alles werkelt. Und was viel schlimmer
ist: Er will es gar nicht wissen.
Zugegeben: Es ist schier unmöglich, allein die ganzen Entwicklungen
im Elektronikbereich zu verfolgen, geschweige denn zu beherrschen.
Zumal in einer Zeit, in der immer mehr davon aus Fernost kommt.
Allerdings helfen Fachbücher immer noch; Fachzeitschriften auch…
Und nun Hand aufs Herz: Wann haben Sie denn das letzte Mal den
Lötkolben angeheizt? Das ist doch auch so eine Sache: Wenn es
überall so perfekte Geräte gibt, was soll man da noch selbst bauen?
Zu dieser Situation passend sagt ein altes chinesisches Sprichwort:
„Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.“ Wenn es auch eine
bekannte Route ist. Wollten Sie nicht schon lange einmal den
Wackelkontakt an der Fernbedienung reparieren? Ein Verlängerungs-
kabel löten? Das wäre der richtige Schritt, um wieder ins Geschäft
zu kommen. Und dann vielleicht ein kleines Projekt, das etwas
anspruchsvoller ist. Etwa DJ8ILs Lichtsprechgerät ab Seite 360 in
diesem Heft:
Es erweckt ein altes Kameragehäuse zu neuem Leben, verrät viel über
Signalübertragung und -aufbereitung, ist eigentlich eine kommerziell
wie militärisch hochaktuelle Technologie – und kommt doch ohne
kryptische Spezialbauteile aus. Das Resultat ist spannender als das
neueste Handy mit Push-to-Talk-Funktion. Anspruchsvoller, durchaus.
Und obendrein bestimmt gebührenfrei.
Viel Erfolg beim Selbstbau wünscht
Ulrich Flechtner
Sie sind gefragt
Seit wir das letzte Mal ermittelt haben, wo die Interessen unserer
Leser liegen, sind fast vier Jahre vergangen. In dieser Zeit sind beim
FUNKAMATEUR rund 6000 neue Abonnenten hinzugekommen und
beinahe gleichviele haben ihr Abonnement aus Alters- oder sonstigen
Gründen gekündigt. Schon deshalb sind wir darauf angewiesen, mit
statistischen Methoden den aktuellen Stand sowie Trends zu ermitteln.
Dass es in mancher Hinsicht nicht einfacher geworden ist, Amateur-
funk zu praktizieren, ist eine Tatsache, mit der man sich auseinander
setzen muss. Der CB-Funk verliert so rasant an Bedeutung, dass es
nicht einmal mehr eine Zeitschrift für dieses Hobby gibt, das vor ein
oder zwei Jahrzehnten noch boomte. Und gerade eben hat das
Quartalsmagazin Radio-Scanner sein Erscheinen eingestellt.
Für Elektroniker verändert sich die Landschaft: Beliebte Bauteile
verschwinden für immer vom Markt, neue sind so klein, dass man sie
nicht mehr so einfach verarbeiten kann, aber Controller bieten ebenso
wie neue ICs faszinierende Möglichkeiten.
Daher ist es für die Redaktion zwingend notwendig, hin und wieder
in Erfahrung zu bringen, wie sich Ihre Interessen entwickeln, was Sie
von Ihrer Zeitschrift erwarten und was wir besser machen müssen.
Zwar ist der FUNKAMATEUR mit einem Jahresabopreis ab 33,60 €
unter den großen Funk- und Elektronikzeitschriften die preisgünstigste,
gleichwohl sehen wir es als unsere Pflicht an, jeden Monat eine gute
Zeitschrift für Sie herauszugeben. Schließlich wollen wir Ihnen auch
das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
In der Heftmitte finden Sie daher diesmal einen Fragebogen. Um
möglichst viele Leser zur Teilnahme an der Leserumfrage zu bewegen,
hat der Verlag insgesamt 1750 € Preisgeld zur Verfügung gestellt,
das unter den Teilnehmern verlost wird. Zehnmal 50 € davon sind
als Prämie für Ideen vorgesehen, die Sie uns zu Selbstbauprojekten
nennen. Angesichts der vielen in Billiglohnländern hergestellten Dinge
sind Hinweise auf Marktlücken für uns besonders wichtig. Nur wenn
wir wissen, was Sie noch als lohnenswert für den Selbstbau betrach-
ten, können wir uns nach Autoren und Entwicklern umsehen.
Nehmen Sie sich also bitte ein paar Minuten Zeit, setzen Sie Ihre
Kreuzchen, schreiben Sie mit wenigen Worten auf, was Sie sich von
uns wünschen. Seien Sie nicht zimperlich, uns noch so unangenehme
Wahrheiten zu sagen − wir schließen Sie deshalb nicht von der Ver-
losung aus! Die Redaktion wird Ihre Antworten sorgfältig auswerten
und dort Veränderungen herbeiführen, wo es notwendig und machbar
erscheint.
Neben dem Fragebogen finden Sie in dieser Ausgabe Hinweise für
Autoren. Wie eh und je stammen die meisten Beiträge im FA ja nicht
von Schreibprofis, sondern von ganz „normalen“ Lesern, wie Sie
auch. Vielleicht haben Sie ja etwas Veröffentlichungswürdiges parat
und bisher nur gezögert, ein Manuskript zu erstellen. Wenn Sie unsere
Tipps beachten, geht Ihnen die Arbeit sicher leichter von der Hand.
Ich freue mich mit Ihnen auf einen den Interessen der breiten Leser-
schaft noch besser gerecht werdenden FUNKAMATEUR.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Amateurfunk − Hilfe in der Not
Die Tropen kennt man als Funkamateur aus den Reiseberichten, in
denen ein OM unter Protest der XYL seinen Urlaub damit verbringt,
unter Palmen mit Hitze und Stromausfällen zu kämpfen sowie Ground-
planes am Strand zwecks besserer Erdung ins Salzwasser zu stellen,
um so auf eine bessere Raumwelle zu hoffen.
Doch nun haben Indien, Indonesien, Thailand, Sri Lanka und die
Malediven mit den Nachwirkungen wesentlich unangenehmerer Wellen
zu kämpfen. Hierzulande konnte man den Schrecken lediglich durch
die Medien reflektiert ermessen. Währenddessen waren die Funk-
amateure in den betroffenen Ländern und im Rest der Welt wieder
einmal unmittelbar Helfer in der Not, als andere Kommunikations-
mittel ausfielen. Einmal mehr konnte das Hobby Amateurfunk seine
Nützlichkeit beweisen, wenn auch eher still im Hintergrund und
nicht fernsehtauglich.
Überall gibt es nun Benefiz-Galas und jeder will Spenden einnehmen
und verteilen. Doch ob das Geld wirklich rechtzeitig oder überhaupt
ankommt, ist selbst bei den großen Organisationen nicht immer
sicher. Vorsicht ist auf jeden Fall geboten bei Spendenaufrufen per
E-Mail oder auf unbekannten Webseiten: So mancher Gauner hat
hier bereits seine eigene Kontonummer an die Stelle jener der Hilfs-
organisationen gesetzt, um aus der Not der Tsunami-Opfer persönlich
Kapital zu schlagen. Außerdem versuchen radikale politische Orga-
nisationen in Südostasien, Spendengelder für sich abzuzweigen.
Der direkte Weg ist also auch nicht immer sinnvoll.
Eine von der A-DX (www.ratzer.at) aufgezeigte Alternative ist es,
auf einer persönlicheren Ebene im Rahmen des Hobbys zu helfen.
Gerhard Werdin hat selbst zweieinhalb Jahre auf Sri Lanka, einem der
vom Tsunami am stärksten betroffenen Länder, als Telekom-Berater
verbracht und weiß um die Probleme der Logistik in diesen Ländern −
bereits unter normalen Umständen.
Er kennt auch seit 26 Jahren Victor, 4S7VK, den international be-
kannten und angesehenen DXer und Funkamateur, der auch Präsident
der Sri Lanka Amateurfunk Society ist. Victor will mit seinen Freunden
die Regierung mit der Errichtung von Kommunikationsverbindungen
zu entlegenen Distrikten unterstützen. Während sie ihr Bestes tun,
fehlt es doch an finanziellen Mitteln für alles, von Ausrüstung über
Material bis hin zu Benzin, um Personen und Material durchs Land
zu transportieren.
Spenden ist zwar Vertrauenssache, aber wer über Gerhard Werdin
die Sri Lanka Amateurfunk Society unterstützt, bekommt die Ver-
wendung aller Gelder am Ende komplett nachgewiesen. Was nicht
von der Amateurfunk Society direkt benötigt wird, soll für direkte Hilfe
in Form von Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten Verwendung
finden, so versichert Werdin.
Mehr über Victor Goonetilleke findet sich auf www.dxasia.info, die
Kontodaten von Gerhard Werdin lassen sich bei ihm unter
g.werdin@gmx.net erfragen.
Wolf-Dieter Roth, DL2MCD
Gefährliche Fälschungen
Gelegentlich wird wieder eine entdeckt, die jahrelang bewundert in
einem Museum hing. Plötzlich stellt sich heraus, dass das Meister-
werk nicht von Rembrandt, Picasso oder Renoir stammt, sondern
von Otto Müller in mühevoller Heimarbeit nachempfunden wurde.
Anscheinend auch mit allerhand Geschick. Die Zahl solcher Kunstwerke
in Privatbesitz, oft als „heiße Ware“ dorthin gelangt, lässt sich
nicht einmal schätzen.
Auch unschätzbar, und noch viel problematischer, ist die zunehmende
Anzahl gefälschter elektronischer Bauteile auf dem Markt. Zum ersten
Mal begegneten sie mir, als ich vor Jahren ein CB-Funkgerät repa-
rieren musste und Ersatzteile bestellte. Der Endstufentransistor hatte
die richtige Form, Größe, Belegung und den richtigen Aufdruck. Nur
die Gehäusefarbe war merkwürdigerweise rot. Das Gerät ging nach
dem Austausch immer noch nicht. Lag der Fehler anderswo? Der
Transistor verstärkte doch: Gleichstrom ebenso wie NF. Nur die Transit-
frequenz lag schon bei 20 MHz, also ein NF-Typ!
Inzwischen häufen sich die Berichte über Leistungstransistoren wie
den 2N3055 mit winzigem Chip im Gehäuse. Oder von SMD-Logik-
ICs, die zwar ein schönes Gehäuse und Anschlussbeine, aber kein
Innenleben mehr enthalten. Das ist praktisch, spart es doch die auf-
wändigsten Prozesse bei der Herstellung und erleichtert zugleich die
umweltgerechte Entsorgung ungemein. In Fernost haben sich mittler-
weile ganze Firmen darauf spezialisiert, vorhandene billige Bauteile
abzuschleifen und durch kunstgerecht imitierte Aufdrucke oder
Lasergravuren zu veredeln, wenn sie nicht gar schon die höchste
Kunst beherrschen und Bauteile ohne Funktion fertigen.
Wie kann es dazu kommen? Es gibt nicht nur eine Knappheit bei
Rohstoffen wie Eisen, Kupfer, Zink und Erdöl, sondern auch bei
Bauteilen. Hersteller verschwinden oder stellen die Produktion oft
bewährter Teile über Nacht ein. Andere Firmen haben hingegen noch
große Lagerbestände, die sie in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
abstoßen möchten. So bilden sich neue Märkte mit günstigen Preisen,
aber z. T. zweifelhafter Herkunft der Ware. Wenn ein kleines Eigenbau-
gerät nicht auf Anhieb funktioniert, ist das ärgerlich, aber harmlos.
Liefert das Eigenbaunetzteil statt 13 plötzlich 23 V an den teuren
Transceiver, ist der Ärger grenzenlos. Das Problem an gefälschten Bau-
teilen ist, dass niemand vorhersagen kann, wann es zu Ausfällen kommt.
Nicht auszudenken wäre der Schaden, wenn solche Bauelemente
auch in sicherheitsrelevanten Anwendungen wie in Flugzeugen, Kraft-
fahrzeugen und Medizintechnik-Geräten zum Einsatz kämen − aber
dort gelten glücklicherweise wesentlich verschärfte Bestimmungen.
Was ist zu tun? Hersteller wie Lieferanten müssen ihre Lieferketten
lückenlos überprüfen oder alternativ aufwändige Eingangstests ein-
führen. Und in Fernost braucht es endlich eine Rechtssicherheit, die
es ermöglicht, solchen Bauteilbackstuben das Handwerk zu legen.
Bis es soweit ist, gebe ich für bestimmte Bauteile lieber ein wenig
mehr Geld aus und greife gern auf die alten Bestände meines
örtlichen Händlers oder des Versands meines Vertrauens zurück.
Geiz ist eben nicht immer geil, sondern manchmal auch richtig
peinlich!
Ulrich Flechtner
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Spannend: 40 m expandiert!
Es gibt mehrfach im Jahr Momente, da platzen einige Amateurfunk-
bänder, speziell 40 m, regelrecht aus allen Nähten. Das konnte man
erst kürzlich während der sogenannten Telefonie-Weltmeisterschaft
(WWDX Fonie Contest) eindrucksvoll beobachten. Aber auch
andere große Conteste mit weltweit hohem Beliebtheitsgrad führen
dazu, dass entweder nur noch SSB- oder CW-Betrieb, je nach
Contest, durchführbar ist. Nicht-Contester fühlen sich dabei jedes
Mal wieder auf den Schlips getreten und zeigen daher auch wenig
Lust, auf ihre Gewohnheiten zu verzichten. Und ewig auf den Ham
Spirit, der Funkamateuren nachgesagt wird, hinzuweisen, bringt
auf Dauer keine Entspannung der Situation. Da hilft eigentlich nur
eines: 40 m muss expandieren!
Da kam es gerade recht, dass nach langjährigen Vorarbeiten in
der CEPT, der Konferenz der Europäischen Post und Fernmelde-
verwaltungen, eine Empfehlung für eine erweiterte Zuweisung
an den Amateurfunkdienst im 40-m-Band auf den Weg gebracht
wurde. Die Funkverwaltungskonferenz beschloss daraufhin im Juni
2003 eine primäre Zuweisung des Frequenzbereichs von 7,1 bis
7,2 MHz für die Funkamateure in den IARU-Regionen 1 und 3.
Bitterer Beigeschmack: Die Regelung tritt erst im April 2009 in
Kraft. Das ist eigentlich verständlich, denn selbst die größten
Optimisten können nicht ernsthaft annehmen, dass die Rundfunk-
stationen, die sich auf diesen Frequenzen seit Jahrzehnten tummeln,
innerhalb weniger Monate das Feld räumen und ihren Betrieb
einstellen. Das benötigt Zeit. Und ohne die Berücksichtigung der
Interessen der Primärnutzer ist eine vorzeitige Freigabe für den
Amateurfunk nur schwer machbar.
Umso überraschender ist es daher, dass nun bereits die Fern-
meldeverwaltungen einiger europäischer Länder die Nutzung des
zusätzlichen Frequenzbereichs auf sekundärer Basis vorab zulassen.
Jüngste Beispiele sind Großbritannien und die Schweiz. Wie sich
die in der Schweiz zugelassenen 100 W ERP ab 1.5.05 gegen
die Rundfunksender in der Praxis behaupten, sei dahingestellt.
Immerhin ist es diesen Versuch Wert.
Allerdings lösten diese Alleingänge neue Diskussionen in der CEPT
aus. Derzeit wird erneut darüber nachgedacht, ob und wie eine
generelle Freigabe des zusätzlichen Bereichs realisierbar ist. In einem
dafür zuständigen Arbeitskreis der CEPT versucht man unter Ein-
beziehung der IARU-Region 1 eine Empfehlung für das höchste
Entscheidungsgremium der CEPT, dem Europäischen Kommuni-
kationsausschuss (ECC), zu erarbeiten.
Vom DARC e.V. war inzwischen zu vernehmen, dass in Zusammen-
arbeit mit dem RTA (Runder Tisch Amateurfunk) bereits geeignete
Schritte unternommen wurden, die zur Findung einer gemeinsamen
europäischen Lösung beitragen. Somit steigt die Hoffnung, in
absehbarer Zukunft die Contestproblematik, wenigstens auf 40 m,
etwas zu entschärfen.
Wolfgang Bedrich
Internet ist kein Rundfunk
Ein Gespenst geht wieder einmal um: Rundfunkgebühren für die
Internetnutzung. Erstmals ließ es sich 1997 blicken. Mein damaliger
Chef wollte mir prompt das für meine Arbeit wichtige Modem
abnehmen, um die dafür angekündigte Fernsehgebühr zu umgehen.
Dabei konnte man über ein 28 800er-Modem nicht fernsehen und
auch nicht Radio hören − Soundkarten gab es im Büro überhaupt
nicht, und man hätte mir auch was gehustet, wenn ich so etwas
während der Arbeitszeit getan hätte.
Der böse Geist verkroch sich jedoch − bis 2001, als er in Gestalt der
schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simonis wieder
auftauchte. Inzwischen waren PCs mit E-Mail- und Webzugang zum
Standard in Unternehmen geworden. Wie bei Radios und Fernsehern
im Büro eine volle Rundfunkgebühr pro Gerät? Das wäre ruinös.
Und wenn die Sender auch noch paar Hotlines einrichten, die einem
jederzeit das aktuelle Radioprogramm vorspielen, wäre dann auch
jeder Telefonanschluss ein Fall für die GEZ?
Der Alternativvorschlag des ARD-Vorsitzenden Fritz Pleitgen: Nur noch
eine pauschale Gebühr pro Firma. Schön für Großunternehmen,
schlecht für Freiberufler, die gar keinen Fernseher im Büro haben,
weil sie dort stattdessen arbeiten müssen. Aber vor allem: Ein Minus-
geschäft, denn für die zahlreichen Radios in großen Firmen kassiert
die GEZ heute gut ab. Pleitgen legte den Rechenschieber beiseite
und pfiff das Gespenst zurück in die Gruft.
Nun ist es mit der nächsten Gebührenrunde wieder da: Ab 1. Januar
2007 soll für die Internetnutzung in Unternehmen an ARD und ZDF
gezahlt werden, bereits ab 1. April 2005 für die private E-Mailerei,
Surferei und Chatterei. Die öffentlich-rechtlichen Sender sollen so
die Qualität des Internets sicherstellen.
Die Konditionen sind wieder ähnlich geplant wie 2001: Pro Unter-
nehmen eine Gebühr, in Privathaushalten allerdings − anders als bei
Radio und Fernsehen − eine Gebühr pro internetfähigem Computer:
eingebautes Modem oder Ethernetkarte reichen. Wer bereits Fern-
sehen angemeldet hat, muss allerdings für die E-Mail-Geburtstags-
wünsche an die Tante oder den Abruf des Logfiles der DXpedition
über T-Online nicht extra zahlen. Also alles halb so wild?
Nein, denn ums Geld geht es der Politik und den Sendern hierbei
gar nicht. Vielmehr wollen sie Telekommunikation zu Rundfunk
umdefinieren: Auch private E-Mails und selbst unser Hobby Ama-
teurfunk, in dem rundfunkähnliche Darbietungen bekanntlich sogar
gesetzlich untersagt sind, würden plötzlich zur ureigensten Sache
von ARD und ZDF.
Was das bedeutet, habe ich bereits persönlich in einem Prozess
um eine Internet-Domäne erleben dürfen: Das LG Köln sah in der
Beschäftigung mit Amateurfunk und Funktelefonen sehr wohl eine
kommerzielle Konkurrenz zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Hoffen wir, dass dies der Allgemeinheit erspart bleibt und zumindest
das Gespenst „Internet-GEZ“ bald wieder in seiner Truhe verschwindet.
Wolf-Dieter Roth, DL2MCD
Werden Sie offensiv!
Das Ende des analogen Mobilfunk-B-Netzes, das Aus für das C-Netz
im letzten Jahr, die schrittweise Aufgabe von analogen Fernseh-
kanälen im VHF- und UHF-Bereich für das terrestrische Fernsehen,
all das könnte uns glauben machen, dass es für die Funkamateure
bald neue UKW-Bänder oberhalb 30 MHz zuhauf geben könnte.
Das Gegenteil ist der Fall. Ob LPDs, Satellitennavigation, neue digi-
tale Bündelfunknetze, so schnell wie Frequenzbereiche frei werden,
so rasant finden sich Interessenten für diese Segmente. Aber nicht
nur für diese Bereiche. Auch Teile des UKW-Spektrums, in denen es
seit 50 Jahren bereits Zuweisungen an den Amateurfunkdienst gibt,
werden zunehmend von den Kommerziellen zu okkupieren versucht.
Die Amateurfunkvereine und übergeordnete Verbände haben alle
Hände voll zu tun, diesen Ansprüchen mit Argumenten zu begegnen,
unsere Frequenzbereiche zu verteidigen. Ausbildung Jugendlicher,
Technik-Innovation, Experimentalfunkdienst, all das liest sich in den
Erwiderungen auf laut oder halblaut geäußerte Begehrlichkeiten der
kommerziellen Mitbewerber um Stückchen aus dem Frequenzkuchen.
Aber reicht das aus?
Die Überschrift sagt es eigentlich: Wir verteidigen, wir sind defensiv,
und das reicht im schlimmsten Fall nicht. Aber wie können wir in die
Offensive gehen? Nur durch Aktivität!
In der ersten Septemberwoche hatten wir exzellente Ausbreitungs-
bedingungen auf den UKW-Bändern. Im DX-Cluster konnte man
mitverfolgen, wie im 2-m-Band Tropo-Verbindungen über Distanzen
von deutlich mehr als 1500 km abliefen. Beim Absuchen der Bänder
war allerdings auch sehr viel Rauschen zu hören. Punktuell fanden
sich Signale von DX-Stationen, die von Dutzenden Anrufern dicht
umlagert waren. Dazwischen herrschte teilweise gähnende Leere.
Gerade auf dem stark gefährdeten 70-cm-Band war trotz guter
Bedingungen so gut wie nichts zu hören.
Das änderte sich am ersten Septemberwochenende schlagartig.
Der 2-m-IARU-Region-1-Contest begann, und die Zustände erinner-
ten zeitweise an das 40-m-Band. Es gab kaum eine freie Frequenz
im Gewühl der lauten und leisen Signale. 24 Stunden ging das so.
Und dann? Die guten Bedingungen hielten noch weitere drei Tage
an, aber die Bänder waren wieder verwaist. Einzig zum Nordischen
Aktivitätscontest bzw. dem RSGB-Kurzcontest, beide am ersten
Dienstag jedes Monats, füllte sich das 2-m-Band wieder. 70-cm-
Kontakte kamen in der Regel nur durch Cluster-Skeds zustande.
Das beste Argument für den Erhalt der UKW-Amateurbänder ist
deren aktive Benutzung. Wenn sich diese auf das Digital-Konzentrat
um 144,370 MHz herum sowie auf die aller zwei Monate stattfinden-
den Conteste reduziert, werden die kommerziellen Interessenten
dies registrieren und sich darauf berufen.
Benutzen Sie Mikrofon oder Taste wieder offensiv. Rufen Sie auch
einmal „ganz normal“ CQ. Es müssen nicht gleich 1500 km sein −
150 reichen doch auch.
Awdh de DL7YS
Peter John, DL7YS
Deutschland im Rückwärtstrend?
Offenbar anlässlich des diesjährigen Sommerlochs haben die Häuser Springer,
Spiegel und Süddeutscher Verlag mit einem Paukenschlag für Furore gesorgt.
Wegen mangelnder Akzeptanz der neuen wende man nun wieder die alte
Rechtschreibung an. Ob das hilft? Warum hat man sich nicht schon bei der
Einführung so positioniert?
Auch wir sind mit den nicht zu übersehenden Verschlimmbesserungen, die
die Rechtschreibreform brachte, noch nie glücklich gewesen. So hatten wir
uns erst nach sehr langem Zögern, nämlich ab der Januar-Ausgabe 2003,
als die Zeitung mit den großen Buchstaben schon längst „neudeutsch“ titelte,
zur Umstellung entschlossen. Eine Reihe von Lesern, vor allem ältere, pro-
testierte seinerzeit − andere fanden den Schritt sinnvoll.
Wir sahen dies damals als eine von vielen Maßnahmen an, uns auch jugend-
lichem Publikum zuzuwenden, um der wachsenden Überalterung unseres
Hobbys entgegenzuwirken. So pflegen wir ja auch einen betont lockeren
Stil, lassen mal einen Smiley in einem sonst eher trockenen Beitrag zu und
redigieren witzige Bemerkungen unserer Autoren nicht weg.
Und nun wieder ein Rückschritt zum Alten? Schauen wir uns an, was die
Leute dazu sagen: Nach einer von der dpa in Auftrag gegebenen polis-
Umfrage (Quelle: Spiegel Online) wollen nur 15 % der Befragten nach den
neuen Regeln weiter schreiben. Für eine komplette Rücknahme der Reform
stimmten 29 %, andererseits würden 28 % sinnvolle Teile übernehmen, und
27 % könnten sich mit einem gleichberechtigten Nebeneinander von alten
und neuen Regeln anfreunden. Andere Umfragen (Berliner Zeitung u. a.)
führten zu ähnlichen Ergebnissen. Allgemein nimmt das Beharrungsbestreben
mit dem Alter verständlicherweise zu, aber viel Akzeptanz gibt es auch bei
den Jüngeren nicht. Am größten ist sie noch bei den mit den neuen Regeln
aufgewachsenen Schülern.
In den über hundert Jahren seit der vorletzten Rechtschreibreform von 1901
hat sich die deutsche Sprache weiter entwickelt, und dies sollte sich im
Duden manifestieren. Das, was allerdings ein Heer hochbezahlter Leute in
die Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung gegossen hat, wirkt nur
teilweise überzeugend und stellenweise eher unausgegoren bis dilettantisch.
Paradebeispiel: „Sich im Klaren sein.“ (Im gleichnamigen Schnaps…?)
Ganz übel die erzwungene Auseinanderschreibung vieler Wörter, deren un-
terschiedliche Bedeutung zuvor durch die Zusammen- und Auseinander-
schreibung klar bestimmt war. Das ist etwas, was gerade bei unseren tech-
nischen Texten die Klarheit und Eindeutigkeit, also die Verständlichkeit,
schmälert. Hier hätten die Großverlage ansetzen und kraft ihrer Wassersuppe
eine echte Vorwärtsentwicklung in Gang bringen sollen, die aus unserer Sicht
dringend notwendig erscheint.
Wer sich das neue Regelwerk (u. a. www.ids-mannheim.de/reform/) einmal
ansieht, wird staunen, wie kompliziert es sich doch darstellt – und vor allem,
welche Fülle von Ausnahmen und Inkonsequenzen es weiter enthält. Man
hätte wohl die Entscheidung nicht den Kultusministern der Länder (zumeist
Politiker, keine Fachleute) überlassen sollen, sondern zuvor mehr Schrift-
steller, Journalisten, Lehrer, aber auch den Mann von der Straße inklusive
Schüler befragen sollen und vor allem schauen, wie Letztere mit der ge-
planten Reform zurecht kommen. Inzwischen hat unser Land ja nun die Test-
phase absolviert, und es gibt genügend bedenkenswerte Einwände zu den
neuen Regeln. Deren Umsetzung sollte man nicht allein der Dudenredaktion
und den Kultusministern anvertrauen. Dann könnte ein runderer Entwurf
herauskommen.
Ihr
Bernd Petermann, DJ1TO
Kultur des Treffens
Funk und Telefon haben wir schon lange, doch inzwischen kann man
ja auch ganz phantastisch per E-Mail kommunizieren. Aber selbst
das ist bald nicht mehr up to date: Lese ich doch gerade im Heise-
Newsticker, dass Instant Messaging, also Live-Kommunikation mit
Freunden via Internet, in den USA bereits die SMS vom Platz 1 der
Beliebtheitsskala verdrängt hat. Merken Sie was? Das bedeutet doch
nichts anderes, als dass die betroffenen Zeitgenossen nur noch vorm
PC glucken…
Wie angenehm empfand ich es da, im Friedrichshafener Messetrubel
von vielen Bekannten angesprochen zu werden und eine Menge
Leute kennenzulernen. Überhaupt fiel auf, dass auf besagter Groß-
veranstaltung − nicht zuletzt wegen des trotz aller statistischen Schön-
färberei unverkennbaren Rückgangs der Ausstellerzahlen − wieder
mehr der Charakter des Bodenseetreffens hervortrat.
Dazu hatte auch der DARC das Seinige getan und mehr als sonst
für Foren, Workshops, Diskussionsrunden, Versammlungen usw.
gesorgt, was von vielen Besuchern zur Klärung von auf den Nägeln
brennenden Problemen genutzt wurde und insgesamt zu einem
angenehmen Fluidum beitrug. Doch was wäre ein Ham-Meeting
ohne Zeltplatz, wo man bei grillrauchgeschwängerter Luft fach-
simpelt, „Jäger-Latein“ pflegt und funkt? Hoffen wir, dass die Messe-
leitung beim nächsten Mal das Duschproblem in den Griff bekommt,
damit nicht noch mehr Camper zu Hause bleiben.
So freuen sich sicher bereits heute viele UKW-Fans auf die Begeg-
nung in bzw. vor dem Weinheimer Clubheim, dem Domizil von
DL0WH, am zweiten September-Wochenende. Wer zur August-
Veranstaltung anreist, wird ohne dieses traditionsreiche Meeting
auskommen müssen. Ist es nicht schlimm, dass sich ein Veranstalter-
team so entzweit, dass letztlich zwei halbe UKW-Treffen dabei heraus-
kommen? Vereinsquerelen hin oder her, das Nachsehen haben wir
Besucher. In diesem Machtkampf kann es eigentlich nur Verlierer
geben. (X)YLs und OMs in Weinheim, rauft euch bitte zusammen,
damit wir uns 2005 wieder alle gemeinsam zum 50. UKW-Treffen
einfinden können!
Einen weit angenehmeren Eindruck vermittelt mir da die Website
www.da0yfd.de. Einige Aktivisten aus dem süddeutschen Raum
organisieren vom 20. bis 23.8. den neunten Jugend-Fieldday in
Marloffstein bei Erlangen. Bereits die Checkliste auf der Website lässt
erahnen, wie dort auf allen KW-Bändern und von 2 m bis 3 cm sowie
in ATV, CW, Packet-Radio, RTTY, SSB, SSTV u.a. „der Bär steppt“.
Dabei stehen ganz offensichtlich die ersten drei Buchstaben des
Wortes Funken im Vordergrund, und das Treffen junger − und alter −
Gleichgesinnter wird sicher ein voller Erfolg.
Wer nun Lust bekommt, bei einer ähnlichen Veranstaltung mitzu-
machen, findet auf den Seiten 868 bis 869 in dieser Ausgabe Termine
weiterer Fielddays in anderen Regionen. Detaillierte Informationen
gibt es im Internet, via E-Mail, per Telefon sowie übers Packet-Radio-
Netz. Nutzen wir diese Mittel, um die gerade in Zeiten immer sterilerer
elektronischer Kommunikation so wichtigen persönliche Begegnungen
zu organisieren!
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Die vergessene Zeugnisklasse?
Seit der Einführung des Klasse-3-Zeugnisses hat die Zahl seiner
Inhaber dank der vielerorts stattfindenen Vorbereitungskurse die
5000er Marke überschritten. Doch auf den Bändern hört man nur
einzelne OMs mit dem entsprechenden DO-Rufzeichen. Woran liegt
diese scheinbare Lustlosigkeit eines großen Teils der DOs nach der
abgelegten Prüfung?
Erinnern wir uns doch einfach der Gründe für die Einführung dieser
Zeugnisklasse. Hauptsächlich war sie als erster Schritt auf dem Weg
zum Klasse-2- oder -1-Zeugnis gedacht. Dass sie nur als Eintritts-
karte für die „Spielwiesen“ Relais und Ortsfrequenz dient, hatte man
sicherlich nicht beabsichtigt.
Allein schon aus den in unserer Abonnentsverwaltung eingehenden
Rufzeichenummeldungen ist ersichtlich, dass zumindest einige den
vorgezeichneten Weg ehrgeizig verfolgen. Im Verhältnis zur Gesamt-
zahl der ausgegebenen Lizenzen sind das aber wenige. Ein großer
Teil der neuen Funkamateuren scheint weder bestrebt zu sein, in eine
höhere Klasse zu wechseln, noch einfach nur auf den Bändern aktiv
zu sein. Warum lassen so viele Neue ihre Amateurfunkzeugnisse
einfach in der Schublade liegen und nutzen die damit verbundenen
Privilegien wie Antennen- oder Geräteselbstbau nicht?
Zum einen ist daran bestimmt das arrogante Auftreten einiger Hams
gegenüber DO-Rufzeicheninhabern auf den Relais Schuld, zum an-
deren trägt auch die auferlegte Leistungsbegrenzung ihren Teil zum
Verstummen der Neuen bei. Dabei hat die geringe Strahlungsleistung
aber auch Vorteile − so entfällt zumindest der leidige Streß mit der
Selbsterklärung. Aber mit den zulässigen 10 W EIRP kommt man halt
nicht sehr weit. Zudem ist das Funken inmitten von Stationen, die ein
Vielfaches dieser Leistung nutzen, besonders bei Wettbewerben alles
andere als Zuckerschlecken.
Wie wäre es also, wenn sich ein Organisator findet und in den zwei
oder drei Stunden vor dem Beginn eines großen UKW-Contests
einen „Contest vor dem Contest“ veranstaltet, in dem DO-Stationen
üben sowie SSB-Erfahrungen sammeln können. Während dieser
Zeit kommt erfahrungsgemäß auf den Bändern schon Aktivität der
Klasse-1- und -2-Stationen auf, die Test-QSOs fahren. Die DOs könn-
ten QSO-Nummer, Rapport und Locator austauschen und als geson-
derten Wettbewerb abrechnen. Wenn dabei alles gut läuft, hätten
sie die Option, sich auch noch zur Teilnahme am „richtigen“ Contest
zu entschließen. Außerdem ließen sich die erreichten Ergebnisse
objektiv vergleichen, da ja auf diese Weise die Punkte der einzelnen
DO-Stationen unter ähnlichen Bedingungen erzielt worden wären.
Nun werden bestimmt einige Leser sagen, dass sich die Unterstüt-
zung nicht allein auf den reinen Funkbetrieb beschränken sollte.
Da geben wir ihnen Recht. Die Blauen Seiten in unserer Zeitschrift
hatten sich innerhalb des letzten Jahres zwar überwiegend mit dem
Einsteig in die Kurzwelle beschäftigt, doch wir werden in den
kommenden Ausgaben auch wieder auf die vielfältigen Probleme
beim UKW-Einstieg eingehen.
Ingo Meyer, DK3RED
Auf nach Friedrichshafen!
Manager und Politiker sagen die Erholung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den nächsten Monate voraus und beschwören dies
unentwegt auf publikumswirksamen Events wie der CeBIT, der
Hannovermesse usw. Seien wir also gespannt, ob sich ein entspre-
chender Trend ebenfalls auf der diesjährigen Ham Radio abzeichnet.
Die äußeren Bedingungen sind günstig − das neue Messegelände
fand bereits im Vorjahr bei Ausstellern und Besuchern großen Anklang.
So verzeichnet die Messeleitung bislang 150 Aussteller aus etwa
30 Ländern. Die Großen der Branche haben ja bereits in Dayton
Einiges gucken lassen, das sie sicher auch am Bodensee präsentie-
ren werden.
Innovationen kommen indes, und das macht die Ham Radio erst
richtig interessant, ebenso von den vielen kleinen Unternehmen, für
die derartige Messen die einzige Chance bieten, ihre Produkte einem
breiten Publikum vorzustellen. Manche, wie EZNEC-Schöpfer W7EL,
nehmen dazu sogar den Weg über den großen Teich auf sich, und
vermutlich werden auch findige Köpfe aus den neuen EU-Ländern
ihre Kreationen beisteuern. Freuen wir uns auf sie alle, selbst wenn
es an ihren Ständen weniger glitzert als bei den High-Tech-Profis
aus dem Land der aufgehenden Sonne…
Auch der gewählte Zeitraum von Freitag bis Sonntag scheint familien-
freundlich. Zudem ist Camping auf dem Parkplatzgelände bereits
ab 21.Juni möglich, und die Halle A6 bietet Platz für das traditionelle
Jugendlager.
Erstmalig nutzte der DARC-Vorstand die Gelegenheit, im Rahmen
des parallel ablaufenden 55. Bodenseetreffens am Sonntag früh
eine für alle offene Mitgliederversammlung anzuberaumen. Da gibt es
sicher viel zu bereden, beispielsweise, wie der Mitgliederrückgang
gestoppt und die Nachwuchsförderung weiter forciert werden können,
wobei positive Ansätze durchaus erkennbar sind.
Reden sollten wir aber auch, wie es überhaupt mit unserem Hobby
weitergeht! Ist es nicht denkwürdig, dass sich, von Ausnahmen mal
abgesehen, seit Freigabe des ISM-Bereiches im 70-cm-Band für LPDs
kaum ein Jedermannsfunker über Störungen durch Funkamateure
zu beklagen hatte? Wenn sich die Industrie mit WLAN- und PLC-
Lösungen breitzumachen gedenkt, dann u.a. deswegen, weil sie nicht
wirklich mit ernsthaften Beeinflussungen durch unsere Funktätigkeit
rechnet.
Dreht man über die FM-Relais, so scheinen Vereinsmeierei und per-
sönliche Querelen die Gespräche zu dominieren − schön, dass wir
keine anderen Sorgen haben! Anders in den USA: Auch dort schwebt
das Damoklesschwert PLC über den KW-Bändern. Deswegen rief just
der ARRL-Vorstand „zu den Waffen“, um Entscheidungsträger massiv
für das Problem der Funkstörungen durch PLC zu sensibilisieren −
siehe S. 641 in dieser Ausgabe. Manchmal ist der Blick über den
Gartenzaun vielleicht doch nicht so verkehrt…
Lasst uns also treffen, fachsimpeln, Neuheiten bestaunen und über
dies und das reden − auch beim FA in Halle A1, Stand 104.
Unser Team freut sich auf Sie − bis bald! Ihr
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Was wir kaufen würden
Sie ist vorbei − die CeBIT 2004. Zwar haben deutlich weniger Aus-
steller ihre Neuentwicklungen gezeigt, vor allem blieben einige Große
fern, und auch die Besucherzahlen sind insgesamt gegenüber dem
Vorjahr zurückgegangen. Dennoch ist die Branche zuversichtlich.
Flachbildschirme, UMTS, WLAN und vieles andere sind ihre Hoff-
nungsträger.
Alles könnte so schön sein, wäre da nicht die nach wie vor anhaltende
Kaufzurückhaltung − vor allem in Deutschland. Demgegenüber gehen
modernste Handys weg wie warme Semmeln, obwohl 90 % der
Nutzer nach glaubhaften Marktrecherchen damit „nur“ telefonieren.
Der Marketingtrick mit nahezu null Euro Anschaffungspreis und den
auf den ersten Blick günstigen laufenden Kosten funktioniert nach
wie vor. Wenn schon laufend neue Handys den Markt überschwem-
men, wo bleiben dann wirklich überzeugende Nutzwerte?
Alles schön bunt, was zugegebenermaßen die Display-Lesbarkeit
verbessert. Philharmonie-Sound statt Bimmeln sowie Biorhythmus-
Überwachung für die Damen − oh toll! Aber warum benötige ich zu
Hause ein weiteres Gerät, diesmal Schnurlos-Telefon genannt, wo
ein GSM-Handy bei entsprechender Firmware die DECT-Übertragung
ebenso beherrschen würde? Nebenbei bemerkt gabs das schon mal
bei den Franzosen und einigen anderen, doch leider verschwand
nach der IFA 2002 beispielsweise das „Dual Mode Phone“ von Sagem
mehr oder weniger in der Versenkung.
Und beim Amateurfunk? Nehmen wir den neuen IC-7800. Mit deutlich
über 9000 € wirklich kein Schnäppchen. Trotzdem sind die ersten
Geräte verkauft, selbst in Russland sollen schon einige in den Shacks
betuchter Funkamateure stehen.
Und ist denn der 40-dBm-IP3 des Icom-Flaggschiffs das Ende der
Fahnenstange? Nein. Der Transceiver mit der Seriennummer 020 hat
z. B. laut beiliegendem Messprotokoll sogar 42 dBm. Außerdem wird
Yaesu demnächst nachziehen. Zwar ist über den FT DX-9000 bisher
so gut wie nichts bekannt, dass er aber serienmäßig 500 W HF
machen wird, ist sicher. Indes sprechen beide nur einen kleinen
Interessentenkreis an.
Dabei gäbe es auch bei dem, was Tausende täglich hobbymäßig
nutzen, noch viel zu verbessern. Warum haben Afu-Handys keine Uhr
und keinen Kalender? Dabei gab es die Uhr Anfang der Neunziger
bereits. Die Frequenz steht im Display und könnte zusammen mit
dem über die Tastatur SMS-like einzugebenden Rufzeichen der Ge-
genstation eine erstklassige Logbuch-Funktion ergeben. Wo bleibt
die ausführliche Hilfe via Display? Welcher Hersteller führt zum Bei-
spiel endlich USB als Schnittstelle zwischen Funkgerät und PC ein?
Warum können wir unsere Handfunken noch nicht über Solarzellen
oder induktiv nachladen?
Wenn die Industrie will, dass wir neue Produkte kaufen, muss sie
innovative Nutzwerte für den Massenmarkt bieten. So wie z. B. ein
paar pfiffige Hams aus den USA mit APRS weltweit Packet-Radio
neues Leben eingehaucht haben und munter Tiny-Trak-Bausätze
verkaufen, während die Großen der Branche mit den Umsätze
unzufrieden sind!
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Spam, Würmer und kein Ende?
Das Internet ist nach meinem Dafürhalten die bedeutendste Erfin-
dung auf dem Gebiet der Informationsvermittlung, seit uns Guten-
berg den Buchdruck bescherte. Der Weg zum Bücherschrank bleibt
zunehmend erspart, findet man doch gesuchtes Wissen blitzschnell
via Google o. ä. Den Komfort der E-Mail-Schreiberei ist man inzwi-
schen so gewohnt, dass das Absenden eines Briefes in Papierform
zum Problem ausartet, weil sich die Briefmarken in die äußerste Ecke
des Tischkastens verkrümelt haben.
Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten: Besonders in letzter Zeit ge-
sellen sich zu dem beinahe als alltäglich abgehakten Spam mysteriö-
se Mails, die von plausiblen Absendern zu stammen scheinen, deren
textlicher Inhalt jedoch in keinem sinnvollen Zusammenhang zur
Realität steht. Wehe dem, der seine Neugier nicht zügeln kann und
die angehängte *.PIF oder wie auch immer heißende Datei anklickt.
(Im Hinblick auf die vorgenannten warnenden Anzeichen eigentlich
wider jede Vernunft…) Zwar explodiert weder die Festplatte noch
verschwinden, wie von Viren bekannt, Daten zuhauf, aber der eigene
PC entartet zur Mailschleuder und besudelt, vom Besitzer unbemerkt,
die Boxen zig weiterer Internet-Nutzer mit wurmgespickter Post.
So kann es beim besten Willen nicht weitergehen und es bleibt zu
hoffen, dass Provider und Softwaregiganten, die sich allesamt am
neuzeitlichen Informationsmedium eine goldene Nase verdienen,
hier in allernächster Zeit einen massiven Riegel vorschieben, zumal
Microsoft & Co. selbst eine beliebte Zielscheibe der elektronischen
Kriechtiere sind.
Aber was bleibt uns bis dahin? Den Internetanschluss abmelden?
Den Mailempfang gegen alles und jeden sperren? Zurück zu Keil-
schrifttafeln und Rauchzeichen? Wohl kaum. Mag vielleicht der eine
oder andere Laie dies als probates Mittel ansehen und sich in seine
Höhle zurückziehen, um wieder bei Fackellicht die verblasste Wand-
malerei anzustarren, aber wir Funkamateure sind aus anderem Holz!
Sind wir nicht schon immer mit den widrigsten Umständen klarge-
kommen, haben gefunkt, wo es eigentlich gar nicht gehen sollte,
und Geräte gebaut, ohne über passende Bauteile zu verfügen?
Unsere Findigkeit lässt uns Behörden und funkfeindlichen Nachbarn
trotzen, und die Pfiffigsten unter uns zeigen auch heute noch der
Industrie und Forschung, wo’s langgeht!
Wir freuen uns über technische Neuheiten und zählen stets zu den
Ersten, die diese kreativ nutzen. Da werden wir uns das lieb gewon-
nene Internet nicht von ein paar softwarekundigen Möchtegerns oder
Geschäftemachern vergällen lassen − zumal es sich inzwischen als
ein für den Amateurfunk außerordentlich hilfreiches Mittel zum Zweck
etabliert hat. Spamfilter, Virenschutzprogramme, Spion- und Dialer-
Finder gibts, zumindest für private Nutzung, gratis im Internet. Und
wer seinen PC auf Linux umstellt, braucht sich kaum vor einem Wurm
zu fürchten.
Nutzen Sie die vorhandenen Möglichkeiten! Der FUNKAMATEUR
wird Ihnen dabei nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite stehen;
schauen Sie dazu bitte auch hin und wieder auf unsere Website,
wo wir ggf. zeitnah Tipps geben können.
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Minus 12 dB
„Thanks QSO, best −12 dB“ − so, oder ähnlich, lauten neuerdings
häufig Kommentare im DX-Cluster, nachdem zwei Stationen eine
Verbindung im digitalen JT44/65-Mode auf den VHF- bzw. UHF-
Bändern durchführten. Da fragen sich etliche, was das wohl für
QSOs sind, bei denen man auf der Arbeitsfrequenz akustisch nur
Rauschen vernimmt, geschweige denn eine „Puseratze“ von der
Gegenstation hört. Ist das denn überhaupt noch als eine reale
Verbindung zu bewerten? Erinnern wir uns an Diplome, da wurde
auf den eingereichten QSL-Karten ein Mindestrapport von 339
gefordert! Und nun reichen −12 dB?
Dank Soundkarte und Software sind derartige Möglichkeiten ja
nichts Neues. Und digitale Übertragungsverfahren haben längst
Tradition, wie z. B. RTTY oder PSK belegen. Das menschliche Hirn
dekodiert die Signale zwar nicht, das Ohr nimmt sie jedoch noch
wahr. Und es tangiert inzwischen längst nicht mehr nur den UKW-
Bereich, auch auf den Längstwellenbändern geht ohne digitalen
Computerbeistand kaum etwas.
Was auch sein Gutes hat − dokumentiert diese Entwicklung immer-
hin, dass der technische Pioniergeist unter den Funkamateuren
längst nicht zu Grabe getragen ist!
Nachdem in den vergangenen Jahren das Programm WSJT die
Meteorscatter-Welt revolutionierte, gab es anfangs nicht unbe-
gründete Befürchtungen, dass es mittels dieses Programms zur
automatischen Abwicklung von QSOs in Abwesenheit des OPs
kommt. Dazu kam es jedoch nicht. WSJT allein führte zu einer bis-
her nicht da gewesenen Aktivitätssteigerung auf 2 m, inzwischen
ist auch außerhalb der großen Meteorschauer Betrieb fast rund
um die Uhr zu beobachten. Und davon profitieren doch wohl alle.
Auch diejenigen, die noch vor einigen Jahrzehnten mit Uher-
Tonband und 200 lpm ihre Verbindungen komplettierten, staunen
nicht schlecht, was nun so alles an Mittelfeldern aus den osteuro-
päischen Ländern vertreten ist.
Bleibt die Frage zur Wertung in der FUNKAMATEUR-Top-Liste.
Es gab nicht wenige Stimmen, die meinten, dass die mit Hilfe rein
digitaler Betriebsarten erreichten Locatoren bzw. DXCC-Gebiete
getrennt zu führen sind. Andere hingegen gingen sogar so weit,
JT44/65 usw. überhaupt nicht für die Liste zu werten.
Wir haben uns jedenfalls entschlossen, künftig keine separaten
Listen für Digimodes, Fonie, CW usw. in der FUNKAMATEUR-
Top-Liste einzuführen. Das Verfahren ist ganz simpel: Stationen,
die Digimodes benutzt haben, werden in den kommenden Listen
fett gedruckt und so kenntlich gemacht. Wir hoffen, damit
annähernd allen gerecht zu werden − sowohl den analogen Puris-
ten, den Soundkarten-Funkern als auch denen, die nur über die
erreichten Felder staunen.
vy 73
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Auf dem richtigen Weg
Vom Beginn der Initiative des Jugendjahres 2003 in Thüringen und
der Motivation, mehr als bisher Jugendlichen den Amateurfunk nahe
zu bringen, war schon im Editorial des FA 8/2002 die Rede. Diese
eher unkonventionelle Herangehensweise an die Nachwuchsproble-
matik fand die besondere Unterstützung des FUNKAMATEUR und
vieler Gleichgesinnter, die uns mit ihren Spenden und tatkräftiger Hilfe
aus der unverschuldeten Finanzkrise geholfen haben. Dafür allen ein
herzliches Dankeschön.
Die Ortsverbände Thüringens sprachen sich schließlich auf ihrer
Distriktsversammlung im Herbst 2002 einhellig dafür aus, diese Initia-
tive über den eigentlich nur für das Jahr 2003 gedachten zeitlichen
Rahmen hinaus fortzusetzen. Dabei wurden unsere Bestrebungen
besonders vom Thüringer Kultusministerium mit einem Brief an alle
Schulen unterstützt, in dem Lizenzkurses für Lehrer als offizielle Fort-
bildung anerkannt werden.
Am Ende des Jahres 2003 haben wir die Ergebnisse saldiert und uns
auch kritisch über Nichterreichtes Gedanken gemacht. So wendeten
die Ortsverbände Thüringens viel Mühe für Ausbildung und Wett-
bewerbe auf. Als Ergebnis können wir 0,7 % Wachstum verzeichnen
und ein funktionierendes Vereinsleben aufweisen. Vor dem Hinter-
grund dramatischer finanzieller und personeller Verluste im DARC
sind diese Leistungen besonders zu würdigen. Sie zeigen auch wie
wichtig es ist, alle Initiativen für eine vernünftigen Entwicklung aus-
reichend finanziell zu begleiten.
Als Ergebnis können wir daher im Jahr 2003 vier neue DN-Rufzeichen
für Ausbildungsgruppen verzeichnen, die unter anderem die Möglich-
keit bieten, im Rahmen öffentlicher Repräsentationen aktiv zu werden.
Mit Stand Dezember haben sich 82 Teilnehmer erfolgreich einer Ama-
teurfunkprüfung unterzogen. Als Resultat unserer gemeinsam mit dem
Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule e.V.
(AATiS) gestarteten Initiative zur Gründung von Schulfunkstation, ver-
sprechen sechs Kontakte zu Schulen in unserem Bundesland Bestand
zu haben. Mit einem Kompaktkurs für Lehrkräfte in Kooperation mit
dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung
und Medien (Thillm) im April 2004 wollen wir als nächsten Schritt das
Standbein in den Schulen weiter entwickeln und auch das Angebot
an Veranstaltungen dort diesbezüglich anreichern.
Nach unserer Überzeugung sind besonders die Schulen der Pool, aus
dem wir Mitglieder gewinnen und jungen Menschen wichtige Kennt-
nisse für das Leben vermitteln können. Das positive Ergebnis des
Jugendjahres 2003 in Thüringen resultiert aus dem Engagement der
Ortsverbände für Jugendliche, besonders an Schulen und im Zusam-
menwirken mit Lehrkräften.
Vom schweren Anfang im Jahr 2002 sind wir schon ein gutes Stück
weit weg. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam auf diesen und ähn-
lichen Wegen die Jugend für unser Hobby begeistern.
Gerhard Wilhelm, DL2AVK
Distriktsvorsitzender Thüringen im DARC e.V.
Nachwuchsprobleme selbst lösen
Kürzlich erhielt ich eine E-Mail, in der mir ein OM seine Sorgen um
den Nachwuchs mitteilte. Nicht, dass er sich um sinkende Mitglieder-
zahlen und rückläufige Beitragseinnahmen seines Vereins sorgte −
ihm ging es um den Amateurfunk ganz allgemein.
Zur Lösung des Problems schlug er vor, in einer der großen PC-Zeit-
schriften eine mehrteilige Serie über den Amateurfunk zu veröffent-
lichen. Ziel der Aktion sollte sein, das Interesse bei Leuten zu wecken,
die von unserem Hobby bisher wenig oder nichts wissen. Eigentlich
ein gangbarer Weg. Man müsste nur noch einen Chefredakteur ken-
nen, der dafür Platz zur Verfügung stellt und keine Probleme darin
sieht, etwas zu drucken, was seine Stammleser eher nicht erwarten.
Aber was käme danach? Wenn also jemand eine E-Mail an den
DARC schickt oder in Baunatal anruft, um zu erfahren, wo er
Funkamateure treffen oder sich einfach nur informieren kann?
Gehen Sie einmal in sich und versuchen Sie, diese Frage für sich
zu beantworten. Gibt es in Ihrer Stadt oder in der Nähe einen
Anlaufpunkt, wo Sie jemanden hinschicken würden und sicher sein
könnten, dass Neugier dort in Begeisterung umschlägt?
Mag sein, dass sich der harte Kern eines Ortsverbandes einmal im
Monat in einem Lokal trifft, weil man sich eigene Räume nicht leis-
ten kann oder will. Was aber hat ein aufgeschlossener junger Mensch
dort verloren, wo ältere Herren beim Bier über Selbsterklärungen
sinnieren, sich mit Q-Gruppen verständigen oder über nicht enden
wollende Schwierigkeiten mit Windows klagen?
Ist denn Ihr Ortsverband auf jenen wünschenswerten Fall vorbereitet,
dass ein 14-Jähriger spontan bei Ihnen auftaucht und Funkamateur
werden möchte? Haben Sie im OV jemanden, der seine Freizeit auf-
wenden würde, Lust hätte und fähig wäre, sich eines oder mehrerer
Newcomer anzunehmen? Können Sie aus dem Stand heraus Ausbil-
dungsfunkbetrieb machen? Wahrscheinlich nicht. Und insofern kann
man fast froh darüber sein, dass dieser junge Mensch nicht in der Tür
gestanden hat und also auch nicht enttäuscht von dannen zog …
Wer über nicht vorhandenen Nachwuchs klagt, muss die Vorausset-
zungen zu dessen Förderung schaffen!
Besser sind die Chancen, wenn man direkt auf Kinder und Jugendliche
zugeht. Als Lehrer beispielsweise, der im Unterricht das Interesse
für Elektronik und Funktechnik weckt. Wenn ein Lehrer selbst Funk-
amateur ist, er den Schülern die Faszination und die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Amateurfunks erläutern kann und in der Schule Räume
zur Verfügung stehen, kann sogar ein Einzelner viel erreichen.
Insofern betrachte ich den AATiS e.V. mit seinen über 500 Mitgliedern
als Hoffnungsträger. Keine Arbeitsgruppen und Krisenstäbe, sondern
täglicher Kontakt zum potenziellen Amateurfunknachwuchs. Und
weil jedes AATiS-Mitglied so ein Multiplikator ist, unterstützt der
FUNKAMATEUR diesen Verein gern. Daneben bieten wir Schülern
und Studenten auch weiterhin besonders günstige Abonnements.
Viel Erfolg im Jahr 2004, besonders bei der Nachwuchsgewinnung!
Ihr
Knut Theurich, DGØZB
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Zukunft sichern!
1987 begann in der EU die Diskussion über die Liberalisierung des
Telekommunikationsmarktes. Ab 1989 folgte die Reform des Post-
und Fernmeldewesens in Deutschland in drei Stufen, dabei wurden
vor allem die unternehmerischen Aufgaben (Postdienst, Postbank,
Telekommunikation) und die hoheitlich regulierenden Ausführungs-
aufgaben voneinander getrennt. Zeitgleich gab die EU Richtlinien
zur Einführung des vollständigen Wettbewerbs auf dem Markt für
TK-Dienste heraus, um die Aufhebung von Monopolen zu erreichen.
Der TK wird eine Schlüsselrolle für die Entwicklung und internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland bzw.
Europa beigemessen.
Auf der Basis von EU-Richtlinien entstanden einige nationale Gesetze.
Das TKG ersetzt das FAG und das FTEG verlagert das behördliche
Zulassungsverfahren für TK-Endgeräte in die Konformitätserklärung
der Hersteller und Importeure (CE-Kennzeichen). Nach Jahrzehnten
präventiven Funkschutzes vollzieht sich damit ein Wandel mit erheb-
lichen negativen Auswirkungen für alle Funknutzer. Nach EMVG § 3
Abs. 2 „vermutet“ der Gesetzgeber, dass bei Einhaltung von „Grenz-
werten“ das Schutzziel normalerweise erreicht wird. Tritt trotzdem eine
Störung auf, so gilt EMVG § 3 Abs.1, und die Störung muss beseitigt
werden. Aus Kapazitätsgründen kann die RegTP immer weniger prä-
ventive Prüfungen vornehmen. So wird zunehmend erst im Störungsfall
kontrolliert und korrigierend eingegriffen. Jede Störung des Funkemp-
fangs sollte daher sofort schriftlich bei der RegTP gemeldet werden!
Die fehlende Funkverträglichkeit der störstrahlenden Power-Line-Com-
munication (PLC) ist der EU-Kommission bekannt. Trotzdem betrachtet
sie PLC als Alternative zum bisherigen Leitungsmonopol auf der „letzten
Meile“ (Access-Bereich). Für den In-Haus-Bereich gibt es mehrere
Lösungen, also kein Monopol! In-Haus-PLC wird daher, trotz großer
Verbreitungsgefahr, von der EU-Kommission kaum beachtet.
Bei einem PLC-Workshop der Europäischen Kommission am 16. Okto-
ber forderten teilnehmende Fernmeldeverwaltungen den Schutz der
Funkdienste ein. Die Behauptung der PLC-Betreiber, es gäbe europa-
weit keine Funkstörungen durch PLC, wurde durch mehrere nationale
Verwaltungen widerlegt. Schriftliche Stellungnahmen zu PLC, die die
EU-Kommission von vielen Institutionen erhielt, sind im Internet unter
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/enterprise/tcam/library?i=/
emcstandardisationsmand/stakeholdersinputs&vm=detailed&sb=Title
öffentlich zugänglich.
50 Jahre Amateurfunklizenz lassen mich von der alten Zeit auf stö-
rungsarmen Kurzwellenwellenbändern träumen. Liberalisierung und
Deregulierung der Telekommunikation nehmen inzwischen verstärkt
auf den Amateurfunk Einfluss. Technisch determinierte Argumenta-
tion fand bei Politik und Verwaltung bisher wenig Berücksichtigung.
Bei der Behandlung von Störfällen scheint die RegTP nach internen
Anweisungen zu arbeiten, die nicht mit der gültigen Rechtslage in der
BRD übereinstimmen. Deshalb gilt es verstärkt auch andere Wege zu
beschreiten, um weiter den vom Gesetzgeber gewollten Experimen-
talfunkdienst für uns und den naturwissenschaftlich interessierten
Nachwuchs zu erhalten.
Horst-Dieter Zander, DJ2EV
Das Handy und der FUNKAMATEUR
Viele Leser werden den Titelbeitrag der vorigen FA-Ausgabe „Mit
dem Mobiltelefon ins DX-Cluster“ mit großem Interesse gelesen haben.
Wir waren in der Redaktion ja selbst erstaunt, wie man ein an sich
amateurfunkfeindliches, aber bei nahezu jedem Funkamateur vor-
handenes Handy dazu überreden kann, unseren Zwecken dienstbar
zu sein. Gerade angesichts der von Flachbildfernsehern und Handys
hoffnungslos überfrachteten IFA 2003 fanden wir das Thema so toll,
dass wir ihm sogar das Titelbild widmeten.
Umso gespannter waren wir auf das Echo aus der Leserschaft, das
indes geteilt ausfiel. Neben begeistertem Lob wurden Stimmen laut,
die auf die Gefahren im Hinblick auf die Bandverteidigung hinwiesen,
die daraus resultierten, wenn sich Funkmamateure nun über ein kom-
merzielles Medium anstatt beispielsweise über das mancherorts recht
dichte 70-cm-POCSAG-Netz informieren würden.
Freilich lassen sich auch mit einem umgebauten Pager DX-Spots via
SAMS empfangen! Nicht zuletzt hat der FUNKAMATEUR seinerzeit
durch Veröffentlichung des Beitrags von Oliver Durm, DL3SDW, und
Michael Amman, DL8SDJ, in den FA-Ausgaben 2 und 3 des Jahres
2000 maßgeblich zur bundesweiten Verbreitung des SAMS-Fiebers
beigetragen − Aktuelles dazu findet sich übrigens unter:
www.durm-online.de/pag100.htm
Den Betreibern dieses Projekts sei an dieser Stelle höchste Aner-
kennung für ihren engagierten Einsatz gezollt! Andererseits kann
man sich doch genauso gut via Packet-Radio über die aktuell laufen-
de DX-Szene informieren, und wer zu Hause DSL hat, lässt vielleicht
das OH2AQ-Internet-Cluster ständig durchlaufen. Wieder andere
picken die gesuchten Rosinen nach wie vor beim Übers-Band-
Drehen heraus oder beziehen ihre Tipps per „OV-Telefon“. Alles sind,
wie auch das Handy, Mittel zum Zweck − dem DXen! Zudem
hat manch einer vielleicht gar keinen Bock darauf, sich für einen
Feif-Nein/Feif-Nein-Quickie stundenlang anzustellen und klönt
derweil gemütlich mit Wien, Madrid oder New York.
Aber es ist doch gerade das Schöne an unserem Hobby, dass sich
jeder genau das auswählen kann, was ihm Spaß macht! Naja −
sofern einem dieser nicht durch Bandvermüllung via PLC oder PCs,
antennenfeindliche Vermieter, HF-sensitive Nachbarn und Selbst-
anzeige-Rummel vergällt wird, aber lassen wir das mal für heute…
Redaktion und Verlag sehen es als Ziel an, Ihnen, liebe Leser, das
weite Feld des Amateurfunks bzw. des Elektronikhobbys in aller Viel-
farbigkeit nahe zu bringen und Sie mit vorwärts weisenden Entwick-
lungen vertraut zu machen − wohl in Kauf nehmend, dass niemals
jeden Leser alles interessieren wird und dieser oder jener seine
persönlichen Vorlieben ganz woanders sieht.
In diesem Sinne dürfen Sie sich weiterhin auf spannende und
bisweilen durchaus brisante Themen in unserer Zeitschrift freuen,
wie etwa Auroravorhersage mit einem einfachen, mikrocontroller-
gestützten Magnetometer in der vorliegenden Ausgabe oder
KW-Funk übers Internet in der nächsten.
73 / awdh
Ihr
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Herzlich willkommen auf KW!
Nein, ich bin kein so alter Hase, dass ich die langwierige und lang-
weilige Diskussion um CW als Zugangsvoraussetzung von Anfang
an hätte mitverfolgen können. Die vergangenen Jahre und der Blick
in ältere Zeitschriften zeigen mir aber, dass sie immer wieder hoch-
kochte. Zum Glück ist dies in Zukunft vom Tisch, auch wenn
bestimmt einige ihren Verbänden noch eine Weile ihr Leid klagen
werden.
Klar stellt CW eine einfache Methode zur Informationsübertragung
dar. Sehe ich mir aber die in der letzten Zeit entwickelten digitalen
Verfahren an, so kommen mir Bedenken über die angebliche „Elite-
betriebsart“. Heute sind auch noch Verbindungen möglich, bei denen
ich mit meinem CW-Filter zwischen den Ohren nichts mehr aus der
Grasnarbe herausfischen kann. Warum also sollte man Telegrafie
erzwingen? CW wird nicht aussterben − dafür sorgen schon die
Anhänger dieser Betriebsart und die vielen Gruppen, die sich der
Förderung des Tastfunks widmen.
Wenn jemand nun als Grund für Vorurteile anführt, die bisherigen
Klasse-2-Inhaber hätten keine Ahnung von der Technik, so liegt er
sicher falsch. Sehen Sie sich einmal die Prüfungsfragen an − Sie
werden keine Unterschiede feststellen. Bevor also jemand ein Ama-
teurfunkgerät, egal für welchen Frequenzbereich und welche
Betriebsart nutzen darf, sind die gleichen technischen und betriebs-
technischen Hürden zu überwinden.
Und so einfach sind die sehr kurzen Wellen auch nicht zu beherrschen.
Haben Sie sich als KW-Anhänger z. B. mal Gedanken um die Aktivie-
rung eines Gigahertz-Bandes gemacht? Da muss man beim Bauen
schon viel Erfahrung haben, sonst entpuppt sich eine Drahtbrücke
schnell als Dämpfungsglied…
Nun werden die technischen Hürden nicht nur beim Übergang auf die
höheren Bänder auftreten. Auch in umgekehrter Richtung ist die gegen-
seitige Hilfe aller Zeugnisklassen untereinander nötig. Wir versuchen
im FUNKAMATEUR, durch Publikationen unseren Teil dazu beizutragen,
den KW-Einstieg für Interessierte zu erleichtern. Ich schreibe bewusst
Interessierte, denn die Umfrage auf www.funkportal.de ließ deutlich
werden, dass sich der Ansturm in Grenzen halten wird.
Allen Umfragen zum Trotz melden Hersteller nach der WRC 2003 den
rasanten Anstieg beim Absatz von KW-Transceivern. Warum wohl?
Bestimmt nicht als Rachefeldzug der bisher Ausgegrenzten gegen
die Platzhirsche auf der kurzen Welle, denen sie nun endlich ein Loch
in die Ionosphäre brennen können.
Wie oft saßen Sie selbst an der Station und die CQ-Rufe verhallten
unbeantwortet? Scheinbar sind wir übersättigt und nicht immer offen
für Neues und Neugierige. Obwohl ich ein KW-Rufzeichen benutze,
habe ich nichts gegen eine mögliche Belebung der Kurzwellenbänder
durch 33 000 Funkamateure in Deutschland und begrüße die nach
und nach aus anderen Ländern eintreffenden Meldungen zur Ab-
schaffung der Telegrafie als Zugangsvoraussetzung für die Kurzwelle.
Bis bald auf KW!
Ingo Meyer, DK3RED
Weshalb funkt ihr denn noch?
Hand aufs Herz, macht das denn heute noch irgendeinen Sinn?
Es gibt doch den Chat im weltweiten Internet, Telefon und Handy
sind vorhanden, und ihr müht euch weiterhin auf gestörten Frequen-
zen mit kaum verständlichen Signalen, womöglich noch mit selbst-
gebauten Geräten und Antennen ab?
Diese Frage haben wir in den letzten Wochen vielen Funkamateuren
gestellt und damit bei einigen wohl fast einen Schock ausgelöst. Sind
Danielo, DL7TA, der einmal pro Woche in 340 Metern über Grund
an seinem Relais bastelt, und Peter, DL2FI, dessen kaum zählbare
QRP-Geräte im Hintergrund lachen, zu Zweiflern geworden? Sind
wir nicht: Die Frage gehört zur Vorbereitung unserer Funkausstellung.
Ja, unsere Funkausstellung, nicht die IFA 2003. Die findet nur zum
selben Zeitpunkt in den Messehallen am Funkturm statt. Wir machen
eine eigene Funkausstellung mitten im Herzen Berlins auf dem Alexan-
derplatz. Im Fuß des Fernsehturms, wo uns der Berliner Fernseh-
sender TVBerlin ein Studio für die Dauer der IFA überlassen hat, sind
wir live und zum Anfassen. Dort werden wir an allen Messetagen von
früh bis spät den Berlin-Besuchern und den Berlinern zeigen, was
unser Hobby jedem Einzelnen von uns auch im Zeitalter von Handy
und Internet geben kann.
Funk, um sich in der Freizeit verwirklichen zu können. Funk, um mit
Hilfe der Wellen der Isolierung zu entfliehen, grenzenlos, zeitlos, hand-
gemacht. Funk als Bildungsmedium, Funk als Experimentierfeld, Funk,
um Freunde zu finden. Ohne Spam, ohne Werbebanner und ohne
Provider, handgestrickt und selbst bestimmt. Nach vielen Gesprächen
haben wir uns entschieden, besonders die menschliche Seite des
Amateurfunks herauszustellen.
Natürlich geht es auch bei unserer Funkausstellung nicht ohne Tech-
nik ab, sie wird jedoch auf die Stufe gestellt, die ihr zusteht: Mittel
zum Zweck. Letzterer besteht darin, unsere Freizeit sinnvoller ge-
stalten zu können, das Mittel dazu sind die Funkgeräte und alles
drum herum. Gekauft oder selbstgebaut, auf der kurzen Welle oder
im Gigahertz-Bereich. In steinalter, aber zuverlässiger Morseschrift
bzw. mit modernster Digitaltechnik − es geht letztlich doch nur
darum, sich selbst Freude zu bereiten. Und diese Freude wollen wir
Macher den Besuchern vermitteln.
Besucher sind alle, die dieses Hobby noch nicht kennen, Macher sind
alle, deren Hobby der Amateurfunk ist. Ihr Berliner Funkamateure
und Funkamateure zu Besuch in Berlin! Ihr AATiS- und TJFBV-Leute,
ihr Lehrer, die ihr Spaß daran habt, Kindern und Jugendlichen die
Elektronik nahe zu bringen. Ihr Satellitenerbauer von der AMSAT, ihr
DXer und Contester, die ihr euer Funkhobby als Hochleistungssport
betreibt. Ihr „Um-die-Ecke-Funker“ vom 70-cm-Relais. Aber auch ihr
CB-Funker, die ihr das Funkhobby mit anderen Mitteln betreibt:
Macht mit bei der Funkausstellung der Funkamateure vom 29. 8. bis
3. 9. 2003. Seid mit uns gemeinsam präsent und erzählt den Anderen
etwas darüber, was für euch den Amateurfunk so liebenswert macht.
Jeden Abend ab 18 Uhr können wir anschließend gemeinsam im
Restaurant „Alex“ am Funkerstammtisch sitzen und fachsimpeln.
Wir sehen uns auf der Funkausstellung der Funkamateure!
DARC Berlin, Distriktsvorstand
Erfreuliches im Sommerloch
Es ist entschieden. Bei der WRC in Genf ist die CW-Hürde für den
Zugang zu den Kurzwellenamateurfunkbändern gefallen. Die Arbeits-
gemeinschaft Grundsatzfragen des DARC setzt sich dafür ein, dass
dies in Deutschland so schnell wie möglich in nationales Recht um-
gesetzt wird. Sie forderte bereits die Reg TP auf, den Klasse-2-In-
habern bis zu einer endgültigen Regelung den Zugang zur Kurzwelle
zu ermöglichen.
Ebenso unsere Schweizer Nachbarn: Dank des guten Verhältnisses
der USKA zur nationalen Kommunikationsbehörde werden dieser
Tage in der Schweiz Klasse 1 und 2 provisorisch egalisiert, und das
noch bevor die gesetzlichen Regelungen erlassen sind. Ähnliches
dürfte, wenn Sie diese Zeitschrift in den Händen halten, auch in
Großbritannien zum Tragen gekommen sein.
Ich kann all jene gut verstehen, die sich gern eine gewisse Exklusivi-
tät des weltweiten Funkens bewahren möchten. Schließlich haben sie
einmal mühsam CW gelernt und beherrschen es vielfach mit benei-
denswerter Perfektion. Aber bedeutet es denn das Ende des zivilisier-
ten Amateurfunks, wenn der Klasse-2-lizenzierte OM Mustermann
demnächst als DB1something auf 20 m in SSB CQ ruft? Durfte er
nicht schon längst via Satellit oder Mondecho rund um den Globus
funken? Und will ihm etwa jemand unterstellen, er könne sich die
SSB-Bereiche der einzelnen Bänder nicht merken?
Wer ist denn überhaupt sicher, dass die meisten oder gar alle Klasse-
2er tatsächlich auf die KW-Bänder kommen? Schließlich stehen da
nicht nur Antennen- und Selbsterklärungsprobleme im Wege. Eine
kostspielige Angelegenheit ist es obendrein, auf Kurzwelle QRV zu
werden. Und vielleicht will es der eine oder andere auch gar nicht.
Last but not least gibt es unter den UKW-Amateuren genügend Vo-
rreiter der Technik, die echten Experimentalfunk betreiben, indem sie
mit neuen Verfahren Signale aus dem Rauschen zaubern, in neue,
höhere Frequenzbereiche vorstoßen, Antennen erproben, ihr Equip-
ment auf Berge schleppen oder zu Land wie auch zu Wasser neue
Großfelder aktivieren. Geht da oft nicht viel mehr ab als in so man-
chen Klönrunden auf 80 oder 40 m?
Ich habe am 4. und 5. Juli ein paar Stunden am 2-m-Contest teilge-
nommen und dabei erstaunlich viele DOs geloggt. Durchweg flotter
Betrieb, alle auf den „richtigen“ Frequenzen und keiner von denen hat
mir den Empfänger zugestopft. Das waren andere…
Unbelehrbare gibt es in allen Lizenzklassen, und man kann ja auch
mal nett auf einen Fehler hinweisen, vielleicht sogar per Telefon,
E-Mail oder Postkarte, anstatt Leute auf dem Band wegen unbedeu-
tender Verfehlungen öffentlich zur Entschuldigung oder Erwiderung
aufzufordern.
Mir scheint, es ist im Interesse unseres Hobbys an der Zeit, alte
Vorurteile über Bord zu werfen. Betrachten wir es einfach als
Bereicherung für alle, wenn bald ein paar ungewohnte Präfixe auf
den KW-Bändern mitmischen!
Awdh, vielleicht auch mal auf 40 m.
Knut Theurich, DG0ZB
Gelegenheit zum Handeln
Wenn der DARC binnen Jahresfrist rund 2000, also 4% seiner 50 000
Mitglieder verloren hat, dann ist das mehr als bedenklich. Gleich, wo-
durch dieser Schwund verursacht wird, macht auch uns das betroffen,
deutet er doch auch auf eine nachlassende Begeisterung für den
Amateurfunk hin. Der Mitgliederrückgang ist von uns praktisch nicht
zu beeinflussen, die Erhaltung des Interesses schon, denn der Ama-
teurfunk ist ein sehr vielschichtiges Hobby, für dessen Fortbestand
der Verlag tätig ist. Deshalb sehen wir es als unsere Aufgabe an, den
alten und jungen Funkamateuren zumindest einen Teil der Dinge zur
Verfügung zu stellen, die sie für ihre Freizeitbeschäftigung brauchen.
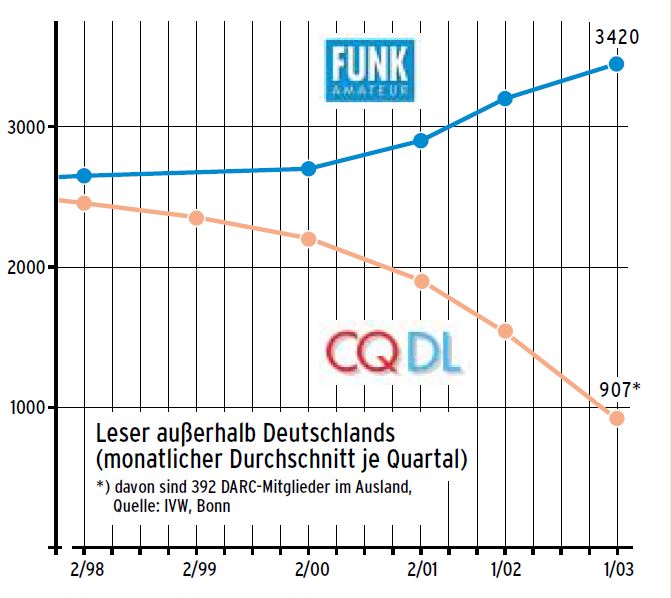
Dass uns dies mit der Zeitschrift, unserem Leserservice und dem für
ausgezeichnete Qualität bekannten QSL-Shop ganz gut gelingt, wird
unter anderem durch einen Vergleich der Verkaufszahlen der beiden
führenden deutschen Amateurfunkzeitschriften im Ausland belegt.
Die Zeitschrift hat für uns jedoch eine weitere Dimension. Und so haben
wir mit dem Betreiberunternehmen der Website www.funkboerse.de
vor wenigen Tagen einen langfristigen Vertrag unterzeichnet, der un-
seren Abonnenten auch in Zukunft die kostenlose Nutzung dieser belieb-
ten und auf Amateurfunk und Elektronik spezialisierten Internetplatt-
form ermöglicht.
Wer sich mit seiner Abo-Nummer und Postleitzahl angemeldet hat
oder noch anmeldet, kann also auch künftig nach Herzenslust kaufen,
verkaufen, versteigern und ersteigern. Es gibt kein Limit für die An-
zahl der Online-Inserate, wenngleich die Betreiber dann doch eingrei-
fen, wenn einzelne nicht Maß halten können und z. B. einen älteren
Scanner gleichzeitig in den Rubriken Empfänger, KW-Geräte, UKW-
Geräte und Oldie-Radios anbieten. Multiposting müllt den Online-
Marktplatz zu! Ansonsten fallen für unsere Abonnenten bei der Funk-
börse weder Einstellgebühren, Verkaufsprovisionen oder Extrakosten
für das Uploaden von Bildern an. Die Funktion zur Übernahme von
Anzeigen in den Kleinanzeigenteil des FUNKAMATEUR ist fast voll-
ständig automatisiert und erfordert die Beachtung der deutschen
Rechtschreibung. Vollständig in Großbuchstaben verfasste Texte
oder mit HTML-Code aufgepeppte fallen leider durch.
Wer nicht zu unseren Abonnenten gehört, kann sich wie bisher bei
der Quickweb GmbH gegen eine Gebühr von 6 Euro für ein Jahr
registrieren lassen und den Online-Marktplatz nutzen.
Die FUNKAMATEUR-Abonnenten bitte ich, ihren Gratiszugang zur
Funkbörse als freiwillige und kostenlose Zugabe des Verlages zu
ihrem Abo zu betrachten, die nicht Bestandteil des Abonnement-
vertrages ist.
Dann also viel Spaß beim Handeln an der „Börse“
Ihr
Knut Theurich
„Hello“ und „good bye“
„Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die Zeit − wir laufen mit ...“
Genau acht Jahre sind vergangen zwischen meinem ersten „hello“
beim FUNKAMATEUR und nun meinem „good bye“ an dieser Stelle.
Wow, eine ganz schön lange, gemeinsame Wegstrecke war das, die
wir da miteinander geschultert haben, stimmts? Doch nach sechs-
undneunzig aktiv mitgestalteten Ausgaben unseres Magazins warten
jetzt ganz neue, spannende Herausforderungen auf mich.
Ich sehe das mit einem weinenden und einem lachenden Auge.
Weinend, weil ich mich dem FUNKAMATEUR bereits seit frühester
Jugend, erst als neugieriger Hobbybastler und Funkempfangsamateur,
viel später dann als Redakteur, sehr stark verbunden fühle. Mit einem
lachenden Auge, weil man die Zukunft immer als persönliche Chance
begreifen sollte. „Per aspera ad astra“ sozusagen.
Deshalb möchte ich mich hier und heute ganz herzlich für Ihr auf-
merksames Interesse als Leser bedanken. Den vielen Autoren, die
ich während dieser langen Zeit betreut habe, wünsche ich noch eine
ganze Menge origineller Einfälle für weitere neue Beiträge und Bastel-
projekte, ganz so, wie ich es damals in meinem „Einstands-Leitartikel“
zum Ausdruck gebracht habe: „Es kommt darauf an, möglichst pfiffige
Ideen zu entwickeln, die bei Einsteigern wie bei ,alten Hasen‘ den Spaß
am Basteln und Experimentieren wachhalten…“
Viele neue Ideen konnte ich selbst während der vergangenen acht
Jahre umsetzen. Denken Sie zum Beispiel an die Restrukturierung der
damals sehr stark frequentierten FA-Telefonmailbox oder an den Auf-
bau der Internetpräsenz unseres Magazins. Seitdem sind wir für Sie
nur noch einen Mausklick entfernt und Sie können uns vom heimischen
Schreibtisch aus Ihre Meinungen und Anregungen übermitteln, Ihr
FA-Abonnement bestellen oder Bausätze und Literatur online ordern.
Vielleicht findet sich ja auch in Ihrer Softwaresammlung eine der Mail-
box-CD-Versionen, die Ihnen die geballte Ladung unserer AFU- und
Elektroniksoftware auch „offline“ verfügbar gemacht hat. Arbeiten Sie
eventuell noch heute mit der „QSL-Routes“-Software, recherchieren
Sie menügeführt am PC-Monitor die „historischen“ Ausgaben des
englischen SPRAT-Journals oder bestellen Ihre QSL-Karten über
unsere Silberscheibe mit der QSL-Shop-Bilddatenbank? Ich denke,
da bleibt doch so einiges an realisierten Projekten bestehen, die aus
anfänglichen fixen Ideen heraus entstanden sind und später Gestalt
angenommen haben.
Letztlich gilt jedoch auch für den genialsten Einfall: 10 Prozent sind
immer Inspiration, die restlichen 90 Prozent machen Transpiration aus.
Lassen Sie es also nicht bei bloßen Gedankenspielen bewenden.
Engagieren Sie sich weiterhin so aktiv wie bisher an der inhaltlichen
Gestaltung des FUNKAMATEUR. Das wird besonders für mich per-
sönlich künftig eine so richtig interessante Sache, denn bis zu dieser
aktuellen Ausgabe wusste ich ja leider immer schon vorher, was drin
steht… ;-)
Also: Enttäuschen Sie mich nicht! Ich werde auch als Leser stets ein
aufmerksames Auge darauf haben.
Ihr
Dr.-Ing. Reinhard Hennig, DD6AE
Innovationen − nicht nur von der Rolle
Kürzlich wandte sich eine Hygieneartikel-Firma per E-Mail mit einer
von ihr als innovativ bezeichneten Idee an potenzielle Kunden − dem
Toilettenpapier-Abo. Nach dem Motto: Die optimale Menge Toiletten-
papier kommt automatisch frei Haus. Immer rechtzeitig. Ohne dass
man sich kümmern muss. Mit Probe-Abo. Also kein Haken dran.
Beispiele, zu welchen Innovationen hingegen die weltweite Gemeinde
der Funkamateure fähig ist, finden Sie nicht nur in dieser Ausgabe
des FUNKAMATEUR. Und wie vielfältig sich dabei die Spannweite
der Betätigungsfelder darstellt, ist ebenfalls beeindruckend. Da wird
einerseits mit einer schweren Drahtrolle auf dem Rücken durch den
sibirischen Winter gestapft, um mehrere Kilometer Litze für eine
Antenne auszulegen, die es ermöglichen soll, auf 136 kHz mit einer
Strahlungsleistung von wenigen Watt eine Verbindung mit einer
Amateurfunkstation im 10 000 km entfernten Neuseeland herzustellen.
Gehört hat man sich jedenfalls schon. Wie, lesen Sie im VLF-/LF-QTC
auf Seite 523.
Andererseits befassen sich Funkamateure der AMSAT-Gemeinde in
Zusammenarbeit mit der US-Weltraumbehörde NASA damit, voran-
gegangene Pleiten durch verloren gegangene Marssonden zukünftig
mittels zuverlässigerer Funkverbindungen vermeiden zu helfen. Wenn
die Marsmission, nach erfolgreich verlaufenden Kommunikationstests
im Jahre 2005 dann 2007 endgültig startet, wird es sicher etliche
unter uns geben, die ihre Antennen- und Empfangsanlagen auch über
Distanzen von einigen Millionen Kilometern ausprobieren wollen.
Wie gut es digital im VHF-Bereich zwischen Erde–Mond–Erde funk-
tioniert, ließ uns schon jetzt K1JT, der Physik-Nobelpreisträger unter
uns funkenden „Amateuren“, mit seiner FSK441-Software für die
Soundkarte des Computers wissen. Mit dem JT6M-Modus holt er
nochmals 10 dB schwächere Signale aus der „Versenkung“. Dass
die ausgestrahlten Signale dabei oftmals fürs menschliche Ohr im
Rauschen nicht mehr hörbar sind, stört wohl relativ wenige. Einige
fragen sich allerdings, ob zum Funkbetrieb im herkömmlichen Sinn
nicht auch ein hörbares Signal gehört…
Erstaunlich ebenso, was der Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommu-
nikation in der Schule (AATiS), neben vielen anderen interessanten
Projekten, auf die Beine stellt: Mit SAFIR-M schickten sie vor vier
Monaten sogar einen neuen Satelliten ins All. Unter dem Rufzeichen
DP0AIS dient er vorrangig als digitaler Umsetzer und Speicher bei
Schulprojekten, z. B. für überregionale geophysikalische Experimente
sowie im Telematikbereich.
Neben vielem anderen kommt eventuell ein weiteres Betätigungsfeld
hinzu: Ausbreitungsversuche zwischen dem anspruchsvollen Lang-
wellenbereich bei 136 kHz und dem so genannten Top-Band von
1,8 MHz − es geht um die Zuteilung eines bis zu 10 kHz breiten Fre-
quenzbereichs zwischen 470 und 490 kHz an den Amateurfunk.
Schon mit den wenigen hier aufgezeigten Möglichkeiten im Bereich
der neuen Medien sollte man auch in der Öffentlichkeit im Sinne der
Nachwuchsgewinnung werben können. Der FUNKAMATEUR bemüht
sich, dabei weiterhin behilflich zu sein.
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Mathe und Physik nicht gefragt?
Der FUNKAMATEUR versteht sich als ein vielfarbiges Magazin zu allen
Themenbereichen rund um Amateurfunk, Elektronik und Computer. Nun
sind dies alles anspruchsvolle und vor allem technisch determinierte
Fachgebiete. Da kommt es schon mal vor, dass in dem einen oder ande-
ren Beitrag mathematische Formeln auftauchen − beispielsweise, wenn
jemand ein kompliziertes Verfahren zur Impedanzbestimmung vorstellt.
Freilich können Sie sicher sein, dass wir in der Redaktion die geistigen
Höhenflüge unserer Autoren gegebenenfalls etwas bremsen und den
Stoff so herüberbringen, dass ihn zumindest ein großer Teil der Leser
nachvollziehen kann. Integralrechnung, partielle Differenzialgleichungen,
Besselfunktionen und Schlimmeres, woran selbst die meisten Hochschul-
absolventen unter den Lesern nur mit Grauen zurückdenken dürften,
werden wir Ihnen auch weiterhin nicht zumuten.
Wenn aber in einem eher theoretisch gehaltenen Beitrag einige Formeln
zum Verständnis notwendig sind, so macht es wenig Sinn, diese ins
Internet auszulagern, wie einige Leser vorschlugen. Erstens soll jeder
Beitrag im Zusammenhang lesbar sein, egal ob zu Hause, in der Bahn,
im Garten oder in irgendeinem Wartezimmer, wo eben gerade kein Web
allgegenwärtig ist.
Ein zweiter Aspekt erscheint mir indes noch wichtiger: Ist es nicht bei-
nahe beängstigend, wohin wir mit unserem High-Tech-Amateurfunk
gekommen sind? Damit will ich keinesfalls „back to the roots“, ganz im
Gegenteil − es ist doch herrlich, was wir heute mit von Amateuren ent-
wickelten oder vielleicht aus der Weltraumforschung entlehnten Techno-
logien machen können: Der 100-W-Allmode-Allband-Transceiver passt in
eine Zigarrenkiste − Transport null Problem. Bis zum Mond und zurück
mit Durchschnittspower und Einzel-Yagi − die Soundkarte im PC machts
möglich. Und eine kleine Lautsprecherbox neben dem Transceiver lässt
auf Knopfdruck das Rauschen beinahe restlos verschwinden. Hand aufs
Herz − wer kann sich überhaupt noch vorstellen, was da in den Chips
wirklich passiert?
Muss man ja nicht, es funktioniert schließlich auch so. Oder? Millionen
Erdenbürger benutzen ein Handy. Aber wahrscheinlich 99,9 % von ihnen
haben nicht im Entferntesten eine Ahnung davon, welch kompliziertes
Equipment dahintersteckt.
„Schämen sollten sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder
der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig
erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohl-
behagen frisst.“ Als Albert Einstein bei der Eröffnung der Funkausstellung
1930 diesen oft zitierten Satz äußerte, ging (nur) ein leises Raunen durch
das Publikum. Zur Eröffnung der IFA 2003 könnte sich wohl kaum eine
Persönlichkeit von Rang und Namen mehr getrauen, so etwas über die
Lippen zu bringen…
Selbst wenn wir heute als Amateure wie als Profis die „Wunder der
Wissenschaft und Technik“ größtenteils nur noch ansatzweise verstehen
können, ein wenig „Mitdenken“ steht gerade uns Funkamateuren und
Hobbyelektronikern gut zu Gesicht. Dabei möchte Sie der FUNKAMATEUR
nach wie vor unterstützen, und dies, ohne mathematischphysikalische
Zusammenhänge gänzlich aus dem Heft zu verbannen!
Ihr
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Schwierige Zeiten − Besserung vorerst nicht in Sicht
Seien wir einmal ehrlich. Hatten nicht alle wenigstens etwas gehofft,
dass es nach der Bundestagswahl im vergangenen September wieder
aufwärts gehen würde in Deutschland? Dass längst fällige Reformen des
desolaten Sozialsystems zügig angegangen würden? Fehlanzeige. Der
Einbruch der Weltkonjunktur und unzählige hausgemachte Probleme
bescheren uns wachsende Arbeitslosigkeit, steigende Sozialabgaben,
mehr und mehr Firmenpleiten und was nicht noch alles. Man mag es
eigentlich nicht mehr hören.
Teuro-Debatte, Reallohnverlust und soziale Verunsicherung veranlassen
die Menschen hier zu Lande, ihren Konsum einzuschränken. Null- oder
Minuswachstum sind die Folge, die deutsche Wirtschaft befindet sich
nach wie vor im Abwärtstrend, und das Schlimmste dabei ist, dass die
politisch Verantwortlichen außer Steuererhöhungen und sozialen Ein-
schnitten keine wirklichen Lösungen wissen.
Öffentliche und auch private Haushalte müssen sparen, setzen den Rot-
stift dort an, wo Ausgaben nicht überlebenswichtig sind. Hobby ist nicht
wichtig, und der sechs Jahre alte Transceiver tut es noch.
Klagte die Amateurfunkbranche schon im Vorjahr über dürftige Umsätze
und knappe Handelsspannen, so war das sicher nur die Ouvertüre für
den Klagechor, den die Händler in diesem Jahr unisono vortragen
werden. Dabei ist es egal, ob die Anschaffung eines neuen Transceivers
auf unbestimmte Zeit verschoben wird oder man sich an modernen
Slogans wie „Geiz ist geil“ und „jeder Preis verhandelbar“ orientiert.
Wer so oder gar nichts einkauft, vernichtet unsere Infrastruktur, auch
wenn er das nicht beabsichtigt.
Vergangene Woche habe ich wegen eines Ersatzteils mit meinem Händ-
ler telefoniert. Das Gespräch kam auf die aktuelle Marktlage. Ja, sein
Telefon klingele schon dann und wann, auch E-Mails würden auf seinem
Computer ankommen. Aber in der Regel seien es technische Fragen zu
dem einen oder anderen Gerät, die er als Händler selbstverständlich
beantwortet. Schließlich sei er Dienstleister, also auch kundenfreundlich.
Und Verkäufer. Was es denn bei ihm kostet, ob noch ein Rabatt drin
wäre, wenn er noch ein Filter dazukaufen würde, will der Anrufer als
Nächstes wissen. Nein, das sei doch zu teuer. Ein anderer Händler bietet
es 12 € günstiger an. Wird also nichts. Danke und tschüss.
Das Resultat des 8-Minuten-Telefonats: Der Anrufer freut sich, ein paar
Euro gespart zu haben, und es ist ihm im Moment völlig egal, ob sein
„günstigerer“ Lieferant jemals eine Reparatur ausführen kann. Der Händ-
ler dagegen ist frustriert. Nicht, weil er eines der Geschäfte, von deren
knapper Marge er Ladenmiete, Mitarbeiter und Werbung bezahlen muss
und außerdem zu leben versucht, nicht machen konnte. Weit mehr regt
ihn auf, dass solcherlei Telefongespräche inzwischen die Regel sind.
Da fragt man sich, welche Auswirkungen erst der Irak-Krieg haben wird,
der von den Amerikanern längst beschlossene Sache ist. Wenn der
Ölpreis vielleicht ins Unermessliche steigt…
Gute Aussichten sind das wirklich nicht.
W. Bedrich, DL1UU
Amateurfunk in der DDR − Historie bewahren
Für alle, die uns nicht kennen, vorab: Das internationale Kuratorium
QSL COLLECTION ist, so die offizielle Bezeichnung, ein Dokumentations-
archiv zur Erforschung der Geschichte des Funkwesens und der elektro-
nischen Medien. Beheimatet in Wien, tätig weltweit, unterstützt von
vielen Funkfreunden und ihren Verbänden bzw. Institutionen. Der FUNK-
AMATEUR war tätiger Förderer der ersten Stunde und ist es bis heute
geblieben.
Zum Thema. Ein rundes Jubiläum provoziert stets Überlegungen. Zwar
meldeten sich die ersten Funkamateure aus der „Ostzone“ schon kurz
nach Kriegsende, aber wäre nicht der „offizielle Termin“ vor fünfzig Jahren
ein geeigneter Anlass, dem Amateurfunk in der DDR ein eigenes Projekt
zu widmen? Ein heikles Thema? Fraglos. Belastet mit Emotionen, mit
Verdrängungen, mit der Gefahr, dass man hüben wie drüben der (seien
wir ehrlich: immer noch vorhandenen) ideologischen Grenze einseitige
politische Wertungen wittert… Andererseits: Ebendeshalb sind die
gesicherten historischen Fakten so schütter, von den Anfängen bis zum
Wende-Ende. Und je weiter man zurückgeht, umso unschärfer wird das
Bild, umso rarer werden Augenzeugen, umso größer der Handlungsbedarf.
Was müsste vordringlich geschehen? Wir müssten zunächst aufbauen auf
der vorhandenen Vorkriegs-Dokumentation, die auch ziemlich lückenlos
erfasst, wer nach 1945 unter welchen Rufzeichen im „Westen“ und somit
(meist) im DARC tätig wurde. An dieser Dokumentation haben wir jahre-
lang gearbeitet und über 200 000 Einzelinformationen registriert. Die
Funkfreunde aus dem anderen Teil Deutschlands wurden jedoch bei den
offiziellen Verlautbarungen „übersehen“; da ist Abhilfe vonnöten.
Weiter: Wir haben doch bereits die wichtigste Vorarbeit geleistet und
verfügen über eine konkurrenzlose DDR-Datenbank aller bislang erreich-
baren Namen und Rufzeichen. Da fehlen „nur“ noch die Querverbindun-
gen zu unserem reichen Fundus an QSL-Karten; da fehlt „nur“ noch die
systematische Auswertung sämtlicher schriftlicher Quellen; da fehlt „nur“
noch die intensive Recherche in den öffentlich zugänglichen Archiven…
„Nur“ noch ein paar tausend Stunden Arbeit…
Schließlich – und das ist der Knackpunkt: Wir würden Dokumente brau-
chen. Rundschreiben, Fotos, Korrespondenzen, Auszüge aus Stasi-Akten,
Persönliches wie Offizielles − kurz: alles, was zu einer umfassenden,
fundierten, objektiven Darstellung des Amateurfunks in der DDR beiträgt.
Und es verlockt die Aussicht, bei der Ham Radio als Zwischenbilanz der
Forschungsergebnisse eine Ausstellung zu zeigen.
Fazit: Wer, wenn nicht wir, mit unserer Erfahrung und Kompetenz, mit
unserer Infrastruktur, mit unserem Materialbestand (der, bei allen Lücken,
alle anderen Archive bei weitem übertrifft), mit den bereits geleisteten
Vorarbeiten und der erforderlichen objektiven Distanz. Und: Wann, wenn
nicht jetzt, wo wir eine letzte Chance haben, den Wettlauf gegen die Zeit
nicht endgültig zu verlieren.
Bleibt die Frage: Sollen wir uns in diese gewaltige Aufgabe stürzen? Das
hängt jetzt von Ihnen ab, liebe Funkfreunde, von Ihrer Reaktion auf unseren
Appell. Zurückhaltung und Verlust oder Engagement und Gewinn, das ist
die Alternative. Sie erfahren mehr über uns bei www.qsl.at. Sie erreichen
uns via: oe1xqc@oevsv.at, Fax +423-1-749 52 835, Fon +43-1-50101-16071,
Post: Internationales Kuratorium QSL COLLECTION, Dokumentationsarchiv
zur Erforschung der Geschichte des Funkwesens, Postfach 2,
A-1112 Wien.
Wolf Harranth, OE1WHC
Ihre Zeitschrift im Internet: Mehr Vorteile für Abonnenten
Man hört jetzt häufig, dass die Printmedien unter rückläufigen Anzeigen-
erlösen leiden. Bereiche, in denen Tageszeitungen bis vor einiger Zeit
quasi eine Monopolstellung innehatten, wie zum Beispiel die Stellenund
Gebrauchtwagenmärkte, sind auf dem Vormarsch ins Internet und
hinterlassen tiefe Löcher in den Kassen der Verlage. Die schwächelnde
Konjunktur, die aktuelle Kaufzurückhaltung und der auf die Margen
drückende Preisverfall für viele Produkte führen zu drastischen Kür-
zungen der Budgets der werbenden Wirtschaft.
Dazu kommt, dass alle Verlage, die etwas auf sich halten und für „mo-
derne“ Menschen produzieren, adäquat im Internet präsent sein müssen:
mit Online-Nachrichten, Archiven zurückreichend bis zur Erstausgabe,
Linksammlungen usw. Nun, da die Kosten der Online-Engagements
vieler Verlage in keinem Verhältnis zu den spärlichen Werbeeinnahmen
stehen, ist Ernüchterung eingekehrt. Und die Anwender müssen für den
Content zahlen.
Wir haben die Website des FUNKAMATEUR von Anfang an auf Zusatz-
nutzen für die Leser fokussiert: Ergänzende Informationen zu den aktu-
ellen Ausgaben, downloadbare Software, Foren, Online-Shop und ein
Archiv. Da unsere Website praktisch werbefrei ist, müssen wir alle Kosten
aus den Verkaufserlösen der Zeitschrift decken. Die kommen bekannter-
maßen zum allergrößten Teil von unserer treuen Stammkundschaft, den
etwa 18 000 Abonnenten. Verständlich also, dass künftig insbesondere
diese Leser den größten Gewinn aus unserem wachsenden Webangebot
ziehen können.
Wie auf www.funkboerse.de wird man sich auch auf www.funkamateur.de
in Kürze mit der Abo-Nummer und der Postleitzahl einloggen können.
Hinter dieser „Tür“ findet man dann das Beste aus allen Ausgaben der
vergangenen Jahre: Das komplette, umfangreiche Archiv der Testbe-
richte, Typen- und Datenblätter steht den Abonnenten zum Download
zur Verfügung. Über einen Index, den wir zur Zeit erstellen, wird die
gezielte Suche nach Bauelementedaten zum Kinderspiel.
Aus früheren Jahrgängen, die nicht mehr in gedruckter Form verfügbar
sind, werden wir für unsere Abonnenten zusätzlich die interessantesten
technischen Beiträge ins Archiv packen. Zwar haben Leser mehrfach
angeregt, weitere DIGEST-Bände zu produzieren. Der Bedarf an Sammel-
werken mit Röhren- und Transistorschaltungen dürfte aber eher gering
sein, sodass die Veröffentlichung im Internet der sinnvollere Weg zu sein
scheint.
Daneben verbessern wir aber auch unsere rein kommerziellen Angebote.
So arbeitet unser Internetdienstleister, die Quickweb GmbH, an einem
Relaunch der Bestellseite für QSL-Karten, die unter www.qsl-shop.com
erreichbar ist. Der Bilder-Pool wird um gut 1000 neue Profifotografien
aller Genres erweitert, die sich für QSL-Karten frei nutzen lassen.
Außerdem ist vorgesehen, dass sich unsere Kunden künftig online über
den Bearbeitungsstand ihrer Aufträge informieren können. Das soll unsere
gebührenfreie Hotline 0800-QSLSHOP entlasten.
Alles Gute für Sie im neuen Jahr. Wir haben viel vor.
Knut Theurich, DGØZB
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Mit „vereinten“ Kräften
Im Zeitalter der rasanten internationalen Ausdehnung der Telekommuni-
kationstechniken, der ständigen Entwicklung neuer, immer komplexerer
Verfahren dafür (und dem Anwachsen entsprechender Lobbyistenkreise)
wächst auch die Angst einer Mehrheit der nicht entsprechend vorge-
bildeten Bevölkerung vor mutmaßlichen Gefahren, Stichwort „Elektro-
smog“. Die Politik sucht diesen Veränderungen durch Gesetze und
Regulierungen Rechnung zu tragen, die den Einsatz neuer TK-Techniken
ermöglichen und die Schutzbedürfnisse berücksichtigen. Internationale,
insbesondere europäische Vereinbarungen und Vorschriften sind dabei
zu beachten. Der weltweite Handel bringt zusätzliche Probleme durch
TK-Produkte, die aus Regionen mit anderen Randbedingungen auf den
europäischen Markt drängen.
Um vor diesem Hintergrund einen genügenden Freiraum für den Ama-
teurfunk als Experimentalfunk zu erhalten, bedarf es langer sachlicher,
von Kompromißbereitschaft geprägter Diskussionen mit den zuständigen
Behördenvertretern und Politikern. Auf deren Wunsch wurde der RTA −
Round Table Amateurfunk − gegründet, der außer dem DARC 14 kleinere
Amateurfunkvereine, wie z. B. die AMSAT DL, umfaßt. Der RTA stellt
damit die offizielle, von amtlicher Seite anerkannte Vertretung (nahezu)
aller deutschen Funkamateure dar.
Die auf Basis des FTEG am 28.08.2002 in Kraft getretene Verordnung
zur Begrenzung elektromagnetischer Felder BEMFV führt nun bei Funk-
amateuren wieder zu heftigen Diskussionen. Bei innerdeutschen Ge-
sprächsrunden im 80- oder 40-m-Band kann man beobachten, daß eine
kleine Minderheit zum Teil fachlich falsche und vor allem polemische
Kommentare über gesetzliche Randbedingungen des Amateurfunks in
Deutschland abgibt. Mangels ausreichender Hintergrundinformationen −
oder aus purer Lust am Nörgeln? − wird dann oft auf „den“ DARC sowie
seine ehrenamtlich tätigen Repräsentanten geschimpft und z. B. geäußert:
„Wenn ,die‘ nicht für Beseitigung der Bestimmungen sorgen, trete ich
aus dem Verein aus!“
Diesen Amateurfunkfreunden (oder eher -feinden?) muß offenbar deutlich
in Erinnerung gerufen werden, daß die Teilnahme am Amateurfunkdienst
nicht nur Rechte beinhaltet, sondern auch Pflichten. Wie alle anderen
Funkdienste ist der Amateurfunk internationalen Gesetzen und Verein-
barungen unterworfen, die in nationalen Gesetzen und Vorschriften ihren
Niederschlag finden. Ein eventueller Austritt aus dem Club würde ihnen
keine Befreiung von den gesetzlichen Verpflichtungen bringen, sie bleiben
auch für sie, selbst mit eventuellen „Ungereimtheiten“ darin, weiter zwin-
gend gültig!
Austritt aus dem Verein bedeutet, daß dieser und damit auch der RTA
nicht mehr (fast) alle deutschen Funkamateure offiziell vertreten könnte.
Eine solche Vertretungsschwächung würde eine Stärkung der amateur-
funkfeindlichen Interessen bewirken und damit für alle Funkamateure in
Deutschland, auch für den „Nörgler“, von Nachteil sein.
Das Privileg gegenüber allen anderen Senderbetreibern, außer in Sonder-
fällen, keine kostenpflichtige Standortbescheinigung beantragen zu
müssen, ist das Ergebnis erfolgreicher Argumentation der Behörde
gegenüber. Um diese Argumentation nicht unglaubwürdig erscheinen
zu lassen, sollte jeder Funkamateur den Verpflichtungen nachkommen,
der RegTP seinen Funkbetrieb gemäß BEMFV anzuzeigen und damit
zu legalisieren.
Ein wenig Hilfestellung dabei gibt der Beitrag ab Seite 1222.
Horst-Dieter Zander, DJ2EV
Qual der Wahl am Ort
Der Herbst zeigte sich bis zum Redaktionsschluß dieser Ausgabe
ja (noch?) nicht gerade von seiner „goldenen“ Seite. Aber − wie das
Wetter auch sei − die Tage werden kürzer, die Abende länger. Und
damit steigen automatisch Motivation und Zeit, dem (Elektronik-)Hobby
wieder viel ausgiebiger als im Sommer zu frönen. Die Ideen für inte-
ressante Selbstbauprojekte gehen einem versierten Bastler ja schließ-
lich nicht aus, oder?
Man soll’s kaum glauben, aber es sind tatsächlich nur noch gut fünfzig
Tage (!) bis Weihnachten. Da wäre es doch eventuell eine tolle Sache,
Familienmitglieder, Bekannte oder Freunde mit einem ganz persönlich
hergestellten „elektronischen Geschenk“ zu überraschen, statt nur
(wie in jedem Jahr hektisch kurz vor Ultimo) die üblichen „Standard-
Dedikationen“ aus dem Kaufhausregal abzustauben.
Ist das nicht mal eine Überlegung wert? Tante Elli mit ihren schlechten
Augen könnte möglicherweise einen Funkwecker mit übergroßen
Ziffern gut gebrauchen, den es in dieser Form gar nicht im Handel gibt.
Onkel Willy hört die Haustürklingel nicht mehr so gut und wäre mit einer
optischen Signalisierungslösung bestens bedient und, und, und…
Am besten, man ruft vorher mal bei beiden zu Hause an. Zum Ortstarif.
Apropos Ortstarif. Da hat ja bislang der „Rosa Riese“ immer noch eine
marktbeherrschende Monopolstellung. Doch nach langem Hickhack
um die vom Bundestag beschlossene Novellierung des Telekommu-
nikationsgesetzes, die nach einem ersten erfolglosen Anlauf nun beim
zweiten Mal doch noch den Bundesrat mit „grünem Licht“ passiert hat,
ist ab 1. Dezember 2002 der Weg für „Call by call“ und „Preselection“
auch im jeweiligen Ortsnetz frei.
Was bereits seit der Anfang 1998 erfolgten Liberalisierung des Telefon-
bereichs für Ferngespräche galt, nämlich die freie Netzbetreiberwahl
per Vorwahlnummer, wird also ab Dezember auch im Ortsnetz möglich
sein. Natürlich handelt es sich hierbei erst einmal nur um ein gesetz-
liches „Absegnen“ dieser Regelung. Ob und wann daraus praktisch
nutzbare Angebote für den Festnetz-Telefonkunden werden, hängt
davon ab, wie die beteiligten Unternehmen und die RegTP das alles
mit mehr oder weniger Tempo umsetzen.
Nun läßt sich einwenden, daß es doch längst möglich sei, per geeig-
neter Vorwahlnummer auch im Ortsnetz über einen anderen, günsti-
geren Anbieter als die Telekom Gespräche zu führen. Doch solche
(0190xxx-)Anbieter erlauben kein „echtes Call by call“, sondern sind
reine Mehrwertdienste, die Telefongespräche lediglich „vermitteln“.
Was dem Privatkunden erst einmal egal sein kann, macht für Firmen,
die Call by Call z.B. über Least Cost Router betreiben, doch schon
einen Unterschied aus, denn über die 0190er-Nummern ist in der
Regel bei automatisiertem Telefonbetrieb kaum ein „Fall back“ mög-
lich. Außerdem geht es bei der neuen gesetzlichen Regelung ja grund-
sätzlich darum, eine bisherige Monopolstruktur in den freien Wettbe-
werb zu überführen.
Bleibt also abzuwarten, was die Qual der Wahl im Ortsnetz künftig für
uns als Kunden an Vorteilen bringen wird…
Ihr
Dr.-Ing. Reinhard Hennig, DD6AE
In ganz eigener Sache
Diesen Monat werden wir 50. Solch ein Jubiläum verpflichtet, eine
Rückschau zu halten. Daß von dem halben Jahrhundert fast 40 Jahre
in die DDR-Zeit fallen und nur ein Dutzend in die Marktwirtschaft,
wird insbesondere den neuen Lesern kaum bewußt sein. Senior-Re-
dakteur Bernd Petermann, DJ1TO, hat sorgfältig recherchiert und
vermittelt Ihnen ab Seite 986 eine sehr persönliche Sicht auf die
Geschichte der Zeitschrift, die Sie eben in den Händen halten.
Heute, zwölf Jahre nach der deutschen Einheit kann das Team auch
Bilanz ziehen und mit Stolz sagen, daß der FUNKAMATEUR nun eine
gesunde Zeitschrift ist, die im Gegensatz zu vielen anderen das Ende
der DDR überdauert hat und im gemeinsamen Deutschland angekom-
men ist.
Aber 50 Jahre Arbeit im Dienste des Amateurfunk- und Elektronikhobbys
sind vor allem Anlaß, aIl denen Dank zusagen, die in irgendeiner Weise
zum Erfolg der Zeitschrift beigetragen haben. Da sind neben den Ver-
lagsmitarbeitern die Autoren, die ihre Ideen zu Papier bringen und über
den FUNKAMATEUR einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Da sind unsere Anzeigenkunden, ohne deren vertrauensvolle Engage-
ment das Heft deutlich teurer sein müßte. Und da sind unsere Partner −
die Druckerei, die Vertriebsfirmen und die Post, die zuverlässig dafür
sorgen, daß das Heft schnell und in guter Qualität zu Ihnen kommt.
Den Hauptanteil am Erfolg des FUNKAMATEUR leisten aber Sie, liebe
Leser. Alle unsere Bemühungen wären unnütz, wenn Sie die Zeitschrift
nicht kaufen würden. Vielen Dank also an alle Abonnenten und alle Le-
ser, die sich am Kiosk für den FUNKAMATEUR entscheiden. Vor allem
diejenigen haben uns geholfen, die der Zeitschrift über den Umbruch
hinweg die Treue hielten.
Teil des Erfolgsrezept ist sicherlich auch, daß wir uns inhaltlich strikt
an den Leserinteressen orientieren. Schließlich wissen wir aus eigener
Praxis, diversen Umfragen, vielen Leserzuschriften und unzähligen
persönlichen Kontakten, was unsere Leser interessiert.
Inzwischen sind im Theuberger Verlag fast 120 FUNKAMATEUR-
Ausgaben produziert worden. Stets mit eher kleinem Budget aber
immer mit großem Elan. Wegen der hohen Leserzahl bieten wir heute
im Unterschied zu anderen Funk- und Elektronikzeitschriften durch-
gängigen Vierfarbdruck, mit 108 oder noch mehr Seiten den größten
Heftumfang und bei Abopreisen ab 33,60 € das mit Abstand beste
Preis-Leistungs-Verhältnis. Dadurch sind Sie, der Leser, direkt am
Erfolg Ihres FUNKAMATEUR beteiligt! Und dafür, daß Sie auch in
Zukunft Monat für Monat sehnsüchtig auf neue Lektüre warten,
wollen wir gern hart und mit viel Spaß arbeiten.
Durch großen Idealismus, hohe fachliche Kompetenz und konsequentes
Qualitätbewußtsein haben wir uns einen geachteten Platz in der Medien-
landschaft erkämpft. Schade nur, daß einige wichtige DARC-Amtsträger
immer noch nicht wahrhaben wollen, welches Potential beispielsweise
für die Nachwuchsgewinnung im FUNKAMATEUR steckt. Wir jedenfalls
bleiben für eine Zusammenarbeit offen.
Ihr
Knut Theurich, DG0ZB
Detektor − oder: unser Nachwuchs
In der vorigen Ausgabe hatten wir eine kleine Schaltung für einen
Detektorempfänger veröffentlicht − und das im FUNKAMATEUR…
Fachautor Roland Walter, vielen auch durch seine AVR-Serie ein Begriff,
hatte es eigentlich gar nicht so bierernst gemeint und wollte vor allem
Newcomern eine kleine Anregung geben, ohne Anspruch auf höchsten
wissenschaftlichen Neuheitswert zu erheben. Viele Leser haben das auch
so verstanden und in Zuschriften weitere Ideen beigesteuert. Dafür be-
danken sich Autor und Redaktion, doch bitten wir um Verständnis, daß
wir den Detektorempfang nicht noch weiter thematisieren wollen.
Und denen, die uns mitteilten, daß ähnliche Schaltungen bereits in den
Vor- und Nachkriegsjahren kursierten, sei ebenfalls für ihre Mühe ge-
dankt. Bedenklich stimmen allerdings Zuschriften, die davon sprachen,
so etwas sei schon vor vierzig Jahren gebaut worden, und eine solche
Veröffentlichung sei unter dem Niveau unserer Zeitschrift.
Auch wir FA-Redakteure haben schon vor dreißig Jahren mit Diode und
Langdraht experimentiert, und trotzdem hatten wir bei der Auswahl des
Beitrags eben an die Leser gedacht, die vor dreißig Jahren entweder
noch gar nicht auf der Welt waren oder sich erst später dem Funkhobby
zuwandten, eben neu Hinzugekommene − auf Neudeutsch „Newcomer“
− sind.
Unser Magazin soll doch „bunt“ sein und für jeden etwas bieten. Kaum
ein Leser wird alle Beiträge gleichermaßen interessant finden, dem
einen sind bestimmte Beiträge zu primitiv, dem anderen manche zu
anspruchsvoll. Letzteres geht sogar so weit, daß erst kürzlich jemand
genau deswegen sein Abo kündigte.
Wenn für jeden etwas dabei ist, warum darf das nicht auch für Einstei-
ger gelten? Habt ihr „alten Hasen“ etwa schon vergessen, wie es war,
als die ersten Lötstellen nicht glücken wollten, der 0-V-1 keinen Mucks
sagte oder sich der teuer erstandene OC811 ohne erkennbaren Grund
in Rauch auflöste? Wart ihr da nicht auch dankbar für jeden Fingerzeig?
Inzwischen ist das Hochschuldiplom schon fast vergilbt, es steht in jeder
Ecke von jedem Zimmer ein Funkgerät, das Hauptthema beim Clubabend
ist, wie gut wir früher waren und daß es heute keinen Nachwuchs
mehr gibt.
OMs wie Peter Zenker, DL2FI, und Gerhard Wilhelm, DL2AVK, die hier
unlängst zu Wort kamen, haben auch vor Jahrzehnten einen Detektor-
empfänger gebaut, aber sie wissen es heute noch, wie wichtig ihnen
damals fremde Hilfe war. So putzen sie jetzt nicht ihren Heiligenschein,
sondern packen an, um Newcomern auf die Beine zu helfen, bringen
ihren Erfahrungsschatz ein und suchen ständig nach neuen Ideen,
unser Hobby für die heranwachsende Generation interessant zu ge-
stalten.
Diesem Anspruch fühlen wir uns genauso verpflichtet, und so werden
wir auch weiterhin Lesenswertes für technisch noch wenig versierte
Amateure drucken − vielleicht animieren wir ja dadurch ein bißchen
die „gestandenen“ Old Men, vom hohen Roß herunterzusteigen, um
dem leider nur noch tröpfchenweise hinzukommenden Nachwuchs
die erfahrene Hand zu reichen und etwas Nützliches mit auf den Weg
zu geben!
In diesem Sinne mit besten 73
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Der Anfang ist gemacht
Über die Situation an Schulen haben wir aus vielen Quellen erfahren.
Nicht zuletzt waren die Ergebnisse der PISA-Studie ja niederschmet-
ternd genug. Und die Antworten der Politik darauf sind bisher von nur
geringer Substanz.
Nun gibt es der Möglichkeiten viele, Jugendlichen zu besserer Aus-
bildung zu verhelfen, sie zur Aneignung und Anwendung mathema-
tischen, physikalischen und technischen Wissens zu motivieren. Die
aktive Beschäftigung mit Funk und Elektronik ist eine davon. Viele
Leser dieser Zeitschrift können dies nur zu gut nachvollziehen, sind sie
doch selbst eben dadurch direkt oder indirekt zu ihrem heutigen Beruf
gekommen.
Mit seiner Initiative „Schulfunkstation“ will der DARC e.V. Thüringen
ermöglichen, daß sich Schüler an ihrer Ausbildungsstätte mit dem
Amateurfunk befassen können. Vorbild ist die lobenswerte Arbeit am
„Karl-Theodor Lieben“-Gymnasium bei DK0KTL in Gera. Hinzu kommen
die Schulen in Magdala und Neustadt/Orla, wo Funkamateure und
Pädagogen gemeinsam die erforderlichen Voraussetzungen für den
Amateurfunkbetrieb schufen.
Nach unserer Auffassung besteht Lernen aus Hören, Sehen und Tun;
man könnte es als eine Wertschöpfung betrachten. Vor allem im Tun
sollen sich den Schülerinnen und Schülern Werte offenbaren.
Genau dies kommt in der heutigen Welt der Computerspiele und der
„Betätigung“ im Cyberspace à la „Galaxy Wars“ viel zu kurz.
Unser erster Schritt besteht darin, den Amateurfunkdienst bei Schü-
lern bekannt zu machen und für Nachfragen zur Verfügung zu stehen.
Dem steht leider das knappe Zeitlimit der Funkamateure entgegen.
Der zweite Schritt ist, Lehrer für das Hobby „Funk“ zu gewinnen und
die an den Schulen vorhandenen räumlichen Möglichkeiten, beispiels-
weise zur Durchführung von Lehrgängen und zur Einrichtung von
Klubstationen, zu nutzen. Hier ist es problematisch, die finanzielle
Seite zu gestalten und Funktechnik bereitzustellen. Eine Chance
besteht dabei im QRP-Betrieb. Gerade der AATiS bietet dafür aus-
reichendes Know-how und preiswerte Baugruppen für die Selbstbau-
praxis, was es zu nutzen gilt. Ein weiterer Schritt ist getan, wenn es
gelingt, Eltern und Verwandte als Paten einzubeziehen. Auch, weil der
Lernprozeß für die Schüler sehr intensiv verläuft, ist von elterlicher
Seite mehr als nur Toleranz gefragt.
Hohe Anerkennung verdienen die im Amateurfunkdienst engagierten
Lehrkräfte als Mittler zwischen Schülern und Funkamateuren. Die neue
Erfahrung aller wird sein, „etwas gelernt zu haben“, was sich mehrfach
auszahlt. Freilich bedeutet es Mühe für alle Beteiligten, die sich aber
lohnt, sind doch vor allem Schulen der Pool, aus dem uns junge Funk-
amateure nachwachsen können. Der Europatag der Schulfunkstationen
bietet eine gute Möglichkeit, Verbindungen herzustellen und sich über
Erreichtes zu freuen. Laßt uns weitere Präzedenzfälle schaffen und
„Nachahmungstäter“ darin bestärken, sich an einer Schulfunkstation
zu verwirklichen. Wir danken allen, die uns ermutigt haben, diese
Initiative zu starten und die uns mit Spenden und Zuwendungen unter-
stützen.
Gerhard Wilhelm, DL2AVK
Distriktvorsitzender Thüringen im DARC e.V.
Rien ne va plus?
Wenn schon die gesamte Unterhaltungselektronikbranche Umsatz-
einbußen von 20 % gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen hat, dann
geht auf dem Amateurfunksektor gleich gar nichts mehr. War es im
Vorjahr die Verunsicherung potentieller Käufer durch Selbsterklärung,
Herzschrittmachergrenzwerte und PLC-Angst, so kommt in diesem
Jahr der gravierende Kaufkraftschwund durch den Euro-Teuro-Effekt
hinzu. Daneben sorgte der anfangs sehr wackelige Stand des Euro
im Vergleich zum Dollar für weitere Preissteigerungen.
Dessen nicht genug, müssen Millionen Bundesbürger − darunter auch
Tausende Funkamateure − mit Entsetzen dem Wertverfall ihrer T-Aktie
zusehen, und wo tatsächlich noch Geld übrig ist, fließt es ja nun in die
Riesterrente.
Na, und die Eskapaden der Geräteindustrie entlocken den Leuten
schon lange kein „Muß ich haben“ mehr − noch ein Dreibandhandy
mit integriertem Radio und noch eins und noch eins… Wenn sich
doch wenigstens das dritte Band in DL nutzen ließe!
Der einzige Glückstreffer in den letzten Jahren ist da wohl Yaesu mit
dem FT-817 gelungen, der Winzling scheint ja tatsächlich auf dem
Weg zum bestverkauften Gerät aller Zeiten zu sein. Also, es geht
doch − dort, wo wirkliche Innovationen zu einem vernünftigen
Preis-Leistungs-Verhältnis und nicht nur aufgepfropfte Goldzähne
am 4000-Euro-Boliden dahinterstehen, sind Konsumenten auch
bereit, ihre Geldbörsen zu öffnen.
Freilich heißt Amateurfunk in erster Linie Experimentalfunk, der Autor
dieser Zeilen ist ja selbst langjähriger, begeisterter Selbstbauer. Doch
ein komplettes x-Band-Allmodegerät ist von OM Normalverbraucher
beim besten Willen nicht im Eigenbau hinzubekommen. Insoweit sind
auch die experimentierfreudigsten Amateure auf Industrie und
Fachhandel angewiesen. Noch gibt es kompetente Fachbetriebe, die
sich durch sachkundige Beratung und exzellenten Service auszeichnen,
doch den meisten von ihnen steht das Wasser bis zum Hals.
Funkamateure haben in der Nutzung neuer Medien naturgemäß die
Nase vorn, und es fällt ihnen nicht schwer, sich vor dem Gerätekauf
nach dem bundesweit „besten“ Preis zu erkundigen. Daß diese meist
von „Kistenschiebern“ kommen, scheint da wenig zu interessieren,
Hauptsache preis-„günstig“. Die echten Fachbetriebe mit kosten-
intensivem Ladengeschäft, gefülltem Lager, qualifiziertem Personal
und funktionierender Servicewerkstatt gehen dabei nur zu oft leer aus.
Wen wundert es, daß Jahr für Jahr mehr von diesen mangels Sinn-
fälligkeit der Bildfläche entschwinden bzw. sich anderen Tätigkeits-
feldern zuwenden.
Und wer bezahlt die Zeche? Na der Kunde, und zwar nicht nur der,
der so „günstig“ eingekauft hat, sondern auch alle anderen. So ist
dann wohl bald ein halbes Jahr und mehr Wartezeit angesagt, wenn
der Stationstransceiver zu Reparaturzwecken irgendwo im vereinten
Europa umherkreiselt − vielleicht mit der Option, den aktuellen Aufent-
haltsort am heimischen Bildschirm via Internet verfolgen zu können…
Nagelprobe wird die diesjährige Ham Radio sein, wo erfreulicherweise
fast jeder zweite Teilnehmer der Juni-Umfrage auf www.funkportal.de
hinfahren will. Interessanter ist die Frage, ob die Hams dort auch Geld
ausgeben, und wenn ja, bei wem…
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Anziehende Aussichten
Unsere Internet-Website hat es bereits vermeldet: Es kündigen sich
wohl demnächst wieder anziehende Preise bei der Computertechnik
an. Grund dafür sind vor allem die inzwischen fast leergeräumten
Lager der großen Speicherchip-Hersteller. Schon wittert die ein-
schlägige Industrie erneut Morgenluft und streckt bereits die Fühler
aus, um durch gemeinsame Entwicklungen und Joint-Ventures stra-
tegische Allianzen zu bilden, das lukrative Marktsegment verspricht
gute Gewinne. Da lohnt es sich beim Kauf eines neuen PCs schon
bald, genauer hinzusehen, was unter der meist grauen Blechhaube
steckt. Oft entpuppt sich hier ein vermeintliches „Schnäppchen“ als
Ansammlung von No-name-Baugruppen, die dann den scheinbar
günstigen Preis letztlich doch nicht rechtfertigen.
Anziehende Umsätze verzeichnen unter den digitalen Rechenknechten
derzeit in immer stärkeren Maße die kleinen, handlichen Notebooks und
PDAs. Von „nice to have“-Geräten konnten sie sich inzwischen zu ernst-
haften Business-Werkzeugen mausern, die aus dem Geschäftsalltag
kaum noch wegzudenken sind. In nur vier Jahren verdoppelten sich
die Stückzahlen der verkauften Geräte von dreieinhalb auf aktuell über
sieben Millionen Exemplare.
Auch im Telekommunikationsbereich sind die Aussichten anziehend.
Gingen die Telefontarife im Kampf um Marktanteile stetig bergab und
in den Keller, scheint nun dieser Trend gestoppt zu sein. Die Deutsche
Telekom macht’s wieder einmal vor: Seit Anfang Mai erhöhte sie nicht
allein die allgemeinen Grundgebühren, sondern auch beim schnellen
T-DSL-Surfvergnügen für zwischendurch bittet der „Rosa Riese“ nun
seine Kunden stärker zur Kasse.
Nicht lange bitten muß man ebenso die diversen Mobilfunkanbieter.
Höhere Tarife bei SMS-Gateways etwa, oder happige Gebühren
beim mobilen Websurfen via GPRS sollen für gute Bilanzen sorgen.
Geworben wird ja bei GPRS stets mit dem Argument, daß hier nur
das übertragene Datenvolumen in Rechnung gestellt wird − aber wer
genau nachrechnet, kommt mit Einwahlgebühren und Datentraffic auf
wesentlich höhere Gesamtkosten, als bei denen, die nach dem Zeit-
abrechnungssystem z. B. bei HSCSD anfallen. Na ja, irgendwie müssen
schließlich die immensen Summen, die fürs Raufen um ein Stück vom
„UMTS-Kuchen“ verschleudert wurden, wieder hereinkommen.
Apropos UMTS: Top oder Flop? Das wird noch die Frage sein. Peinlich,
peinlich, daß gerade in Japan, dem Land des technikbegeisterten
Lächelns, kürzlich erst NTT Docomo mit seinem UMTS-Handy floppte.
Statt dessen feiert die „Wireless-LAN“-Technologie als preisgünstige
Netzzugangs-Alternative fröhliche Urständ.
Sicherlich lassen sich die fernöstlichen Gegebenheiten nicht so ohne
weiteres auf europäische Verhältnisse abbilden. Zu merken ist aber,
daß auf dem Gebiet der mobilen Datenkommunikation noch vieles
erst im Werden und Wandeln ist. Das Grundprinzip jedoch bleibt
immer gleich. Nach einer Phase der Innovations-Euphorie folgt stets
Ernüchterung, die dann den Boden bereitet für wirklich breit akzep-
tierte Technologien. Es dürfte spannend bleiben.
Lassen Sie sich anziehen von der weiteren Entwicklung. Die Aussichten
sind gut.
Dr.-Ing. Reinhard Hennig, DD6AE
Der FUNKAMATEUR und die Funkamateure
Nicht alle Leser dieses Magazins sind Funkamateure, aber sehr viele
Funkamateure lesen dieses Magazin. Viele unserer Leser sind Mit-
glieder des Deutschen Amateur-Radio-Clubs DARC e.V. − andere sind
es nicht. Müssen sie ja auch nicht, der FUNKAMATEUR ist keine Ver-
einszeitschrift, er wird von aktiven Funkamateuren für Funkamateure
gemacht. Das hält uns aber nicht davon ab, genau wie die anderen
Funkamateure über Sinn oder Unsinn der Mitgliedschaft im „Dach-
verband des Amateurfunk“ nachzudenken und zu diskutieren − das
sogar aus doppeltem Interesse.
Einerseits gehört die Zeitschrift FUNKAMATEUR zu einem kommer-
ziellen Unternehmen, das weitgehend vom Amateurfunk lebt und als
solches ein natürliches Interesse daran hat, daß der Amateurfunk
lebendig bleibt und sich weiter entwickelt. Andererseits haben sich
viele von uns so stark mit ihrem Hobby identifiziert, daß irgendwann
Beruf und Hobby verschmolzen sind. Das Medium FUNKAMATEUR
gibt uns die Möglichkeit, Einfluß zu nehmen. So hat zum Beispiel die
Leserumfrage ergeben, daß gerade Beiträge über den Selbstbau im
Amateurfunk zu den beliebtesten gehören. Selbstbau ist seit Jahren
einer unserer Schwerpunkte.
Als für Abonnenten und Kioskkunden zugängliches Druckerzeugnis
erreichen wir auch diejenigen, die sich vielleicht erst flüchtig für den
Amateurfunk interessieren. Wir haben, wie wir aus unserer Umfrage
wissen, schon so manch einen durch unsere Beiträge darin bestärkt,
sich unserem schönen Hobby anzuschließen. Aber das allein genügt
nicht. Was noch dazu gehört, ist die Möglichkeit, sich auszutauschen,
sich persönlich zu treffen, und das kann ein Magazin nicht leisten. Wir
sind auch kein Gremium, das die Funkamateure auf der politischen
Ebene vertreten kann. Wir produzieren ein Heft, mit dem wir anregen,
helfen, unterstützen, rekrutieren können. Die Umsetzung in ein leben-
diges Hobby müssen die Funkamateure vor Ort selbst besorgen, am
besten in organisierter Form.
Eine Binsenweisheit, und deswegen ist der „Dachverband Amateur-
funk“ DARC e.V. wohl auch schon mehr als 50 Jahre alt. Persönlich
können wir natürlich viel mehr tun, indem wir uns beispielsweise über
unser berufliches Engagement hinaus auch direkt im DARC einbringen.
Zum Beispiel als Distriktsvorsitzender des Distrikts Berlin, ein Amt, das
ich im Januar übernommen habe. Nicht, weil ich mich langweile,
sondern aus der Überzeugung heraus, daß es nicht genügt, im FUNK-
AMATEUR Beiträge zu schreiben oder beruflich bedingt die Hams mit
Bausätzen zu versorgen.
Diese Kombination ermöglicht es mir, auf beiden Ebenen zu wirken.
Als Funkamateur im DARC kann ich helfen, den mehr als 50 Jahre alten
Karren, der zweifellos an einigen Stellen vom Zahn der Zeit angenagt
ist und knirscht, wieder in Schwung zu bringen; über den FUNKAMA-
TEUR kann ich alle Funkamateure ansprechen, die noch nicht einge-
sehen haben, daß man sich organisieren muß, wenn man bestehen
will. Im DARC arbeite ich gemeinsam mit alten Freunden an neuen
Ideen, mit Hilfe des FUNKAMATEUR gehe ich auf potentielle neue
Freunde zu.
Peter Zenker,
DL2FI, Distriktsvorsitzender Berlin im DARC e.V.
Unsere technische Gesellschaft
Wir leben in einer technischen Gesellschaft, in der jeder Zugriff auf
Technologien hat, die aus dem Blickwinkel des vorigen Jahrzehnts
gesehen ein ungeahntes Niveau und nie dagewesene Eigenschaften
aufweisen. Besonders die Kommunikationstechnologie ist überall
präsent. Amateurfunk, das Hobby der Kommunikation, sollte daher
eigentlich eine große Zugkraft besitzen, richtig?
Falsch! Da es einen riesigen Bedarf an der Kommunikation gibt, wird
diese strikt auf einem „Nur-Benutzer-Niveau“ gehalten. Menschen
kaufen und benutzen lediglich „schwarze Kisten“. Wie sie arbeiten,
will keiner wissen. Meist beschränkt sich der aktiv genutzte Funktions-
vorrat sogar auf eine geringe Teilmenge des vorhandenen.
Leider sehe ich diese Entwicklung auch im Amateurfunk. Ein Gerät
wird gekauft, angeschlossen und benutzt. Wie es funktioniert, ist eher
unwichtig. Hauptsache ist nur, daß es funktioniert und man mit anderen
Menschen kommunizieren kann. Selbst wenn sich jetzt den „alten Hasen“
bei dem Gedanken die Haare sträuben, daß unser Amateurfunk ein
nichttechnisches Hobby werden könnte und nur der persönlichen
Kommunikation dient − Technikfreaks unter den Funkamateuren sind
bereits in der Minderheit!
Einiges hat sich seit der „goldenen Ära“ des Amateurfunks verändert.
Früher war es jedem Funkamateur möglich, seine Geräte selbst zu
entwerfen, aufzubauen und dabei respektable Leistungen, nicht nur
im Sinne von abgestrahlter HF, zu erreichen. Der OM brauchte nicht
viel mehr als das Wissen über das Ohmsche Gesetz, die Resonanz und
die Güte, um seine eigene Station aufzubauen. Und die funktionierte!
Scheinbar erfordern die Technologien von heute einen riesigen Wissens-
hintergrund. Ich selbst stieß im Studium auf eine ungeahnte Wissens-
fülle, aus der ich erst viel später Nutzen zog. Normalerweise wäre mir
dieses Wissen verborgen geblieben. Nicht jeder Funkamateur hat so
eine Möglichkeit. Nicht jeder möchte sie haben. Wir alle bringen unter-
schiedliche Fähigkeiten und Interessen mit. Das macht uns nicht besser
oder schlechter, nur unterschiedlich.
Technisch interessierte Funker haben heutzutage in kleinen Bereichen,
wie z. B. dem QRP-Betrieb, überlebt. Dabei sehe ich das im Shack
respektive am „Küchentisch“ Machbare durchaus mit dem nötigen
Realismus. Es gibt jedoch viele Bereiche, die nicht nur am Rand exi-
stieren sollten, sondern die mehr Beachtung verdienen.
Wollen Sie ein Beispiel dafür?
In dieser Ausgabe testet DK7ZB ein industrielles Fertiggerät − voller
High-Tech vom Feinsten. Der Selbstbau eines solchen Antennentuners
wäre von einem beruflich wie familiär mitten im Leben stehenden
Funkamateur praktisch kaum zu bewältigen. Seine Anwendung indes
eröffnet ein ungeahntes Betätigungsfeld für Antennenexperimente
und darauf aufbauende DX-Erfolge!
Ich denke, das ist eine von vielen Herausforderungen für den ursprüng-
lichen Amateurfunk im angebrochenen Jahrtausend. Zeigen wir der Welt,
daß die existierenden Technologien auch über das „Black-Box-Niveau“
hinaus verstanden und benutzt werden können. Laßt unsere eigenen,
unverwechselbaren Technologien entstehen und gedeihen.
Ingo Meyer, DK3RED
Pisa und unsere Schieflage
Die Ergebnisse der internationalen Leistungsvergleichsmessung PISA
(= Programme for International Student Assessment), durchgeführt in
den Mitgliedsstaaten der OECD zum Ende der Pflichtschulzeit, sind
eine Blamage für unser Land; nach früheren Studien, Verlautbarungen
der Hochschulen und Warnungen der Wirtschaft konnten die Ergeb-
nisse nicht überraschen: Deutsche Schüler befinden sich in allen
untersuchten Kompetenzfeldern im letzten Drittel!
Die Lesefähigkeit stand im Mittelpunkt der Untersuchung. Wer eine
Bauanleitung lesen kann, ist noch lange nicht in der Lage, sie um-
zusetzen, geschweige denn zu bewerten, ob das Beschriebene so
funktionieren kann. Deshalb ist Lesekompetenz ein Hilfsmittel zum
Erreichen persönlicher Ziele sowie eine notwendige Bedingung zur
Weiterentwicklung eigener Fähigkeiten, aber auch der Schlüssel zum
Erfassen mathematischer und naturwissenschaftlicher Zusammen-
hänge überhaupt. Und dort liegen die Schwächen offen.
Überschlagen wir die Aussagen zur mathematischen Grundbildung
und wenden uns der naturwissenschaftlichen zu. Hier hat PISA weniger
das Faktenwissen, sondern das Verständnis und die angemessene
Anwendung naturwissenschaftlicher Konzepte untersucht und erhebt
den Zeigefinger dort, wo dieses Schulwissen bei außerunterrichtlichen
Situationen versagt, wo für die Punkte und nicht fürs Leben gestrebt
wurde.
Gibt es hierzulande überhaupt noch Anwendungsmöglichkeiten für
naturwissenschaftliche Zusammenhänge? Die Modelleisenbahn ist
Vergangenheit, mit dem Stabilbaukasten hat der Vater gespielt, vor-
gefertigte Teile à la Lego bieten kaum noch Anregung für kreatives
Spielen. Und selbst das Wenige wird durch Computerspiele ersetzt,
die die Phantasie in enge Bahnen lenken. Jeder Jugendliche nutzt
ein Handy, aber wie viele wollen wissen, wie’s funktioniert?
An deutschen Schulen können weder schwache Schüler unterstützt
noch solche mit Spitzenniveau gefördert werden. Woher soll’s auch
kommen, wenn zwar Ganztagsbetreuung gefordert wird, aber Billig-
modell gemeint ist? Wir brauchen Anreize, damit sich Schülerinnen
und Schüler mit hoher Motivation in naturwissenschaftliche Zusam-
menhänge praxisorientiert einarbeiten können.
Die Teilnehmerzahlen des Wettbewerbes „Jugend forscht“ nehmen in
einigen Regionen erfreulich zu. Junge Menschen, die sich mit tech-
nischen Zusammenhängen freiwillig und nachhaltig beschäftigen,
kommen in den letzten Jahren zunehmend aus dem Amateurfunk-
bereich. 2001 waren es alleine am Standort Hildesheim acht junge
Funkamateure, die bei der Jugend-forscht-Runde Preisträger wurden.
Einige von ihnen belegten sogar im Bundesmaßstab beste Plätze!
Eine Befragung bei zufällig ausgewählten Ortsverbänden erbrachte
eine weitere Aussage, die indes nicht neu ist: Viele spätere Ingenieure
waren in ihrer Schulzeit Funkamateure, und ihr Berufswunsch wuchs
durch eigenes Experimentieren über den Physikunterricht hinaus.
Amateurfunk für Jugendliche als Allheilmittel? Wohl kaum − jedoch ein
nützliches Mittel zum Zweck, das den engagierten Einsatz nicht nur
von funkenden Lehrern, sondern auch von Eltern und Ortsverbänden
erfordert!
Wolfgang Lipps, DL4OAD
Zwei Seelen und der Fortschritt
„Sind die DARC-Mitglieder mehrheitlich pro oder kontra in der Frage,
ob der DARC für oder gegen CW als Zugangsvoraussetzung für die
Kurzwelle votieren soll?“ Mit dieser Frage wird sich eine Arbeitsgruppe
des Deutschen Amateur Radio Clubs an seine Mitglieder wenden. Die
genauen Modalitäten waren bei Redaktionsschluß noch nicht bekannt.
Jedenfalls ist die Hinzuziehung eines Notars beschlossene Sache. Sie
wird das „basisdemokratische“ Mitgliedervotum gegen Manipulations-
verdacht absichern.
Da auch DARC-Mitglied, sollte ich in dieser Angelegenheit wohl eben-
falls abstimmen. Doch wohnen gerade als Klasse-1-Amateur zwei
Seelen in meiner Brust: Ich würde schon gern sehen, daß zumindest
ein großer Teil der KW-Amateure der Telegrafie mächtig ist und sie auch
tatsächlich nutzt. Und der mit dem Erlernen verbundene Ausdauereffekt
würde ja, wie oft genug beschworen, bei den KW-Eleven vielleicht
weiterhin tatsächlich die Spreu vom Weizen sondern.
Oder gar so wenig Weizen übrig lassen, daß bald nur noch Rentner
auf den KW-Bändern zu hören sind? Einem unvoreingenommenen
Newcomer ist ja die Notwendigkeit einer Morseprüfung aus Sicht der
aktuellen technischen und funkbetrieblichen Möglichkeiten sowieso
kaum zu vermitteln, will man sich nicht dem Vorwurf hoffnungsloser
Antiquiertheit aussetzen.
Da überzeugen hierzulande zumeist weder Kommunikationsmöglich-
keiten ohne Fremdsprachenkenntnisse noch die Nutzbarkeit einfachster
Technik, eher dagegen die Tatsache, daß es sich hier um eine im Ama-
teurfunk sehr weit verbreitete Betriebsart handelt, die man ob ihrer Vor-
züge nach Bedarf vielleicht doch früher oder später beherrschen lernen
möchte.
Die inzwischen bei uns und in vielen anderen Ländern lediglich erfor-
derlichen 25 ZpM stellen ohnehin eher ein Feigenblatt dar, um den
noch gültigen internationalen Bestimmungen zu genügen. Bei diesem
Telegrafietempo kann man zur Not Striche und Punkte aufs Papier
malen; wer es in der Prüfung schafft, beweist bestenfalls, daß er eine
Vorstellung von dieser Übertragungsart gewonnen hat, nicht etwa,
daß er sie beherrscht. Set and forget.
Der Zug ist offenbar längst abgefahren. Die Gremien der Regionen 2
und 3 der International Amateur Radio Union haben sich bereits gegen
die Telegrafieprüfung als KW-Zugangsvoraussetzung ausgesprochen.
Und weit wichtiger: Auch die CEPT als Organ vieler europäischer Fern-
meldeverwaltungen favorisiert die Aufgabe des Nachweises von Morse-
kenntnissen bei Amateurfunkprüfungen für den Kurzwellenbereich. Die
Behörden hören selbstverständlich die Verbände der Funkamateure an,
müssen anderseits aber auch ganz nüchtern die gesellschaftlichen
Erfordernisse ins Kalkül ziehen, und die Notwenigkeit von CW-Kennt-
nissen zur Aufnahme von Notrufen ist eben schon einige Zeit gegen-
standslos.
Umfrage hin, Umfrage her. Das Ergebnis könnte den CW-freien KW-
Zugang eventuell etwas hinauszögern. Mehr nicht, ob es mir nun paßt
oder nicht. Versuchen wir als Telegrafisten lieber, unsere Begeisterung
auf die Neuen zu übertragen. Und denken wir über alternative Prüfungs-
inhalte zum Nutzen des Amateurfunks nach.
Vy 73 (ja ja, die CW-Kürzel…)
Bernd Petermann, DJ1TO
Zur Kasse, bitte…
Kostenlos war gestern. Jetzt wird Ernst gemacht im Internet. Der Run
auf den „schnellen Euro“ setzt ein. Für Inhalte auf den Webseiten
soll nun bezahlt werden. Die Telekom macht’s vor − und bald werden
sicher viele Content-Anbieter diesem Beispiel folgen. Film, Musik,
Infos, Sport & Spiel, zusammengefaßt im sogenannten „T-Vision“-
Portal: Ab Anfang 2002 wird’s via DSL kostenpflichtig. Und die
Abrechnung ist so schön bequem, die kommt gleich mit der Telefon-
rechnung. So weit, so schlecht! Aber, daß die schöne bunte Web-
Welt früher oder später mal nicht mehr zum Nulltarif zu haben sein
würde, war ja eigentlich schon immer klar. Nun kommt das Unver-
meidliche also früher statt später.
Die vielen gescheiterten Internet-StartUps und „Dotcoms“ haben uns
doch schon vor etlicher Zeit gezeigt, daß hochfliegende Visionen
einfach nicht reichen, um ein erfolgreiches Business zu etablieren.
Selbst für große, solvente Unternehmen rechnet sich da das Gratis-
Engagement mit der bloßen Hoffnung auf Werbeeffekte nicht (mehr).
So wird beispielsweise das Medien-Unternehmen Gruner + Jahr zum
31. Dezember 2001 seinen in der Onliner-Welt beliebten und bekannten
„ComputerChannel“ einstellen, Arbeitsplatzabbau bei den Online-
Redaktionen inklusive. Begründung für den Wegfall des kostenlosen
Dienstes: mangelnde Wirtschaftlichkeit und eine von G+J geplante
„Neuausrichtung der Multimedia-Aktivitäten“. Na, ahnen wir hier viel-
leicht etwas?
Andererseits muß Geld verdient werden, um im Internet zumindest
kostendeckend arbeiten zu können. Informationen müssen beschafft,
redaktionell aufbereitet und gepflegt werden. Da steckt viel Arbeits-
zeit drin − und der Web-Redakteur will auch am Monatsende das
Brot unter der Wurst haben...
So neu ist diese Erkenntnis jedoch gar nicht. Kommerzielle Aktivitä-
ten sind schließlich längst gang und gäbe via Web. Angefangen vom
(schon klassischen) Buchverkauf bei Amazon über die Shop-Seiten
der vielen Versandhändler bis hin zum zahlungspflichtigen Abo-Service
für Digitalmusik, den Tiscali seit jüngster Zeit anbietet. Gerade im
letztgenannten Segment wacht man erst jetzt so langsam auf. Seit es
sich kostenlos „ausgenapstert“ hat, drängen eine ganze Reihe Musik-
anbieter und Labels ans Portemonnaie des geneigten Kunden.
Auch Rundfunk und Fernsehen möchten ihr Stück vom Kuchen abha-
ben. Wenn die Neufassung des Rundfunk-Staatsvertrags im Januar
2005 in Kraft tritt, würde ich darauf wetten, daß das Thema „Internet-
Gebühren“ für die „Öffentlich-Rechtlichen“ dort fest verankert sein wird.
Das Argument lautet dann wahrscheinlich, daß Internet inzwischen zur
Grundversorgung gehört. Schon die letzte Funkausstellung zeigte ja,
wie sehr Telekommunikation und Web immer weiter miteinander ver-
schmelzen. Also: Zur Kasse, bitte…
Doch keine Sorge: Das Online-Angebot des FUNKAMATEUR wird,
wie ja bereits in der vorherigen Ausgabe diskutiert, weiterhin eine
kostenfreie Ergänzung zur Printausgabe bleiben. Als „Bonus zum Heft“
sozusagen. Gehört alles zum Service ;-)
Schönes Websurfen wünscht Ihnen Ihr
Dr.-Ing. Reinhard Hennig, DD6AE
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
FUNKAMATEUR aus dem Internet?
Funkamateure waren schon immer Vorreiter beim Einsatz neuer
Technologien, und so nimmt es nicht wunder, daß gemäß jüngster
Umfrage ein großer Teil unserer Leser inzwischen vom Informations-
medium Internet regen Gebrauch macht. Anfangs als „Konkurrenz“
zum Amateurfunk und als „nicht waidgerecht“ argwöhnisch beäugt,
sind der riesige Fundus an dort gespeichertem und frei zugänglichem
Wissen sowie der Gedankenaustausch auf diesem Wege inzwischen
als wesentliche, nicht mehr wegzudenkende Bereicherung unseres
Hobbys allgemein akzeptiert.
Klar, daß wir seit Jahren auf diese Entwicklung mit einer möglichst
informativ gestalteten Web-Site reagiert haben, an deren Verfeinerung
wir ständig arbeiten. Intention dabei ist es, Ihnen brandheiße Infor-
mationen zu liefern, einen Zusatznutzen zu laufenden Ausgaben zu
bieten, die Suche nach zurückliegenden Beiträgen zu erleichtern, alles
in allem also Service für Sie zu erbringen. Last but not least zählen dazu
ein Online-Shop für die Produkte des FA-Leserservice einschließlich
nicht mehr am Kiosk erhältlicher Ausgaben. Und Sie dürfen darauf
gespannt sein, was wir uns noch alles für Sie einfallen lassen…
In letzter Zeit häufen sich per E-Mail Klagen, daß man einen bestimm-
ten Beitrag gesucht und auf der Web-Site nicht gefunden hätte.
Freilich hat die Internet-Präsenz einer Fachzeitschrift über Inhalte
zu informieren und einen Einblick in die Themenvielfalt zu geben.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, stellen wir das jeweils
aktuelle Inhaltsverzeichnis ins Netz, und an einer verbesserten Such-
möglichkeit in den Inhaltsverzeichnissen zurückliegender Hefte
arbeitet unsere Web-Agentur gerade. Genau wie viele andere Zeit-
schriften, greifen wir bestimmte Beiträge heraus, die wir auf diesem
Wege veröffentlichen − es sind bei uns im wesentlichen die Testberichte
von Amateurfunkgeräten, ergänzt um die jeweiligen Typenblätter.
So ersparen wir Abonnenten langwieriges Blättern und bieten Gelegen-
heitslesern wertvolle Informationen, die vielleicht Interesse an einem
„Mehr“ wecken. Denn, liebe Leser, einen Aspekt dürfen wir nicht außer
acht lassen: Die Aufbereitung der eingehenden Manuskripte bis hin
zur Drucklegung (s. FA 6/01, S. 592 ff.) ist ein aufwendiger Prozeß, der
eine Menge Geld kostet, so daß wir als unabhängiger Verlag zwingend
auf die Verkaufserlöse angewiesen sind.
Funkamateure und Elektronikbastler sind findig und entlasten gern
ihr Budget − eine freie Downloadmöglichkeit für komplette Heftinhalte
würde im Zuge stetig wachsender Übertragunsgraten ganz sicher
den einen oder anderen Leser zur „Kostenoptimierung“ veranlassen −
eine Entwicklung, die unter dem Strich niemandem nützen würde.
Sehen Sie es uns also bitte nach, daß wir unsere Web-Präsentation
konzeptionell als Ergänzung unserer Zeitschrift ansehen und als Weg,
Ihnen topaktuelle News zukommen zu lassen, nicht als Online-
Variante der Papierausgabe. Apropos, was würden Sie neben dem
gedruckten Heft von einem solchen „E-Paper“ halten, das paßwort-
geschützt nur Lesern zugänglich ist, die dafür bezahlt haben?
Auf Ihr Echo freut sich
Ihr
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD@funkamateur.de
2754 haben mitgemacht
Sie haben uns wirklich überrascht, liebe Leser. Zum einen mit Ihrer
zahlreichen Teilnahme an unserer Leserumfrage in Heft 9, zum
anderen dadurch, wie Sie abgestimmt haben. 2441 Anwortkarten und
313 ausgefüllte Formulare im Internet verschaffen uns jetzt einen
Überblick in bezug auf Ihre Vorstellungen von Ihrer Zeitschrift und Ihre
Bewertung dessen, was wir monatlich leisten. Als Verlag, dessen
Mitarbeiter selbst praktizierende Funkamateure und Elektroniker sind,
können wir natürlich viele Dinge aus dem Bauch heraus entscheiden.
Nun aber sind wir in vielem bestätigt und kennen die Richtung, in die
wir die Zeitschrift weiterentwickeln müssen.
Nun zu Einzelheiten. Bemerkenswert ist, was Sie am FUNKAMATEUR
besonders mögen. Ganz vorn in der Wertschätzung steht die Fach-
kompetenz, praktisch gleichauf die Themenvielfalt, knapp gefolgt von
der Aktualität. Aufmachung und Preis spielen eher Nebenrollen. Ganz
zu schweigen von unserem Engagement im Internet.
Was die Optik der Zeitschrift angeht, so finden sie 86 % (noch) zeit-
gemäß. 67 % gaben an, die Daten- und Typenblätter zu sammeln, wobei
78 % der Leser Amateurfunk als Hobby ausüben und 44 % sich aktiv
mit Elektronik beschäftigen. Hier konnte beides angekreuzt werden.
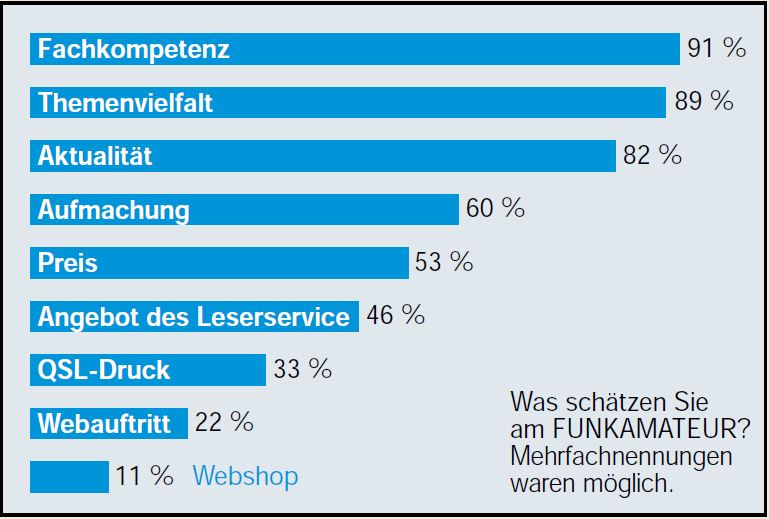
Für 72 % ist der Computer beim Hobby wichtig, aber nur 52 % lesen
nebenbei „richtige“ PC-Zeitschriften. 66 % der Teilnehmer verfügen
bereits über private Internetzugänge.
Obwohl noch nicht alle Zuschriften ausgewertet sind, zeigen sich
deutliche Trends. Antennen, für die sich 69 % sehr und 20 % etwas
interessieren, stehen ganz obenan; Randthemen sind der CB-Funk
mit 8% (sehr) bzw. 19 % (etwas); sehr ähnlich LPDs und PMR446.
Bei Computerthemen haben 49 % kein Interesse an Programmierung,
in der Elektronik wollen 43 % keine Beiträge zu Mikrocontrollern.
Sobald alle Karten ausgewertet sind, werden wir die Ergebnisse
diskutieren und, falls nötig, Schlußfolgerungen ziehen. Allerdings ohne
die von 89 % geschätzte Vielfalt einzuschränken.
Zum Schluß noch ein Wermutstropfen. Auch wir müssen beim Druck
seit geraumer Zeit deutlich mehr für Papier ausgeben. Deshalb hat
gerade eben auch unser direkter Mitbewerber den Heftpreis auf
7,50 DM angehoben. Mit 6,50 DM markiert der FUNKAMATEUR
so auch in Zukunft das untere Ende der Preisskala für Funk- und
Elektronikzeitschriften, wie Sie in jeder Bahnhofsbuchhandlung leicht
feststellen können.
Abonnenten können weiterhin deutliche Preisvorteile in Anspruch
nehmen, sie sparen bis zu 0,50 o pro Heft! Und die Tatsache, daß sie
das druckfrische Heft im Schnitt eine Woche vor dem Verkaufsbeginn
im Briefkasten haben, ist eh unbezahlbar…
Vielen Dank fürs Mitmachen und Ihr Verständnis.
Knut Theurich, DGØZB
Selbstgemachtes
Unken, Schwarzseher, Pessimisten auf allen Bändern − bisweilen
glaube ich, in einer anderen Welt zu leben. Manch einer redet den
Amateurfunk tot, als wenn er dafür bezahlt würde. Internet, Konsum-
denken, Technikfeindlichkeit kontra Amateurfunk.
Die IFA − Internationale Funkausstellung in Berlin, geradezu eine
Tempelveranstaltung des Konsums, hat das Gegenteil gezeigt. Es gibt
noch reges Interesse am Amateurfunk. Nein, nicht unbedingt an
Geräten mit Displays und vielen Knöpfen, Aufmerksamkeit rief bei
vielen Besuchern die kleine Ausstellung selbstgebauter Sender und
Empfänger hervor. „Das gibt es tatsächlich, Ihr baut Eure Geräte noch
selbst?“ Amateurfunk als Refugium der Selbstbe(s)tätigung.
In einer von Medien dominierten Welt, in der die Werbung für ständig
steigenden Konsum von Fastfood-Waren wie eine Dampframme auf
die Menschen einhämmert, steigt der Anteil derjenigen, die dem
Konsum entfliehen wollen. Ein völlig normaler Vorgang: In lebens-
feindlicher Umwelt werden Überlebensstrategien entwickelt. Schreber-
gärten stehen wieder hoch im Kurs, selbstgestrickte Pullover und eben
auch selbstgebaute Amateurfunkgeräte. Der Reiz ist da, sich selbst
zu versuchen, aus dem Trott auszubrechen.
Glücklicherweise haben die existierenden Amateurfunkmagazine den
Trend bereits erkannt und veröffentlichen verstärkt Beiträge, die zum
Nachbau anregen. Bastelkurse von Ortsverbänden des DARC haben
regen Zulauf, die Arbeitsgemeinschaft für QRP und Selbstbau im
Amateurfunk DL-QRP-AG wächst weiter, und die Projekte der AATiS
werden in vielen Schulen begeistert nachvollzogen. Das zeigt aber
auch, daß die Zukunft des Amateurfunks in starkem Maße davon
abhängt, wie gut die Unterstützung der Funkamateure durch die
Magazine und vor allem durch die Amateurfunkgruppen ist.
Mehr als zwei Drittel der Funkamateure sind gehobene Laien. Für
die Ausübung ihres Hobbys ist die Prüfung vor der RegTP zwar
obligatorisch, den meisten gibt sie aber noch nicht das Rüstzeug,
ihr Hobby optimal zu betreiben. Der DARC und seine Gliederungen
müssen erkennen, daß neben der Vertretung auf der politischen
Bühne eine stärkere Orientierung auf diese Mitglieder erforderlich ist.
Von oben nach unten brauchen wir ein eigenes Bildungssystem.
Wir benötigen bessere Konzepte für Lehrgänge sowie Leitfäden für
diejenigen, die sie durchführen. Ein Verband ist jedoch immer nur
so stark, wie die Beteiligung seiner Mitglieder.
Hoffen wir, daß sich genügend Fachleute bereitfinden, aus Liebe
zum Amateurfunk ihr Wissen in den Klub einzubringen. Ideal wäre
sicherlich, wenn sich einige Diplomanden mal im Rahmen ihrer
Diplomarbeit mit der Problematik beschäftigen würden. Hoffen wir
auch, daß die verantwortlichen Vorstandsmitglieder, Distrikts-
vorsitzenden und Ortsvorsitzenden bereit sind, die ausgelatschten
Pfade zu verlassen und diese Hilfe anzunehmen.
vy 72
Peter Zenker, DL2FI
Gerüttelt und geschüttelt
Eine neue Betriebsart krempelt die Szene der UKW-DXer seit einigen
wenigen Wochen gewaltig um: Dr. Joseph Taylor, K1JT, ein Nobel-
preisträger unter den Funkamateuren (Physik 1993), sorgt mit seiner
kostenlosen Software WSJT für jede Menge Diskussionsstoff unter
den VHF-Freaks und droht, sie in verschiedene Lager zu spalten.
Was heißt WSJT? WSJT steht für Weak Signal Communication von
K1JT. Was tut es? Mit Hilfe dieser Software läßt sich ziemlich bequem
mittels eines Interfaces zum Transceiver Meteorscatterbetrieb durch-
führen. Alle 30 Sekunden werden die zu übertragenden Informationen
über ein NF-Signal (4 Töne) mit einem Tempo von etwa 9000 Buch-
staben pro Minute ausgesendet, und eingehende Reflexionen werden
ebenfalls im gleichen Intervall ausgewertet. Der Computer erledigt
alles Notwendige, CW-Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Und das ist der eigentliche Grund, warum sich die Geister der
Meteorscatter-Philosophen scheiden − der OP scheint jetzt über-
flüssig geworden zu sein. Nun, so ganz trifft das auch nicht zu,
immerhin muß er eine geeignete Frequenz am Transceiver einstellen
und auf dem Bildschirm nach sauber dekodierten und sinnvollen
Zeichen suchen.
Wird die Software noch weiter verfeinert, so meinen etliche lang
gediente UKW-Funkamateure, bestünde die Möglichkeit, daß der
OM früh, bevor er z. B. einer geldbeschaffenden Tätigkeit nachgeht,
eine bestimmte Frequenz einstellt und es dem Programm überläßt,
aus den empfangenen Signalen neue Stationen auszuwählen, mit
diesen ein MS-QSO durchführt und die Daten anschließend im
elektronischen Logbuch verewigt. Kommt der OM wieder nach
Hause, findet er unter Umständen Informationen über neue
gearbeitete Locatoren oder DXCC-Gebiete vor.
Aber irgendwie wäre das auf Dauer nun auch wieder ziemlich lang-
weilig. Der Spaß, an der Station zu sitzen und selber übers Band
zu drehen, wird sicherlich nicht zu ersetzen sein.
Das Argument, daß der OP selbst keine CW-Signale mehr auswertet
und somit überflüssig erscheint, zählt in meinen Augen allerdings
nicht. Welcher OM hat eigentlich beim schon viele Jahre existierenden
RTTY jemals selbst etwas dekodiert? Das machte z.B. die altgediente
T51, und heute tun es die PCs mit oder auch ohne Soundkarte.
Wer „verteufelt“ PSK31 und andere digitale Betriebsarten? Es sind
wenige. Spannt man den Bogen weiter, landet man bei der Frage
der Notwendigkeit von CW-Kenntnissen. Für viele Neueinsteiger im
Amateurfunk besteht, und das ist nicht neu, kein Interesse an der
Telegrafie, eher an der Umsetzung von digitalen Modes. Und die-
jenigen, die an CW Spaß haben, zwingt auch keiner, es zu lassen.
WSJT bietet Neulingen und bisherigen „SSB-Puristen“ auf dem
UKW-Bereich ein tolles Betätigungsfeld, für andere ist es jedenfalls
mindestens eine nette Alternative. Jeder nach seinen Möglichkeiten
und Interessen. Und zur Erhöhung der Aktivität auf dem 2-m-Band
trägt WSJT unzweifelhaft bei. Und darüber sollten wir uns schließlich
freuen!
Vy 73!
W. Bedrich , DL1UU
Schwierige Zeiten
Wie nie eine Ham Radio zuvor stand die Nummer 26 unter ungün-
stigen Vorzeichen. Ökosteuer, Neuer Markt und Inflation haben tiefe
Löcher in die Portemonnaies auch der Funkamateure gerissen. Die
Unsicherheit in bezug auf PLC und Zusatzausgaben, wie die dem-
nächst von jedem zu tragenden Mehrkosten der beschlossenen
Rentenreform, stellen teure Neuanschaffungen für das Hobby
zwangsläufig weit hintenan.
Kein Wunder also, daß die Amateurfunkhändler mit sehr gedämpften
Erwartungen nach Friedrichshafen gefahren sind. Einige langjährige
Stammaussteller hatten wegen der hohen Kosten sogar ganz auf
eine Teilnahme verzichtet. Aber nicht nur die geringere Anzahl
von Ständen war der Attraktivität der Veranstaltung abträglich.
Auch an den Zustand des Freigeländes und die Dunkelheit in der
für die Kommerziellen reservierten Halle 6 konnte man sich nicht
gewöhnen.
Um so erfreulicher, daß dennoch praktisch alle im Nachgang befrag-
ten Aussteller eine positive Bilanz zogen. Zum einen hat der Anteil
ausländischer Besucher, die teilweise mit langen Einkaufslisten an
den Bodensee gekommen waren, zugenommen, so daß auch kom-
plette Stationsausrüstungen über die Verkaufstische gingen. Davon
profitierten zuerst die „Vollsortimenter“, wie Difona und WiMo. Zum
anderen resümierte beispielsweise Herr Smolka von UKW Berichte
schon jetzt ein erfreuliches Interesse an Equipment für den AO-40-
Funkbetrieb.
Alles in allem lagen die Umsätze leicht über denen des Vorjahres.
Zuwachs auch beim AATiS, der etliche neue Mitglieder gewinnen
konnte; wir übrigens 42 neue Abonnenten.
Auffallend war der Trend zum Prozente-Schinden, wobei wieder
einmal Dumpingpreise an einigen Ständen nicht nur ausländischer
Händler ursächlich waren. Viele Besucher gaben trotzdem für Geräte
mit einer lupenreinen Deutschlandgarantie bewußt mehr aus.
Insgesamt aber funktioniert das Kerngeschäft des Handels, also der
Verkauf von Amateurfunkgeräten mit akzeptablen Margen, in Deutsch-
land schon lange nicht mehr, wovon nicht nur die Einzelhändler,
sondern auch die Importeure betroffen sind. Machte per 31. März
dieses Jahres noch Alinco die Vertretung in Frankfurt/M. dicht, so
zieht nun Yaesu nach und konzentriert ab 1. August alle Vertriebs-
und Serviceaktivitäten in Holland. Das senkt die Kosten und sollte
im zusammenwachsenden Europa ohne negative Auswirkungen auf
Service und Ersatzteilversorgung bleiben.
Was die Ham Radio als größte europäische Veranstaltung dieser Art
betrifft, so steht zu befürchten, daß die Talsohle noch nicht erreicht
ist. Denn nach bisherigen Planungen soll die 27. die letzte große
Messe sein, die auf dem alten Gelände stattfindet, so daß erst im
Sommer 2003 das neue Ambiente wieder mehr Aussteller und
Besucher anlocken wird.
Da werden wir im nächsten Jahr laut trommeln müssen…
Knut Theurich, DG0ZB
Mit einer Träne im Knopfloch…
Nach gut 35 Jahren beende ich mit dieser Ausgabe meine inzwischen Halb-
tags-Tätigkeit beim FUNKAMATEUR. Das bringt hoffentlich Zeit, allerlei
Liegengebliebenes aufzuarbeiten und selbstverständlich mehr zu funken.
Ein Anlaß, zurückzublicken und über diese Zeit nachzudenken. Das gesamte
Berufsleben in ein und demselben Job zuzubringen scheint ja aus heutiger Sicht
eher die Ausnahme und wird wohl obendrein nicht (mehr?) als erstrebenswert
angesehen. Ich jedenfalls bin dankbar für diesen „lebenslangen“ Job, der zwar
genug Streß und manchen Ärger, aber auch viel Freude bereitet hat.
Einzig der Einstieg zeigte sich als einer der sonst häufigeren jähen und unvorher-
gesehenen Wechsel im beruflichen Werdegang: Nach dem Studium, als Frucht
diverser Mühen wahrhaftig Wunschziel HF-Technik, ging es um einen Arbeitsplatz.
DDR-üblich, offerierte die Absolventenvermittlung Angebote, nur waren die
interessanten der maßgeblichen Berliner Betriebe leider besetzt. Doch dann
durfte ich mir nach einem Preisausschreiben im „Elektronischen Jahrbuch“ den
Hauptpreis, ein kleines Transistorradio, persönlich im Verlagsgebäude abholen.
Dort saß der Herausgeber dieser Bücher und gleichzeitig verantwortlicher
Redakteur des FUNKAMATEUR, Karl-Heinz Schubert − und man brauchte
gerade Verstärkung. Dipl.-Ing. im richtigen Fach, Funkamateur und Deutsch
Note 2. In Ordnung. Was wohl meine Deutschlehrerin dazu gesagt hätte?
Vieles vom Einmaleins des Redaktionsbetriebs hat mir dann neben K.-H. Schubert
auch Kollege Rudolf Bunzel beigebracht. Und ganz so monoton lief’s auch nicht.
Damals tippte noch die Sekretärin an der Schreibmaschine x-mal die redigierten
Manuskripte, der Druck lief über Bleisatz und geätzte Klischees, Röhrentechnik
und Amplitudenmodulation bestimmten den Inhalt. An Elektronik und ICs, SSB
oder Packet-Radio, computerisierte Textbearbeitung und Layoutgestaltung war
noch nicht im entferntesten zu denken, so daß, einschließlich politischem System,
heute doch kaum noch etwas so ist wie damals.
Insbesondere die Wendezeit hat ja für die Bewohner der neuen Bundesländer
eine berufliche Kontinuität in den allermeisten Fällen unmöglich gemacht. Doch
der FUNKAMATEUR überstand als eine von ganz wenigen Ex-DDR-Publikationen
die Wende, sogar mit den meisten früheren Mitarbeitern. Von ihnen trägt
Hannelore Spielmann, fast so lange im Geschäft wie ich, heute noch zu gutem
Stil und fehlerfreiem, korrektem Deutsch im FUNKAMATEUR bei.
Die Wende erwies sich allerdings auch für uns als überaus strapaziöse Heraus-
forderung, in der man sich oft genug vor dem Aus sah. Umzüge, Umstruktu-
rierungen, daneben in eine vielfältige Medienlandschaft abwandernde alte und
ein erweitertes Umfeld potentieller neuer Leser… Erst nach dem Übergang in
den Theuberger Verlag mit Chef Knut Theurich, selbst ehemaliger Redakteur
beim FUNKAMATEUR, gelang der Durchbruch. Punktgenaue Werbung und ein
zuverlässiger Vertrieb machten die Zeitschrift auch in den alten Bundesländern
so bekannt und beliebt, daß Sie heute dieses Editoral lesen können.
Nun müssen zunächst Wolfgang Bedrich, Dr. Werner Hegewald und Dr. Reinhard
Hennig, inzwischen bewährte Stammannschaft, die Lücke schließen. Sie sollen
allerdings bald Unterstützung bekommen; Endgültiges dazu steht z. Z. noch nicht
fest. Ich ziehe mich jedoch nicht ganz aus dem Geschäft zurück und werde der
Redaktion weiterhin beratend zur Seite stehen. Und auch als Kontaktperson
bleibe ich Ihnen erhalten; nutzen Sie dazu ggf. meine E-Mail-Adresse:
dj1to@funkamateur.de.
Bleibt mir abschließend, unseren Leser und Autoren Dank zu sagen, ganz
besonders denjenigen, die uns auch über die Wendezeit treu geblieben sind.
Vy 73 und awdh
Bernd Petermann, DJ1TO
Mobilmachung
Internet auf Tritt und Schritt. Im eigentlichen Sinne des Wortes. Die
Mobilmachung ist bereits in vollem Gange! Wetterberichte, Routen-
planungen und Navigationshilfen, Fahr- und Flugplandaten für unter-
wegs, Standorte von Hotels oder Stadtplan-Auskünfte − schon in
naher Zukunft wird es wohl kaum ein Thema geben, was nicht
drahtlos als Information abrufbar wäre.
Dabei haben WAP, E-Mail- und SMS-Versand via Handy bereits ihre
„Euphoriephase“, den sogenannten „Hype“ hinter sich, denn auch
im Markt für mobile Datendienste gilt die alte Weisheit, daß nichts
so beständig ist wie der Wandel.
Der E-Commerce, noch vor fünf Jahren mit großen Schlagworten
gefeiert, wurde längst durch das Stichwort M-Commerce abgelöst,
mobile Geschäftsaktivitäten also. Diese lösen nun wahrscheinlich
die nächste Trendwelle auf dem „Neuen Markt“ aus. Und das hat
nicht nur Konsequenzen für Inhalte und Dienstleistungen der einzelnen
Anbieter in diesem Segment, sondern bringt daneben zwangsläufig
auch vielfältige neue technische Herausforderungen mit sich, wie u. a.
den Aufbau ganzer neuer UMTS-Funknetz-Infrastrukturen, was dann
möglicherweise wiederum zu neuen strategischen Allianzen diverser
Mobilfunkanbieter führen wird − Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt
(in welcher Richtung auch immer) inklusive. Schon jetzt diskutieren
diese ja bereits Chancen für eine erste Zusammenarbeit, ganz profan
beispielsweise, um dadurch z. B. Kosten für die Errichtung von Sende-
masten zu sparen. Laut Regulierer hat bislang jeder Anbieter dieser
„Universal Mobile Telecommunication Systems“, um deren Frequenz-
zuweisungen ja, wie bekannt, heiß gepokert wurde, seine eigenen
Netze zu errichten. Wir werden abwarten müssen, welche gesetzlichen
„Aufweichungen“ hier vielleicht noch zu erwarten sind.
Auch im beruflichen Umfeld wird durch die „Mobilmachung des
Internets“ einiges in Bewegung geraten, denkt man an die drahtlose
Serveranbindung von Datenbanken im Umfeld von Logistik, Transport,
Verkehr, Banken oder Versicherungen, denn immer mehr Unternehmen
streben die Verlagerung ihrer Geschäftsaktivitäten an den „Ort des
Geschehens“ an, wie man sich bereits Ende März gut auf der Han-
noveraner Computermesse CeBIT überzeugen konnte.
Funkvernetzung ist offenbar Trumpf − wo auch immer man hinsieht.
Als Beispiel sei hier nur das drahtlose Verbinden von Notebooks über
Wireless-LANs genannt: Universitäten bauen ihre eigenen Funknetze
auf, so daß die Studenten mittelfristig nicht mehr in den Rechen-
zentren ihren Internet-Recherchen nachgehen müssen, sondern das
auch mobil und unabhängig von unterschiedlichsten, auch „stillen“,
Örtlichkeiten aus tun können.
Man sollte allerdings mittel- und langfristig überlegen, ob es Sinn
macht, angesichts immer knapper werdender Frequenzen und als
Kollateralschäden auftretender „Störnebel“ nun auch noch alles und
jedes − Stichwort ADSL, PLC & Co. − mit Hochdruck hochfrequent zu
machen. Die Bandbreiten solcher Systeme sind bei steigenden Nutzer-
zahlen eh’ begrenzt und führen in die Sackgasse. Hier sagen wir schon
seit langem: Glasfaser statt PLC! Fortschritt statt vermüllter Äther!
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Paradiesische Zustände?
Hurra − das Rabattgesetz fällt! Da kann sich OM Normalverbraucher
freuen, darf man doch schließlich davon ausgehen, daß es nun endlich
Rabatte auf die sündhaft teuren Amateurfunkgeräte gibt. Feilschen mit
dem Händler? Ein Muß. Vielleicht gibt’s auch ein Goldkettchen für die
XYL dazu, auf daß der Familiensegen gerettet sei. Wahrhaft paradie-
sische Zustände, die auf uns zukommen!
Fällt Ihnen etwas auf? Haben Sie nicht schon vor Jahren beim Kauf Ihres
neuen Stationstransceivers weit weniger als den Listenpreis bezahlt?
Na, so was. In den Annoncen unterbieten sich die Händler gegenseitig?
Schau an. Und als Sie letztens einen PL-Stecker kauften, wurden Sie
Zeuge, wie ein Kunde den Preis des Wunschgerätes erbarmungslos
herunterhandelte und sein Verlangen auf das Inserat eines anderen
Fachgeschäfts stützte. Prima.
Oder war es früher das Paradies, als es noch ein funktionierendes
Vertriebs- und Servicenetz für den Amateurfunk gab? Damals brauchte
ein Kunde kaum weiter als 100 km zu einem Händler zu fahren, bei dem
Geräte en masse vorführbereit standen und erfahrene Servicetechniker
mit der Hilfe hochkarätiger Meßtechnik, vor gut bestückten Ersatzteil-
magazinen sitzend, Reparaturen durchführten. Paradiesische Zustände −
jawohl!
Freilich wird jeder für ein ersehntes Produkt das günstigste Angebot
suchen, nur sollte die Kirche im Dorf bleiben. Amateurfunkgeräte sind
keine Massenbedarfsgüter wie Handys, Autos oder Gartenstühle. Die
Spezifik unserer Technik impliziert gravierende Unterschiede zu anderen
Branchen. Schon die empfohlenen Verkaufspreise der Hersteller sind so
kalkuliert, daß die Margen einen betriebswirtschaftlich vernünftigen
Geschäftsbetrieb gerade noch zulassen. Dabei ist der Verkauf der immer
komplexer werdenden Geräte äußerst beratungsintensiv. Wie oft bleibt
der Lohn für eine akribische Lehrvorführung aus, weil der nun bestens
informierte Kunde letztlich bei einem „Kistenschieber“ kauft, der sich
Kosten für Lagerhaltung, Ladenmiete, Meßtechnik und Servicepersonal
spart und dadurch viel „günstiger“ anbieten kann.
Und nun also noch höhere Rabatte auf den „Wunschpreis“! Dabei er-
fahren wir täglich aus den Nachrichten, was geschah und weiter ge-
schehen wird. Den jetzt von der BSE-Krise gebeutelten Bauern ging es
nämlich nicht viel anders: Auch sie wollten sich keine goldene Nase ver-
dienen, sondern nur die sich durch gnadenloses Erzwingen eines immer
niedrigeren Verkaufspreises anbahnende Pleite hinauszögern. Blättern
Sie einmal Inserate in älteren Zeitschriften durch und vergleichen mit
aktuellen Ausgaben: Viele Händler haben inzwischen ihre Geschäfte
mangels Sinnfälligkeit aufgegeben, wozu sich übrigens auch der Unter-
zeichnende zählt. Andere sind den Bach hinuntergegangen − nicht selten
solche, die lange mit besonders lukrativen Preise glänzten.
Wenn, wie eben geschehen, japanische Firmen ihre Deutschlandvertre-
tungen wegrationalisieren, ist es später als fünf vor zwölf.
Suchen Sie also ruhig weiter den billigsten Anbieter. Aber bedenken Sie,
daß der Weg zu ihm bestimmt nicht ins Paradies führt . Demgegenüber
ist jede Mark, die Sie „zuviel“ ausgeben, ein Beitrag zur Erhaltung des so
wichtigen Servicenetzes. Denn die Alternative wäre, daß wir zukünftig bis
zum Jüngsten Gericht warten können, ehe ein Transceiver repariert aus
Japan zurückkommt…
Ihr
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Go ahead
Trotz anhaltender PLC-Ängste sowie gerichtlicher Auseinandersetzungen
zwischen Usern und Sysops von Digipeatern und Mailboxen lassen sich
auch Entwicklungen positiver Art registrieren. Dazu gehören unzweifel-
haft die vielen Aktivitäten auf dem Gebiet des QRP-Selbstbaus und das
spürbar wachsende Interesse der DO-Genehmigungsinhaber an
Contesten, speziell auf dem 2-m-Band.
Wie ordnen sich letztere aber ins Contestgeschehen ein? Neben vielen
Stationen, die mit einer oder mehreren Antennen und „normalen“ 100 W
um die Punkte wetteifern, stehen ihnen auch Contestteilnehmer mit
kräftigeren Endstufen sowie Gruppenantennen in derselben Abrechnungs-
kategorie gegenüber und lassen berechtigte Zweifel am Sinn einer
Contestabrechnung aufkommen, in der sie sich mit ihren 10 W EIRP unter
gewöhnlichen Umständen im letzten Viertel der Ergebnisliste (sofern über-
haupt veröffentlicht) wiederfinden würden.
Nun sollte man sich davor hüten, einen speziellen QRP-Contest ins Leben
zu rufen (Conteste gibt es ja reichlich); eine separate Abrechnungskate-
gorie für QRP-Stationen innerhalb bestehender Conteste wäre sicher
praxisgerechter. Da höre ich schon die Widerrede: „Sollen die sich doch
weiterentwickeln, CW als Zugangsvoraussetzung für andere Genehmi-
gungsklassen wird eh entschärft, dann können sie auch legal powern!“
Dem könnte man entgegnen, daß eventuell im EMV-Zeitalter sowieso
die Tendenz zu geringeren Sendeleistungen führt.
Egal, der FA nimmt sich der QRP-OPs, gleich welcher Genehmigungs-
klasse, an. Auch und vor allem, um die Contestaktivität derjenigen OMs
zu steigern, die mit geringen Leistungen und außerdem nicht über
brachiale 24 Stunden an VHF-Contesten teilnehmen wollen, loben wir in
diesem Jahr zum ersten Mal eine 2-m-QRP-Trophy aus. Als Termine
gelten die DARC VHF-/UHF-Mikrowellenconteste im März, Mai und Juli
sowie der IARU-Reg.-I-VHF-Contest im September, wobei an mindestens
zwei Wettbewerben teilgenommen werden muß (man kann sich somit die
beiden aussuchen, die die meisten Punkte brachten).
Als Leistungsobergrenze gelten 10 W Ausgangsleistung (da setzen wir
ganz einfach Ham-Spirit voraus!). Der Abrechnungsmodus entspricht den
üblichen Contestabrechnungen, es zählt also die Punktzahl, allerdings,
und das ist der Unterschied, die jeweils innerhalb von vier zusammen-
hängenden Stunden erreicht wurde. Und die kann sich jeder Teilnehmer
nach Gutdünken selbst wählen: Entweder er nutzt die ersten vier Stunden
des Contests, in denen erfahrungsgemäß die höchste Beteiligung zu
verzeichnen ist, oder er wählt sich die frühen Morgenstunden, um even-
tuell über DX-QSOs mehr Punkte zu machen bzw. steigt mit seiner Trophy-
Wertung in den Vormittagsstunden ein, um die „dicken“ Conteststationen
mit QRP-Signalen zu beglücken.
Um an der Auswertung teilzunehmen, genügen z. B. Kopien bzw. Auszüge
aus den jeweiligen Contestabrechnungen. Einsendeschluß ist der 20.9.
des laufenden Jahres. Die Auswertung erfolgt jeweils in der Novemberausgabe
des FUNKAMATEUR.
Die zehn bestplazierten Teilnehmer bekommen eine Urkunde. Platz 1 erhält
die 2-m-QRP-Trophy, einen Kristallpokal mit eingraviertem Rufzeichen.
Go ahead, man hört sich am 5. bzw. 6.5. auf 2 m, wenn wir erstmalig unser
Jubiläumsrufzeichen DA0JF aktivieren.
Viel Erfolg!
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Viel Feind, viel Ehr?
Ein Spruch von Kaiser Wilhelm, nach dem offenbar auch heute noch vielfach
gehandelt wird − wenn auch nicht mehr im „patriotischen“, sprich militari-
stischen, Ur-Sinn, sondern eher im übertragenen des Strebens nach Achtung,
Anerkennung und gesellschaftlicher Stellung.
Auf hoher Ebene hat die viel beklagte Politikverdrossenheit ja ihre Ursache
wohl u. a. darin, daß zu oft der Eindruck entsteht, man hätte seine Stimme
so etwas wie einer Fußballmannschaft oder gar Einzelspielern gegeben, die
nichts anderes im Sinne haben, als um jeden Preis zu „gewinnen“, wobei
die Mittel und selbst Inhalte zweitrangig werden.
Doch eigentlich sind die Politiker ja angetreten, dem Volk zu dienen? Zu
vielen von ihnen fehlt anscheinend der Wille, Meinungsverschiedenheiten durch
Kompromisse zu glätten und dem Wahlvolk nach sachgerechter Analyse auch
einmal Unpopuläres aufzutischen, statt mit Kurzsicht bis maximal zur
nächsten Wahl aufeinander einzuhacken, was letztlich das Ansehen aller
Beteiligten schädigt, während es dringenden Handlungsbedarf blockiert.
Wie im Großen, so im Amateurfunk. Über kleinliche, oft periphere Streitereien
geraten die wirklichen Probleme wie Nachwuchsgewinnung, die Definition von
markanten, einmaligen Amateurfunkspezifika, das für die Zukunft sinnvolle
Prüfungsniveau, der technischen Entwicklung angemessene Prüfungsinhalte,
Initiieren und Durchsetzen innovativer Übertragungstechniken und -methoden,
die Reaktion auf Bedrohungen wie PLC, Bauordnungen und Elektrosmog-
hysterie, ins Hintertreffen. Manche taktisch kluge Lobbyarbeit wird infolge
mangelnder Kenntnis der Hintergründe sowie der Vorstellung, alles, was dem
Amateurfunk (vermeintlich) nütze, ließe sich wirklich durchsetzen, diffamiert.
Einige Funkamateure, die einmal angetreten waren, etwas voranzubringen,
hat ihr Profilierungsbestreben anscheinend das Augenmaß und den Sinn
für das Wesentliche vergessen lassen und sie schließlich in eine Sackgasse
getrieben, sie zu Außenseitern gemacht.
Nun ist trefflich darüber streiten, ob die Mehrheit immer recht hat, doch
mir scheint, daß da etliche Diskussionsansätze, selbst möglichst unvorein-
genommen betrachtet, eher destruktiv sind. Sicher macht einen auch
negative Publizität bekannt, es fragt sich dann aber doch, ob viel (selbst
geschaffener) Feind denn wirklich viel Ehr bedeutet.
Und dann ist da noch der Umgangston. Ich habe mir, nur so zum Spaß, eine
kleine Liste mit Charakteristika agiler Packet-Radio-Schreiber angelegt
und dabei Sachlichkeit, Umgangston, Stil und die zu bestimmten Dingen
vertretene Meinung bewertet. Ja, ja: Wie kann man bloß − dient aber wirklich
nur dem eigenen Bedarf, um bei neuen Beiträgen im Packet-Radio-Forum
feststellen zu können, ob mal jemand seine Linie verläßt.
Dabei habe ich mich für „Funkamateure“ geschämt, die im Grunde zwar
meinen Standpunkt vertreten, ihn jedoch durch ihre bis zur Unerträglichkeit
gehende, unsachliche, diffamierende und beleidigende Art quasi verraten;
von Unterstellungen, Verdächtigungen, Rufzeichenmißbrauch und unwahren
Behauptungen ganz abgesehen.
Andererseits gesteigerte Aufmerksamkeit und die Bereitschaft zum Nach-
denken auch über kontroverse, aber klar formulierte, übersichtliche und
höfliche Texte, selbst wenn man den Standpunkt des Schreibers nicht teilt
oder ihn eben sogar für destruktiv hält.
DL8OL formulierte es in einem PR-Beitrag vor kurzem so: Wenn jemand
etwas zu diskutieren hat, sollte er im eigenen Interesse schon ein wenig auf
die Form achten. Und woanders fand ich: Respektiere Deinen Gegner.
Fazit: Viel Feind, viel Ehr, hat schon im ersten Weltkrieg zu nichts geführt −
auch im Amateurfunk schadet es nur der letztlich doch gemeinsamen Sache!
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Rasante Entwicklungen
Haben Sie heute schon telefoniert? Wahrscheinlich! Die meisten Haushalte
verfügen ja derzeit zumindest über einen Festnetzanschluß, die moderne
„Handy-Manie“ mal gar nicht mitgerechnet. Überall und stets erreichbar
zu sein, ist inzwischen fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Doch
wußten Sie auch, wann dieses kommunikative Massenmedium das Licht
der Welt erblickte?
Jubiläum ist angesagt: 125 Jahre Telefon − am 14.1.1876 meldete der
amerikanische Physiker Alexander Graham Bell ein entsprechendes Patent
an − und wurde weltweit als „Erfinder des Telefons“ bekannt. Das Prinzip
seines Apparats: Im Hörer wurde eine Eisenmembran durch das vom
elektrischen Strom erzeugte Magnetfeld zum Schwingen gebracht, in der
Sprechkapsel war’s umgekehrt.
Bells Berufskollege Elisha Gray, der unabhängig von ihm in Amerika eben-
falls Versuche in dieser Richtung unternahm, kam mit seiner eigenen
Patentanmeldung − und zwar am selben Tag − ganze zwei Stunden zu spät.
Bell war schneller. Da half Gray auch ein nachfolgender Patentrechtsstreit
nichts mehr.
Doch bereits vor Graham Bell hatte schon 1863 der Deutsche Johann
Philipp Reis ein Gerät zur elektrischen Schallübertragung konstruiert, was
sich jedoch nie durchsetzen konnte und unbeachtet blieb. Bekannt ge-
worden sind hingegen einige der ersten Sätze, wie „Das Pferd frißt keinen
Gurkensalat“, welche über sein „Stricknadel-Telefon“ übertragen wurden.
Reis versetzte nämlich einen Resonanzkörper mit Hilfe einer Stricknadel, die
lose innerhalb einer stromdurchflossenen Spule gelagert war, in Schwin-
gungen…
Am Grundprinzip der Sprachübertragung hat sich seit den alten Tagen
nichts geändert. Evolution statt Revolution. Es sind nur immer neue
Technikelemente hinzugekommen. Aktuell sind ja WAP (Websurfen mit dem
Handy) und YAP (via Internet telefonieren ohne PC) die Schlagworte bei den
drahtlosen kleinen „VIP-Machern“…
Ebenfalls schon betagt: Nach der noch völlig mechanisch arbeitenden
Rechenmaschine Z1 (1936–38) entwickelte Konrad Zuse 1941 seinen Z3 −
der erste elektronische, programmgesteuerte Computer. Doch auch hier
kein Stillstand. Es ist erst ganze 54 Jahre her, als 1947 durch Shockley,
Bardeen und Brattain der Transistor erfunden wurde, wofür die Forscher
1956 den Nobelpreis erhielten.
Heute werden Transistoren massenhaft auf Chips integriert. Das von
Gordon Moore, dem Mitbegründer von Intel, 1965 aufgestellte und unter
seinem Namen bekannt gewordene „Gesetz“, wonach sich etwa alle
18 Monate durch Fortentwicklung von Know-how eine Verdopplung der
Transistordichte auf einem Chip ergibt, gilt offenbar noch immer. Heute sind
wir bei der Klasse der 1-GHz-CPUs in 0,13-μm-Technologie angelangt,
angekündigt sind von IBM schon 10-GHz-CPUs in 0,03-μm-Technologie.
Und ein Ende ist nicht abzusehen.
Schon bastelt man an Speichermedien, bei denen einzelne Atome Träger
von Information sein werden. Es bleibt auch und gerade für Funk- und
Elektronikinteressierte spannend, die weitere technische Entwicklung aktiv
mitzuverfolgen sowie deren Ergebnisse kreativ und mit eigenen Ideen zu
nutzen. Originelle Lösungen − das macht unser technisches Hobby doch
erst interessant.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Mit dem 50. Jahrgang ins 3. Jahrtausend
Mit dieser Ausgabe des FUNKAMATEUR halten Sie die erste unseres 50. Jahrgangs
in den Händen, was nicht heißt, daß wir in diesem Jahr Geburtstag feiern, ebenso
wie wir wohl zu den wenigen gehören, die erst jetzt das neue Jahrtausend begrüßen.
Auf letzteres nimmt die Postbox Bezug, das erste muß man wohl erklären: Den Start
des FUNKAMATEUR datieren wir auf Oktober 1952, also erschien 1952 der erste
Jahrgang. Folglich läuft 2001 der 50. Bei den Jahrgängen hinkt das echte Jubiläum
der runden Zahl also noch weiter hinterher, als beim Millennium, weil die erste
Ausgabe einer Zeitung oder Zeitschrift ja selten gerade im Januar auf den Markt
gebracht wird.
Leser im Rentenalter werden nun zu Recht einwenden, daß sie sich an eine eigen-
ständige Zeitschrift „Der Funkamateur“ erst seit 1955 erinnern können. Richtig,
diese Zeitschrift war Teil der GST-Presse und hatte sich aus ihrem Ursprung,
„Sport und Technik“, über „Sport und Technik − Nachrichtensport“ sowie „Sport
und Technik − Der Funkamateur“ herausgegliedert. Ab 1958 lautete der Titel nur
noch „funkamateur“, ab 1966 dann FUNKAMATEUR. Besagte „Sport und Technik“
erschien in ihrer ersten Ausgabe, eben im Oktober 1952, als Publikation der gerade
gegründeten Gesellschaft für Sport und Technik. Die unterstützte durchaus nicht
kleinlich, obwohl mit vormilitärischer Zielsetzung, auch eine Reihe eigentlich eher
unpolitischer Betätigungen, die bis dahin in der DDR nicht zugelassen waren, wie
Fallschirmspringen oder Segelflug. Im Rahmen des Nachrichtensports etablierte
sich mit der Verkündung der ersten DDR-Amateurfunkordnung im Februar 1953
sehr bald auch der Amateurfunk, dessen Themen zunächst in den Inhalt von
„Sport und Technik“ einflossen. Als dann „Der Funkamateur“ erschien, befaßte er
sich neben dem politischen Pflichtteil und dem Amateurfunk noch mit dem Radio-
basteln, selbstverständlich in Röhrentechnik. Mehr Arbeitsgebiete existierten für
einen lötfreudigen Amateur zunächst nicht, doch lohnte damals der Selbstbau noch,
sowohl hinsichtlich Originalität als auch kostenmäßig.
Als sich später die Elektronik entwickelte und folgerichtig viele Selbstbauer damit
umgingen, fanden sie mit ihrer Thematik gegen manche Widerstände im FA ihre
Heimstatt. Die strenge Planung der DDR bewies zu wenig Weitsicht, um für dieses
allmählich wachsende Gebiet eine eigene Plattform aus der Taufe zu heben. Ähnliches
wiederholte sich mit der Heimcomputertechnik, der sich nach einer gewissen Zeit-
spanne allerdings u. a. die GST annahm.
Als Folge geriet der Anteil der Funkamateure, wegen allerlei Restriktionen ohnehin
nicht sonderlich hoch, unter den Lesern bei einer voll verkauften (!) Spitzenauflage
von 130 000 weit ins Hintertreffen: Zeitschriftentitel und Inhalt divergierten deutlich,
was allerlei Querelen mit beiden Leserkreisen bewirkte. Andererseits hatten wir prak-
tisch ein Monopol, die einzige Konkurrenz, „radio fernsehen elektronik“, war zudem
eher am industriellen Bereich orientiert.
Die nervenzehrende Wende (der Verlag und die meisten Strukturen lösten sich auf,
die Leser hatten plötzlich diverse Alternativen) erforderte in der ja sehr spezialisierten
bundesdeutschen Zeitschriftenlandschaft zwingend eine tragfähige Konzeption. Nach
mancherlei Wirren gelangte der FUNKAMATEUR in den Theuberger Verlag. Das führte
zu einer Betonung des Amateurfunks, doch ohne Scheuklappen und ohne die meisten
anderen Themengebiete aufzugeben. Ein Konzept, das sich bis heute als erstaunlich
tragfähig erweist, allerdings nur durch zähe Arbeit auf vielen Ebenen zur Marktakzep-
tanz führte.
Für die Zeit bis zum Oktober ’02 haben wir uns außer der immer besseren Gestaltung
einer lesenswerten Zeitschrift einiges vorgenommen, so die RegTP zustimmt, Aktivität
unter DA0FA, ein kostenfreies FA-Diplom, Spezial-QSL-Karten, vielleicht eine besondere
Amateurfunkaktivität und mehr… Lassen Sie sich überraschen − und bleiben Sie
uns treu!
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Immer die anderen
Mit dem Einzug von PC & Co. ins Shack scheint DXen ja wirklich zum Kinder-
spiel geworden zu sein. Mußte man früher mühsam über das Band drehen,
um seine Gegenstation selbst zu suchen, so genügt es heute, sich die aktuellen
Bandmeldungen aus Packet- oder Web-Clustern auf den Desktop zu ziehen.
Gewiefte DXer hatten ein Gedächtnis wie ein Lexikon und wußten genau,
welches Land auf welchem Band noch fehlt. Heute sagt die Logging-Software
„ham wa/ham wa nich“, egal wie das Land heißen mag. Atlas und Weltkarte
können im Schrank bleiben, wer will da noch wissen, daß der Weg nach KH5
(was immer das bedeutet, es ist schlichtweg uninteressant) über den Nordpol
führt, der Rotor saust doch sowieso von allein in die passende Richtung. Ein
paar Mal auf den Rufzeichen-Button geklickt, bis man seitens der Gegensation
aufgerufen wird, dann noch kurz 59(9)-tu hinausgefeuert, und ein weiterer
Tastendruck verankert sämtliche QSO-Daten im elektronischen Log, ergänzt um
Namen, Manager und was es sonst noch gibt, aus der Datenbank. Echt einfach!
Nur an einer Stelle versagt der Computer: Er weiß nicht, wann das Call zu sen-
den ist, geschweige denn, bei Split-Betrieb, wo. Und da haben wir den Salat;
andauernd sind andere Rufzeichen zu vernehmen, nur das eigene nicht. Ver-
ständlich, daß da sehr schnell Frust aufkommt. Doch muß man sich das nicht
bieten lassen! Wenn DX „Charly Zulu please“ sagt, einfach trotzdem noch etliche
Male „Foxtrott Kilo X-ray“ in die Luft geblasen, vielleicht überlegt er sich’s ja
anders. Was hat, bitte schön, die DX-Station der Rest des andren Rufzeichens
oder gar der Rapport der Gegenstation anzugehen, er ist ohnehin 59(9), und
sollte sich da so ein Anfänger tatsächlich erlauben, sage und schreibe noch
seinen Namen zu erwähnen, da gibt es doch ein probates Gegenmittel: Immer
freiweg den Suffix hinausgeplärrt, damit sich der seltene Vogel gar nicht erst
mit solchen Belanglosigkeiten abgeben muß. Falls ein begehrter Afrikaner sich
anschickt, plötzlich USA oder Japan arbeiten zu wollen, wo noch Europäer
anstehen, ist schließlich nicht einmal mehr ein PC vonnöten − es gibt ja am
Transceiver auch eine Sendetaste…
Spaß beiseite. Der Gipfel besteht für mich darin, wenn während des Durchgangs
der gesuchten DX-Station ein ganzes Knäuel von Anrufern weiterhin ihre eigenen
Rufzeichen nennen. Entweder ist diesen Ignoranten die Technik des Splitbetriebs
nicht vertraut, oder sie hören, gerade bei Pazifik-Stationen, das leise Signal gar
nicht. Dabei haben diese Kollegen ja nicht einmal dann eine Chance, wenn die
gewünschte Station just ihr Call herauspicken würde − kein Hören, kein QSO,
da hilft auch der schnellste PC nicht.
Im Cluster stand wiederholt bei KH5/K5K-Bandmeldungen „Shame for Europe!“
Na ja, uns betrifft das eh nicht, wir machen sowieso immer alles richtig; es kann
sich bei solchem Fehlverhalten wohl nur um die temperamentvolleren Südeuro-
päer handeln, nicht selten „geschmackvoll“ mit dem Namen landestypischer
Eierteigwaren betitelt. Wie kommt es dann aber, so frage ich mich, daß ein des
Englischen sehr wohl kundiger DL-Funkamateur, der den begehrten Fisch zwar
an der Angel hält, jedoch dank eilfertiger Zwischenrufer nicht alles verstand, in
Deutsch (zwar unschön, jedoch verzeihlich) tönt „Hört doch erst mal hin, Ihr
Idioten!“? Wie erklärt sich der Zwischenruf in Deutsch „Könnt Ihr nicht hören,
der hat ’ne Liste!“ Und worauf gründet ein Afrikaner seine Aussage „Germans,
don’t tune!“? Am Abstimmton selbst wird er die Herkunft nicht erkannt haben.
Welchen Ruf haben wir „Germans“ uns da geschaffen; was muß ein der christ-
lichen Nächstenliebe nahestehender Operator wie Mönch Apollo, SY2A, von
uns denken, wenn er sich das Ellenbogen-Pile-Up auf seiner Frequenz anhört?
Zum Glück sind es immer die anderen, die mit Antennenverboten, ISM, PLC,
ADSL und aufgenötigten Selbsterklärungen unser Hobby kaputtmachen…
Weitere Gedanken in dieser Richtung äußert Rolf, DL7VEE, auf S. 1400.
Mit vy 73 und „best dx“ Ihr
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Andere Länder − andere Sitten
Die 11. IARU Region 3 Konferenz, die vom 28.8. bis 1.9. in
Darwin (Australien) tagte, befaßte sich größtenteils mit ähnli-
chen Themen, die auch in unseren Breiten die Gemüter erre-
gen. Wobei Fragen und Probleme, die in anderen Regionen den
Amateurfunk in seiner Existenz bedrohen, wie z. B. das Einhal-
ten von HSM-Grenzwerten, in dieser Region noch nicht an erster
Stelle der Tagesordnung stehen. Eine Phase des konkreten
Nachdenkens über EMVU oder PLC beginnt aber zwangsläufig
zumindest in Neuseeland und Australien.
Dafür schlägt man sich mit anderen Sorgen herum: So macht in
einzelnen Ländern der Region 3 die Anzahl der UKW-Zeugnis-
klassen fast 90 Prozent der Amateurfunkgenehmigungen aus.
Und diese werden zum großen Teil zu privaten oder geschäft-
lichen Zwecken genutzt.
Mit dem Ausbau der GSM-Funknetze für Handys gehen die
amateurfunkwidrigen Nutzungen zwar zurück, dafür aber auch
spürbar die Anzahl der Amateurfunkgenehmigungen in den
Mitgliedervereinigungen. Das bereitet vielen Sorgen. Vor allem
in Ländern mit guter Infrastruktur, wie z. B. Australien, die mit
europäischen Verhältnissen noch vergleichbar sind, zeigen neue
Funkamateure wenig Interesse, einem Verband beizutreten.
Das hat Auswirkungen: So haben die Verbände Australiens und
Neuseelands schon jetzt Probleme, die Interessen der Funk-
amateure gegenüber ihren Administrationen zu vertreten, und
die Sorgen um EMV und PLC häufen sich.
Um den Abwärtstrend in der Mitgliederentwicklung zu bremsen,
forcieren nun offensichtlich einige Länder der Region 3 die
Bestrebung, die Reduzierung der Telegrafie-Prüfungsgeschwin-
digkeit auf 25 BpM als ersten Schritt, auf CW-Kenntnisse als
Zugangsvoraussetzung für den Betrieb auf Kurzwelle, ganz zu
verzichten. In der Region 3 sind allerdings etliche Verbände
gegen eine solche Verfahrensweise.
Bleibt abzuwarten, ob es hinsichtlich dieser Thematik eventuelle
nationale Alleingänge geben wird. Und ein in der CW-Frage nicht
einheitlich argumentierender Amateurfunkdienst würde auf der
WARC im Jahre 2003 sicherlich Probleme bekommen.
In der IARU Region 3 schätzt man die Zukunft des Amateurfunk-
dienstes ähnlich wie in Europa ein: Die Attraktivität der weltum-
spannenden Kommunikationsmöglichkeiten läßt bei gleichzeitig
steigender Verbreitung des Internets nach.
Aber keine Sorge, das Internet wird auch in Zukunft nicht das
Feeling einer Verbindung mit Hawaii über den langen Weg auf
10 m ersetzen können oder das tolle Erlebnis einer 10-GHz-
Regenscatter-Verbindung über 762 km zwischen Italien und
Tschechien mit selbstgebautem Equipment!
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Free download forever?
Das Internet ist schon eine feine Sache. Ein wenig Übung vorausgesetzt, gelangt
man in kurzer Zeit an Informationen, deren Suche sonst tagelange Recherchen
erfordert hätte. So kann man sich also nicht nur eine unübersehbare Fülle an
Informationen, sonder auch an Software auf den heimischen PC laden und
damit arbeiten − vieles davon, ohne neben den glücklicherweise im stetigen
Fallen begriffenen Onlinegebühren noch etwas berappen zu müssen. Es gibt
Zeitgenossen, die Stunden und Tage ihres Lebens damit vertun, das World-
Wide-Web nach kostenlosen Programmen, Industriewaren, Dienstleistungen etc.
zu durchforsten. Hauptsache kostenlos!
Manche Funkamateure sind da bisweilen noch einen Zahn schärfer und
verstehen das Wort Ham-Spirit so, daß alles unter Amateuren Kursierende
grundsätzlich unentgeltlich sein müsse. Die Preise industriell gefertigter
Transceiver, Antennen oder Netzgeräte nimmt man ja noch mehr oder weniger
klaglos hin. Auch käme wohl niemand auf die Idee, daß es irgendwo eine vom
Feinsten ausgeklügelte Tastmechanik, in Chrom oder Messing glänzend, zum
Nulltarif gäbe, nur weil ein Funkamateur sie herstellt. Aber Software ist eben
etwas anderes als Hardware: Den PC hat der Autor doch schon vorher gehabt,
das Programm benötigte er für sich selbst ja ebenso, und die n-fache Reproduk-
tion desselben kostet ja nur ein paar Pfennige für Datenträger oder Webspace.
Selbstredend ist es begrüßenswert, wenn Funkamateure in ihrer Freizeit
Programme schreiben und diese anderen Interessenten gratis zur Verfügung
stellen. Dies ist Ham-Spirit, der zum Glück weltweit Schule macht. Dabei darf
jedoch nicht übersehen werden, daß manche Software-Highlights, deren hohe
Leistungsfähigkeit wir Nutzer einfach mal so als gegeben hinnehmen, zu ihrer
Entwicklung viele Mannjahre erfordert haben. Und selbst die laufende Pflege
und ständige Innovation solcher herausragenden ingenieurtechnischen Werke
verschlingt, nicht zuletzt wegen der bereits an die Grenzen menschlichen
intellektuellen Leistungsvermögens reichenden Komplexität, einen erheblichen
Zeitfonds.
Wohl dem, der soviel Freizeit hat, um dieses Maß an Professionalität neben der
eigentlichen Ausübung seines Hobbys und den sonstigen Verpflichtungen des
täglichen Lebens aufbringen zu können. Sicherlich hat dies sehr viel mit den
individuellen Gegebenheiten zu tun: Der eine ist vielleicht in einem Großbetrieb
für die Wartung der Computer zuständig und findet zwischendurch Zeit zum
Programmieren, ein anderer ist möglicherweise Frührentner und tut es gern,
während ein dritter selbständiger Programmierer ist und vom Erlös seines
Tagewerkes die Familie ernähren muß.
Freilich sollten Programmautoren nicht gleich dem Beispiel marktbeherr-
schender Konzerne nacheifern und technologisch notwendige Bugfixes, mit
einem klangvollen Namen versehen, für den vollen Neupreis anbieten.
Schließlich wirken zum Glück noch die Gesetze des Marktes, um solchen
Gernegroß-Programmierern das Wasser abzugraben, die für marginale
Verbesserungen gegenüber Produkten der Mitbewerber gleich den drei- bis
fünffachen Preis verlangen.
Es wäre dem Fortbestand und der technischen Weiterentwicklung des Amateur-
funks einfach abträglich, wollten wir Programme nur danach beurteilen, ob sie
kostenlos via Internet auf den PC kommen, und dafür andere Erzeugnisse, für
die ein angemessener Obolus zu entrichten ist, links liegen ließen. Spitzenpro-
dukte wie z. B. W7ELs EZNEC, wären uns nicht zugänglich, wenn ihr Autor −
selbständiger Programmierer– dafür keinen Verkaufserlös erzielen dürfte. Und,
Softwarecracks, tragt doch lieber im Internet-Kontakt mit den Programmautoren
zur Weiterentwicklung von Ham-Software bei, anstatt Eure Intelligenz zum
Knacken von Freischaltschlüsseln, Kopierschutzmechanismen u. ä. einzusetzen!
Einen schnellen Download wünscht mit besten 73
Ihr
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Ein Ministerium fürs Web?
Es muß wohl an einem dieser schwül-heißen Maitage gewesen sein,
als man ärmelbeschonert am grünen Tisch eine neue Internet-Steuer
ausgebrütet hatte. Es wurde ja seinerzeit viel darüber berichtet und
diskutiert. Die private Nutzung von Internetzugängen während der
Arbeitszeit sollte als geldwerter Vorteil von Arbeitnehmern besteuert
werden. Wie das allerdings praktisch realisiert werden sollte und vor
allem, welchen Sinn (außer, dem Staat Geld ins Steuersäckel zu spülen)
eine solche Web-Steuer haben könnte, blieb allerdings ziemlich
verschwommen.
Nehmen wir es doch einmal ganz konkret: Wenn Sie sich z. B. für eine
dienstliche Berichterstattung im Internet ein Funkgerät auf der Website
eines der bekannten Hersteller ansehen, dann wäre dies arbeitsbedingt
und demzufolge nicht als geldwerter Vorteil zu sehen, also würden auch
keine Steuerabgaben anfallen. Was aber, wenn Ihnen nun aufgrund
der technischen Daten, des Designs etc. gerade beim Ansehen dieser
Homepage das Gerät persönlich so sehr zusagt, daß Sie es auch privat
kaufen möchten − zählt Ihr Aufenthalt im WWW dann vielleicht doch
plötzlich zur Privatnutzung, für die zumindest anteilmäßig an den Fiskus
zu berappen wäre? Dokumentieren müßten Sie ja ohnehin jede Aktion
im Netz, um die „Arbeitsrelevanz“ stichhaltig zu belegen. Dafür würde
dann schon mal ein guter Teil der Arbeitszeit draufgehen. Und vielleicht
wird es sogar bald in Deutschlands Browsern gesetzlich verordnete
Plug-Ins geben, die vor jedem Mausklick eine Messagebox aufblenden:
„Vergewissern Sie sich vor dem nächsten Klick, ob Ihre Aktion dienstlich
relevant ist. Der Bundesfinanzminister warnt: Klicken gefährdet Ihre
Steuerersparnis.“
Gott sei Dank ist diese geniale Steueridee vorerst wieder gekippt worden,
doch verlassen sollte man sich nicht darauf, daß nicht schon wieder eine
nächste IT-Reglementierungs-Idee erdacht wird. Neuester Diskussions-
punkt, wie aus Politikerkreisen zu hören, ist das Gedankenspiel um die
Einführung eines Internet-Ministeriums, welches sich dieses Mediums
als regelnde und ordnende Stelle zentral annehmen sollte.
Sicher − im Zeitalter des boomenden e-Commerce müssen bestimmte
verbindliche Regelungen und einheitliche Standards, z. B. für spezielle
Netztransaktionen und für den Schutz sicherheitsrelevanter oder persön-
licher Daten schon sein, man sollte jedoch zukunftsträchtige Systeme auch
nicht überadministrieren. Statt dessen wäre eine kräftige Intensivierung der
Ausbildungsförderung anzumahnen: „Schulen ans Netz“, Internetzugang
als Selbstverständlichkeit für jeden, moderne Ausbildung für die dringend
benötigten Nachwuchskräfte in der IT-Branche. Deutschland will ja
schließlich beim Thema High-Tech in der ersten Liga mitspielen.
Da stören bürokratische Restriktionen nur, die ein stabiles Regelsystem
erzeugen, das beim Hochfahren von Forderungen den „Output“ doch
nur stets wieder auf „gesundes“ Mittelmaß heruntersteuert. Was wir
dringend brauchen, ist hingegen experimentierfreudiger und technik-
begeisterter Nachwuchs, wollen wir uns informationstechnisch nicht
auf Dauer von „brain“-Importen abhängig machen. Fünfhundert „Green
Cards“ sind bereits vergeben und täglich werden etwa hundert weitere
ausgestellt.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Geht es uns zu gut?
Über den Wegfall der Pflicht zur Logbuchführung oder der Verwendung
von /p & Co. nach Verkündung der neuen Amateurfunkbestimmungen
freut sich wohl jeder. Über die Aufhebung der Beschränkung des Nach-
richteninhalts und die Herabstufung der unzulässigen Verwendung von
Sendeanlagen einschließlich Rufzeichenmißbrauch zu Ordnungswidrig-
keiten herrscht schon weit weniger Einhelligkeit.
Denn mit rücksichtslos ausgelebter Freiheit und noch weit darüber hinaus
haben sich u.a. im Packet-Radio-Netz, auf einigen KW-Frequenzen und
ganz besonders beim Betrieb über diverse Relaisfunkstellen Zustände
entwickelt, die zum Himmel schreien. Diffamierungen, insbesondere von
Funkamateuren der Klasse 3 und Ausländern, Pöbeleien jeder denkbaren
Art, Funken unter hochgradigem Alkoholeinfluß, oder „nur“ die Beeinträch-
tigung des Funkbetriebs durch „Trägerdrücken“ sind Beispiele. Einige
Betreiber von Relaisfunkstellen im Ruhrgebiet wußten sich nicht mehr
anders zu helfen, als ihre mit viel Fleiß und finanziellem Aufwand reali-
sierte Anlage abzuschalten, andere sind der Verzweiflung nahe.
Das Ganze wird zusätzlich durch deutliche Zurückhaltung der RegTP bei
der Verfolgung eben dieser und anderer „Unregelmäßigkeiten“ erschwert.
Teils verständlich, denn das rechtsstaatliche Procedere macht die Einfluß-
nahme, selbst wenn der Fall klar zu liegen scheint, schwierig.
Auf der anderen Seite verlangt die Kommunikationswelt mehr Frequen-
zen. Und wir Funkamateure nutzen einen erklecklichen Teil, von geringen
Verwaltungsgebühren abgesehen, kostenlos. Um das der Gesellschaft
plausibel zu machen, bedarf es guter Gründe. Experimentelle und wissen-
schaftliche Studien, Weiterbildung, Völkerverständigung und die Unter-
stützung in Not- und Katastrophenfällen sind Fakten, aus denen der
Amateurfunkdienst gleichgestellt mit anderen Funkdiensten seine Da-
seinsberechtigung ableitet. Also eine anspruchsvolle Beschäftigung.
Und weil schon die Altvorderen erkannten, daß eine Gemeinschaft Regeln
braucht: Damit jeder Funkamateur Freude am Hobby hat, erfanden sie den
Ham Spirit. Wirklich antiquiert?
Es genügt, wenn sich Amateurfunk in der Breite nur noch wie Stammtisch
oder beliebige Telefongespräche ausnimmt, geschweige denn so, wie es
heute über diverse unbemannte Funkstellen tönt: Kein Verantwortlicher wird
solch einer Truppe weiter die alten Vergünstigungen einräumen wollen.
Das erkennend, haben eine Reihe von Sysops versucht, zumindest den
Inhalt ihrer Mailboxen zu steuern. Mit dem Erfolg, daß hier die RegTP nach
Intervention anderer Funkamateure gegen die Sysops tätig wurde. Ein echtes
Dilemma, denn die Freiheit des neuen Amateurfunkgesetzes verbietet eigent-
lich nur Kommerz (wiederum auslegungsfähig) und Drittenverkehr. Bei
Beleidigungen und dgl. wird auf das BGB verwiesen.
Was also tun? Eine Vorstellung geht dahin, den zulässigen Nachrichteninhalt
anläßlich der abzusehenden Novellierung der Amateurfunkgesetzgebung
wieder einzuengen und bei Verfehlungen bestimmte Sanktionen vorzusehen.
Wenn die Selbstregulierung nicht funktioniert, vielleicht die einzige Möglich-
keit, das Niveau das Amateurfunks als Funkdienst zu bewahren und den
vielen Problemen, mit denen er zu kämpfen hat, nicht noch das der Selbst-
aushöhlung hinzuzufügen. Schade, uns geht es wohl zu gut.
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Wissenschaft & Spaßgesellschaft
Der Startschuß ist gefallen. Am 1. Juni hat die Expo 2000 unter dem
Leitmotiv „Mensch, Natur, Technik“ in Hannover ihre Pforten geöffnet.
Nach zehnjähriger Vorbereitung präsentiert sich nun für ganze 153 Tage
eine bunte, quirlige Show über die Wissenschaft im allgemeinen und
zu Zukunftsvisionen im besonderen. Dafür wurden insgesamt ca. drei-
einhalb Milliarden Mark in neue Bauten auf dem um ein Drittel erweiter-
ten Hannoveraner Messegelände investiert, eine Investition, die man
teilweise über die 40 Millionen an erwarteten Besuchern wieder herein-
zuholen gedenkt.
Und Visionen muß man schon haben, will man Inhalte mit Intuition ver-
mitteln, z. B. im Themenpark, wo utopisch anmutende Szenerien alle
menschlichen Sinne stimulieren − ganz nach dem Motto: „Die Zukunft
beginnt. Jetzt!“ Was deutlich auffällt: Technik und Wissenschaft sollen
mit Spaß erlebt werden. Spaß − das ist überhaupt in unserer heutigen
Gesellschaft ein ganz elementares Prinzip geworden, gerade auch,
um junge Menschen für Wissenschaft und Forschung zu interessieren.
Informatikermangel und anhaltende „Inder-Diskussion“ setzen hier ernst
zu nehmende Zeichen. Nur wenn die Wissenschaft aus ihrem Elfenbein-
turm herausgeht, an eine breite Öffentlichkeit, wird sie heute die Tech-
nikbegeisterten von morgen gewinnen.
Statt der reinen Lehre also Wissenschaftsshow à la Gottschalk? Wetten,
daß? Man kann diese Entwicklung bedauern oder auch nicht, aber unsere
erlebnishungrige Welt hat nun mal Trends gesetzt, Fakten, um die man
nicht herumdiskutieren kann. Ging man früher noch einfach nur einkaufen,
ist heute mindestens „Erlebnis-Shopping“ angesagt. Will man die Kids
vor den Computer locken, hat man mit simplen Ping-Pong-Spielen null
Chance. Computergames müssen immer komplexer, realitätsnäher,
schneller und bunter werden, das Letzte muß aus der Hardware heraus-
gekitzelt werden, erst dann ist man „drin“. Das geht schon soweit, daß
bereits auf manchen Verpackungen Warnhinweise für Epileptiker bezüglich
der „special effects“ aufgedruckt werden.
Die Spaßgesellschaft schlägt hier wie in jeder anderen Technikbranche
Purzelbäume. So ist und bleibt beispielsweise elektrischer Strom eigent-
lich nur gerichtete Elektronenbewegung, aber er ist jetzt außerdem zu-
mindest „Bio“, „Öko“ oder „Yello“. Längst suchen große Energiekonzerne
nicht mehr den klassischen Techniker, der für den reibungslosen Fluß der
Energie durch die Leitungen sorgt, sondern den Customer Relationship
Manager, der für den Transport eines Images in die Köpfe der Kunden
verantwortlich ist. Nicht die eigentliche Technik steht im Mittelpunkt, es
geht um den zielgruppenorientierten Spaß an ihr. Und damit um Umsatz.
Der Beispiele gibt es noch viele. Und dieser Gesellschaftstrend macht auch
vor unserem Amateurfunk-, Elektronik- und Computerhobby nicht halt.
Dann (und nur dann), wenn es uns allen gelingt, den Spaß an der Technik
der Jugend weiterzuvermitteln, begeistert sich der Nachwuchs (auch der
nicht-indische), den wir so dringend für die qualifizierten Arbeitsplätze
von morgen brauchen, für sie.
Die Expo in Hannover könnte hierfür einen Anstoß geben!
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Internet vs Amateurfunk?
Immer wieder hört man, oft auch von gestandenen OMs, das Internet
und andere neuzeitliche Kommunikationsmöglichkeiten seien der Tod
des Amateurfunks. Sicher gibt es den einen oder anderen darunter, der
das Internet interessanter findet und sich deshalb vom Amateurfunk-
geschehen mehr oder weniger abwendet. Wozu brauche ich noch Ama-
teurfunk, wenn ich übers Internet mit (fast) jedem kommunizieren kann?
Aber waren das jemals Funkamateure mit Herz und Leidenschaft? Es geht
doch nicht allein darum, mit anderen in Verbindung zu treten, sondern es
interessiert ganz wesentlich, mit welchen Mitteln das geschieht. Mir macht
eben gerade die Übertragung durch das Medium Funk, mit allen seinen
Unwägbarkeiten bis an die Grenzen des Machbaren, Spaß! Nicht zu ver-
gessen das Sammeln und Jagen in verschiedensten Varianten. Außerdem
sind Funkamateure mit ihrer Übertragungstechnik (eingeschränkt allenfalls
bei Relais und Digipeatern) autonom: Sie benötigen keinen Netzbetreiber
oder Provider, der ihnen jederzeit den Hahn abdrehen oder einem Crash
zum Opfer fallen lassen kann. Und wer hat sonst noch die Möglichkeit,
etwa ein TV-Signal zu übermitteln?
Amateurfunk lebt, und das auch noch längere Zeit, gleich, welche Kommu-
nikationsmöglichkeiten in absehbarer Zukunft außerdem zur Verfügung
stehen werden. Das Telefon gab es bereits vor dem Entstehen des Ama-
teurfunks, und auch Handys führten nicht zu dem befürchteten Sterben.
Es bezweifelt wohl niemand, daß die Funkamateure eine Minorität darstel-
len und bleiben. Sollten es weniger werden, dürfte das der Sache keinen
Abbruch tun, denn eine wirklich schlagkräftige Lobby, wie sie z. B. Fußbal-
ler oder Autofahrer nutzen, hatten wir mangels Masse sowieso nie. Daher
sollten wir uns anderen, wirklich den Amateurfunk bedrohenden Gefahren
zuwenden und insbesondere Entwicklungen der kommerziellen Datenüber-
tragung (PLC usw.) verschärft im Auge behalten sowie mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln deren Ausbreitung zu verhindern suchen.
Feldversuche, wie derzeit im Ruhrgebiet mit 200 und mehr Teilnehmern,
sind nur der Anfang.
Amateurfunk lebt! Schauen Sie sich auf den Bändern um: DXpeditionen in
rare Gebiete der Erde tätigen in wenigen Tagen oft mehr als 70 000 Ver-
bindungen, weitere Staaten, wie das Königreich Bhutan, öffnen sich dem
Amateurfunk (Internet gab es dort schon lange vorher), IOTA-Spezialisten
aktivieren seltene Inseln, auf dem QRP-Sektor wird kräftig gebaut und
getestet; es wurden nicht zuletzt neue, innovative Betriebsarten wie
PSK31 entwickelt und in die Praxis überführt.
Es ließen sich noch viele Beispiele der regen Aktivität von Funkamateuren
finden, die ihrem Hobby aus Leidenschaft und Überzeugung frönen und
das Internet nutzen, statt es zu dämonisieren − als eine zusätzliche
Möglichkeit, schnell umfangreiche Informationen auszutauschen. Fast jede
größere DXpedition bietet, während sie noch unterwegs ist, die Möglichkeit,
per Internet die Logs einzusehen. Prima Sache, schadet dem Amateurfunk
keinesfalls. Und schauen Sie mal in die laufende FA-Ausgabe: An vielen
Stellen wird für weitergehende Informationen auf E-Mail und WWW ver-
wiesen. Das tut der Zeitschrift keinen Abbruch.
Ich jedenfalls nutze die umfangreichen Möglichkeiten des Internets und
möchte es als praktische Ergänzung meines Hobbys nicht mehr missen.
Meine Amateurfunkaktivitäten litten darunter bisher jedenfalls keines-
wegs, sie verstärkten sich geradezu!
Awdh im Contest, im Pile-Up oder einem gepflegten CW-QSO. Falls nicht,
schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail.
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Armutszeugnis
Ein High-Tech-Standort wie Deutschland braucht mehr ausgebildete Computer-
Spezialisten. Wo bekommen wir sie her? Natürlich von dort, wo Mitteleuropa
seit Jahrhunderten die meisten materiellen Ressourcen nutzt − aus den Ent-
wicklungsländern. Nach den Rohstoffen nun auch die Intelligenz. Den Aufwand,
Spezialisten auszubilden, haben uns die fernen Länder ja abgenommen, und
selbst brauchen sie vermutlich sowieso keine Elitekräfte, schließlich soll ja unser
technologischer Vorsprung erhalten bleiben, damit wir auch weiter eine Kaffee-
maschine für den Gegenwert einer Schüssel Reis bekommen. In den USA
betreibt man diesen „brain drain“ schon lange erfolgreich, auch zu Lasten
Deutschlands.
Früher hat man Leute für Arbeiten ins Land geholt, die unsereins ungern aus-
geführt hätte. Heute holen wir sie für Tätigkeiten, die wir, zumindest im not-
wendigen Umfang, nicht mehr bewältigen können? Aber es geht ja wohl vor
allem auch um absolute Spitzenkräfte.
Nun haben wir doch aber traditionell gute Universitäten und Hochschulen. Bei
näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, daß die Zahl der Studenten in inge-
nieurtechnischen Fachrichtungen drastisch zurückgegangen ist. Nicht ver-
wunderlich: Wenn Vater Ingenieur flautebedingt mit 50 auf dem Abstellgleis
landet, werden Töchterlein und Sohnemann solcherart Profession tunlichst
meiden. Und überhaupt, was sind schon Ingenieure. Hand aufs Herz: Wann
haben Sie die letzte Ingenieur-Serie im Fernsehen gesehen? Manne Krug als
Ingenieur − welcher Regisseur würde sowas drehen?! Ein Ingenieurroman am
Zeitschriftenkiosk − Lacher oder einfach nur ein Ladenhüter?
Im Land der „Big Brother“-Gucker blickt man allenfalls zu smarten Ärzten,
Rechtsanwälten und Architekten auf. Der VDI (weiß jemand, wie diese Ver-
einigung in Langform heißt?) fordert: Think Ing. Soll wohl heißen: Seid aufge-
schlossen für die Technik und die Ingenieurwissenschaften. Fördert die Liebe zur
Technik. Wenn der Letzte merken würde, daß davon schließlich sein Wohlstand
abhängt − und sein naturwissenschaftliches Verständnis ihn nicht mehr jeder
profitorientierten Sensationsmache auf den Leim gehen läßt, sind wir schon
weiter. Und das einst nicht ohne Grund hochgeschätzte Ingenieurwesen erhielte
wieder höheren Stellenwert.
Die gegenwärtige Diskussion deckt Mängel in der Bildungspolitik auf. Die in
andere Richtung gescholtene Gleichmacherei wurde hier zementierte Realität.
Keine engagierte, unkonventionelle und unbürokratische Begabtenförderung.
Die Sicherung des Lebensunterhalts bestimmt zu oft den studentischen Alltag.
Effizienz wird durch ungebremste Studentenzahlen (wo gibt es schon Aufnahme-
prüfungen?) und schlecht organisierte, dem Selbstlauf überlassene Studiengänge
und manchmal angestaubte Inhalte verschenkt. Ganz zu schweigen von
der Absurdität, daß jemand, der Physik studieren möchte, dieses Fach im Abitur
abwählen darf.
Wer technologische Spitze bleiben oder wieder werden will, muß ein anderes
Klima schaffen. Wenn im Fernsehen zur besten Sendezeit ganz ernsthaft über
die fachgerechte Erstellung von Horoskopen diskutiert wird und man dank Masse
allmählich glaubt, Akte X wäre Realität, braucht man sich über Elektrosmog-
Hysterie nicht zu wundern, womit nicht der gewissenlosen Vermarktung gefähr-
licher Technik das Wort geredet sei.
Vielleicht versucht man es einmal mit Mathematik statt Rechnen (gab’s schon
mal irgendwo) und etwas mehr Betonung der naturwissenschaftlichen Fächer.
Womöglich war es gar ein Fehler, sogenannte Spezialschulen dem „bewährten“
Standard anzupassen? Deren Absolventen gehören jedenfalls heute zu den so
gefragten Spitzenkräften.
Zurück zum Beginn. Mit der Greencard stellen wir uns ganz klar ein Armuts-
zeugnis aus. Aber sie bringt uns neben den Fachleuten ja hoffentlich auch mehr
Toleranz und Besinnung auf die eigene Kraft.
55 wünscht uns in dieser Hinsicht
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Packet-Radio-Freiheit für alles und jeden?
Freie Fahrt für freie Bürger − so lautet ein inzwischen etwas in Vergessenheit
geratener Slogan, der unter dem Deckmantel angemahnter Demokratie doch
eher ein wenig Anarchie forderte.
So ähnlich kommt mir die gegenwärtig ins Kraut schießende Diskussion um
die Informationsfreiheit im Medium Packet-Radio vor. Auf der einen Seite Funk-
amateure, die die Grenzen des vom neuen Amateurfunkgesetz samt Nachfolge-
bestimmungen zugelassenen Nachrichteninhalts ausloten wollen, auf der ande-
ren solche, die gern die herkömmlichen Inhalte dominieren sehen möchten.
Bei gewöhnlichen Funkverbindungen tragen allein die Partner die Verantwortung
dafür, was sie sagen oder schreiben, und riskieren dabei gegebenenfalls eine
Intervention der Behörde und/oder die Beschädigung ihres Images.
Anders beim Betrieb über Relaisfunkstellen oder Digipeater. Hier tritt der Sysop
als Vermittler in Erscheinung. Er ist damit in der Lage, einzelne Funkamateure
von der Nutzung seiner Anlage auszuschließen. Da diese wiederum eine Frequenz
in den Amateurbändern belegt, muß er sie allgemein verfügbar halten. Die
Weiterleitung von Nachrichten über Linkstrecken erfordert dabei sicher keine
weitergehende Differenzierung.
Einen besonderen Zankapfel bilden allerdings als Anhängsel die Mailboxen, bei
denen man sich darüber streitet, ob sie als fester Bestandteil eines Digipeaters
bzw. mehr oder weniger als private separate Einrichtungen gelten, in denen der
Sysop schalten und walten kann, wie er will. Wenn ich es auch in etlichen Fällen
ganz gern sähe − der Versuch objektiver Betrachtung legt eher die Schlußfolgerung
nahe, daß er bei unbequemen Themen oder Meinungen nicht
eingreifen sollte.
Damit ist nun nicht etwa gänzlicher „Freiheit“ oder genauer Chaos das Wort
geredet, bei dem jeder alles darf. Mißbrauch, Diffamierungen, Unterstellungen,
Beschimpfungen, ganz zu schweigen von Inhalten, die kriminelle Tatbestände
darstellen, sollten schon „durchs Netz fallen“ oder auch zur Sperrung des
Nutzers führen, sofern der Sysop es feststellt. Vielleicht könnten hier bei allen
Schwächen, die solche Systeme haben, Filter mit bestimmten Suchwörtern
helfen.
Wie also mit dem Schlamm im Packet-Netz umgehen? Wenn es auch schwerfällt,
bei unsachlichen und unflätigen Äußerungen auf einen groben Klotz keinen
groben Keil zu setzen − man muß es versuchen: Provokationen unbeantwortet
lassen, so daß die Schreiber die Lust verlieren. Destruktive Argumentation durch
höfliche und sachliche Entgegnungen widerlegen, woran sich auch die berühmte
schweigende Mehrheit beteiligen sollte. Konstruktiv statt destruktiv diskutieren.
Und überlegen, bevor man schreibt. Das wäre eine überzeugende Form der
Selbstregulierung.
Und noch etwas zur neuen Freiheit des Nachrichteninhalts. Die Berechtigung
zur (von Verwaltungskosten abgesehen) kostenlosen Nutzung der Frequenz-
ressourcen schöpft der Amateurfunk aus seinem gesellschaftlichen Nutzen,
u. a. als technisch experimenteller Funkdienst und durch seine Bildungsfunktion.
Schön, daß ich bei meinen QSOs nicht mehr ständig darauf achten muß, zu
sehr von amateurfunkspezifischen Themen abzuschweifen − aber nur noch
Diskussionen über Moorhuhn-Rekorde?
Wenn sich die Gespräche auf den Amateurbändern nur noch wie die übers
Handy oder gar der schlechtere Teil von CB anhören, d. h. der Amateurfunk nur
noch als billiger Ersatz für kostenpflichtige Telekommunikationsdienstleistungen
dient: Dann sind seine Tage zu Recht gezählt! Das sollte man bei der Kontroverse
nicht vergessen.
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Auf leisen Sohlen
Nichts ist geschehen. Kein Weltuntergang, kein Atom-Crash, kein Flugzeug-
absturz. Ist wirklich nichts geschehen? Nachdem zuerst die große Panikmache
und Schwarzmalerei uns in immer neuen Wellen überflutet hat, setzt nun Stille
um das Thema Y2K-Bug ein.
Welches Unternehmen würde auch freiwillig zugeben, in ein ernsthaftes Dilemma
gekommen zu sein? Ist doch Zuverlässigkeit das A und O im Wirtschaftsleben.
Und doch: Die vielen Patch-Sammlungen auf den Internet-Homepages gerade
diverser Software-Anbieter und Service-Provider sprechen eine deutlich andere
Sprache. Wer den großen Neujahrs-Crash erwartet hatte, wurde zwar enttäuscht,
das eigentliche Problem ist aber trotzdem noch nicht gegessen − es schleicht sich
Stück für Stück und ganz allmählich ein.
Manchmal merkt man das noch nicht einmal auf Anhieb. So liegt es nicht etwa
an fehlerhaften Textdateien, wenn man fürs Briefe verfassen im Jahr 2000 das
bisher immer zuverlässig arbeitende alte „Word 5.0 für DOS“ weiterbenutzt.
Nach dem Abspeichern bekommt man seine Belohnung mit wild im Text ver-
teilten Steuerzeichen. Hier wird offenbar bei der Speicherfunktion mit dem
Systemdatum hantiert − und schon läßt das Problem mit der Doppelnull grüßen.
Weitere Beispiele gefällig? „Ws-FTP“ liefert bei der Anzeige des Dateidatums
nicht die „00“ als Jahresangabe, sondern zählt (wie schlau) von „99“ auf „100“
hoch. Da hilft nur die Option der vierstelligen Jahresanzeige weiter. Auch
Netscape 4.7 liefert beim Aufruf des Date-Objektes in Javascript nicht 00 oder
2000, sondern 100 als Jahr.
Kontoauszüge mit dem Lila-T-Homebanking gingen nach dem Jahreswechsel
auch erst einmal den Bach hinunter, alles, was nach Silvester an Konten-
bewegungen hätte angezeigt werden müssen, war einfach nicht vorhanden.
Glücklicherweise lagen die Fehlerpatches wenigstens auf dem Telekomserver
bereit.
Microsofts Money 2000 (den Namen hör’ ich wohl, allein, mir fehlt der Glaube!)
ruft offenbar ebenfalls nur zweistellige Jahreszahlen ab. Nach 99 kommt dann
halt 100. Der Erfolg beim Datenaufbereiten: Abstürze der spektakulären Art…
Alle durch 4 teilbaren Jahreszahlen sind Schaltjahre. Ausnahme: Durch 100
teilbare Jahreszahlen sind keine Schaltjahre. Ausnahme von der Ausnahme:
Durch 400 teilbare Jahreszahlen sind Schaltjahre. Mit der „Vierer-Regel“ gibt’s
erst mal keine Probleme bis einschließlich 2096. Aber mit der Ausnahme! Hat
eine Software zwar die „Hunderter-Regel“ berücksichtigt, nicht jedoch die
Sache mit der 400, wird man das ab 29.02.2000 bemerken, wenn dieser Tag
plötzlich übersprungen wird.
Auch manches Award-/Phoenix-BIOS kann derzeit nur notdürftig „gepatcht“
werden. Wurde man zu Beginn des neuen Jahres zurück nach 1994 katapultiert,
zeigt das Systemdatum nach einmaliger manueller Umstellung auf „2000“ von
nun ab bei jedem Systemstart auf das Jahr 2094 – beispielsweise mit dem Erfolg,
daß beim Surfen im Internet sogenannte „sichere Seiten“ vom Browser als „un-
sicher wegen längst abgelaufenem Zertifikat“ klassifiziert werden. Na, prosit!
Die Softwareindustrie jedenfalls hat sich mit der Situation bestens arrangiert.
Alte Programmversionen werden einfach nicht mehr supportet. Damit hat man
den Anwender schon am (meist kostenpflichtigen) Update-Haken. Wie kann
man denn auch heutzutage noch Texte in ein altes DOS-Programm hacken,
wo es doch so schöne Windows-Wortverwutzelungs-Saftware gibt − für einen
bescheidenen Obolus, versteht sich. Haste mal ’ne Mark?
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Das fängt ja gut an
Der Jahreswechsel brachte für aufgeweckte Funkamateure eine wichtige Neuig-
keit dergestalt, daß die RegTP 2000 weitere Sonderlizenzen für das „Magic-
Band“ vergibt. Kam die Meldung für praktisch alle einschlägigen Zeitschriften
erst nach dem weihnachtlichen Redaktionsschluß, so waren es dieses Mal die
Packet-Radio-Nutzer, die von der am 17.12.1999 durch den DARC-Vorstand
verbreiteten Information am ehesten Kenntnis erlangten. Interessant, daß der
Radioklub dieses Medium dem Internet vorzieht – vielleicht auch einmal eine
kleine Referenz an die vielen fleißigen Sysops und ihre Helfer, die das engma-
schige digitale Netz am Laufen halten.
Nichtsdestoweniger scheint ja der Informationsfluß ganz gut geklappt zu haben,
denn laut RegTP gingen immerhin um die 3000 Anträge im eigentlich recht kurz
und terminlich ungünstig bemessenen Zeitraum vom 3. bis 10. Januar ein, so
daß wie angekündigt nun das Los zu entscheiden hat. Ein wenig traurig ist es
schon, daß die staatliche Regulierungsbehörde an der (zufällig?) mit der Jahres-
zahl korrellierenden Anzahl festhält, lag doch die Forderung des Funkamateur-
verbandes eben genau bei 3000. Das läßt jedoch auch erkennen, wie vorsichtig
die RegTP angesichts der mächtigen Lobby der öffentlich rechtlichen Rundfunk-
anstalten zu agieren gezwungen ist.
Bekanntlich geht es weniger um die drei noch auf Kanal 2 arbeitenden Fernseh-
sender auf dem Biedenkopf, der Göttelborner Höhe und in Grünten/Allgäu, für
die man ohnehin Schutzzonen definiert hat, sondern vielmehr um das keines-
wegs nur auf dicht besiedelte Städte beschränkte Kabelnetz. Deren Betreiber,
allen voran die Deutsche Telekom AG, pflegen auf dem das 50-MHz-Band um-
rahmenden Kanal, lokal verschieden, vorzugsweise eines der dritten Programme
einzuspeisen. Selbst wenn die gültigen Vorschriften hinsichtlich des Schirmungs-
maßes der installierten Koaxialkabel und Verteilnetzkomponenten seitens Netz-
betreiber und Installationsbetrieb korrekt eingehalten wurden, ist es ein ein-
faches Rechenexempel, zu ermitteln, ab welcher Sendeleistung es zwangsläufig
zu einer störenden Beeinflussung des Fernsehsignals durch unsere nicht allzu
weit entfernt stehende 6-m-Antenne kommt.
Mehr noch sind es die nicht selten anzutreffenden Basteleien nach der letzten
Antennendose, wo Otto Normal-Fernsehzuschauer nebst Filius schnell geneigt
sind, zu Flachbandkabel, Klingeldraht und Lüsterklemme zu greifen, wenn es um
die hausinterne Weiterverbreitung dieses „Lebenselixiers“ geht. Mithin sind
Störungen wohl vorprogrammiert, und wir sind gut beraten, nicht durch allzu
großzügige Interpretation der zulässigen Leistungsobergrenze Öl ins Feuer zu
gießen, obliegt es doch der Behörde, bei gehäuftem Vorkommen von Störungs-
meldungen erteilte Genehmigungen individuell bzw. schlimmstenfalls auch ge-
nerell ganz schnell wieder zurückzunehmen.
Viele erfahrene DXer haben es gezeigt, daß mit einer den Besonderheiten dieses
zauberhaften Bandes angepaßten Betriebstechnik, sinnvollen Antennenkonstruk-
tionen und geschickter Ausnutzung der der Wellenausbreitung zu Grunde lie-
genden physikalischen Gegebenheiten auch ohne ein „auf die Dauer hilft nur
Power“ ein respektabler Länderstand zu erreichen ist. Gerade Klasse-2-Inhaber,
denen es bisher mitnichten vergönnt war, via Tropo den Sprung über einen der
großen Teiche zu schaffen, werden rasch erkennen, daß auch hier die Götter vor
den Erfolg den Schweiß gesetzt haben. Zeigen wir in diesem Heft erst einmal
auf, wie Interessenten mit noch intaktem Lötkolben schnell und preiswert ihrem
(Allmode-)UKW-Transceiver den neuen Frequenzbereich erschließen können, so
bringen die nächsten Ausgaben eine Reihe weiterer praktischer Tips aus der
Feder eines bekannten 6-m-Barden.
Ham-Spirit ist eine Zier; konkret verlangt dies den nicht von der Kurzwelle kommenden
Eleven ab, sich zunächst hörenderweise auf die neuartigen Anforderungen
einzustellen. Bleibt zu hoffen, daß die alten Hasen bei unvermeidlichen Fehlern
von Anpöbelungen ablassen und statt dessen durch hilfreiche Tips glänzen!
55 es best DX − Ihr
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Müllennium
Nun trennen uns nur noch wenige Tage von der Jahreszahl mit den magischen
drei Nullen.
In meiner Kinderzeit habe ich ab und an sinniert, wie es wohl sein würde, wenn
das neue Jahrhundert/Jahrtausend beginnt und mir weder einen Kopf darüber
gemacht, daß es ja erst nach Ablauf das Jahres 2000 startet (Monate und Tage
zählen ja auch nicht von Null an, die dritte Dekade beginnt nicht schon am 20. des
Monats, im Jahre 1 kannte man die 0 noch gar nicht, denn es gab nur römische
Zahlen usw.) noch darüber, daß die freudige Erwartungshaltung schließlich als
Folge des gewaltigen Rummels ob dieses Ereignisses schließlich einem „wenn es
doch endlich vorbei wäre…“ weichen würde.
Der Kommerz braucht „Events“, und da kommt einem der falsche Jahrtausend-
wechsel sehr zupasse, um Silvesterreisen und -veranstaltungen zu Straßenraub-
Preisen oder nur Millenniumsnudeln mit stranggepreßter 2000 anzubieten.
Eigentlich müßten die Unternehmen folgerichtig im Dezember 2000 gemerkt
haben, daß ja nun der richtige Termin naht und noch einmal auf die Pauke hauen.
Letztlich konnte vor Jahrzehnten wirklich niemand ahnen, daß der Beginn des
Jahres 2000 erhebliche Probleme und Gefahren infolge programmiertechnischer
Sparmaßnahmen in der Software damals kaum zu prophezeiender mikroelek-
tronischer Schaltungen markieren würde, demnach der Stoßseufzer „wenn es
doch endlich vorbei wäre…“ hier seine echte Bedeutung erhält. Sei es nur,
daß die Bank-Software im Dezember wahrhaftig die Überweisung für die neue
Antenne per Online-Banking für einen Januar-Zahlungstermin schlicht mit einer
Fehlermeldung quittiert.
Ich glaube trotzdem nicht, daß am 1. Januar um 0 Uhr das Licht ausgeht, dazu
ist die Sachlage eindringlich genug illustriert worden, und die meiste Technik läßt
sich ja (noch) per Hand steuern bzw. der Überweisungsauftrag in den Kasten
werfen − doch weiß ich, wo die Taschenlampe liegt; über etliche Lebensmittel-
reserven verfüge ich ebenfalls. Aber was geschieht mit der Heizung?
Im Amateurfunk werden kleinere Brötchen gebacken, seine Äonen messen eher
nach Jahrzehnten. Trotzdem, mit den zweistelligen Datumsangaben wird auch
der Funkamateur konfrontiert. Funktioniert der mikroprozessorgesteuerte Trans-
ceiver wirklich noch (ich denke ja), und was macht mein Logbuchprogramm
(das wird ohne Update eher gewisse Probleme haben).
Bleiben die nicht so genau auf Silvester gemünzten Probleme. Das am meisten
auf den Nägeln Brennende, die „Selbsterklärung“, ist für die Längergedienten
anscheinend bis zum wirklichen Jahrtausendwechsel virtuell vom Tisch, denn
einhalten müssen wir die Grenzwerte (einschließlich der überregulierten Herz-
schrittmacher-Bestimmungen) längst. Elf Monate vergehen schnell, aber zu-
mindest liegen dann hoffentlich die Grenzwerte in einem Bereich, der noch
Funken in der Stadt oberhalb QRP erlaubt, darüber hinaus für das Nahfeld ist
ein Modus zur einfachen Berechnung gefunden und akzeptiert.
Ist hier etwas Ruhe, fällt uns wieder ein, daß nach wie vor ADSL, PLX und die
Folgen evtl. heraufgesetzter Störstrahlungsgrenzwerte drohen, unsere Bänder
zuzumüllen, daß nachlassende Attraktivität, auch manche überalterten Strukturen
hemmen, daß es gilt, amateurfunkspezifische Inhalte hervorzuheben, zu schaffen
und zu fördern, um damit dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken. Vielleicht
nutzt der eine oder andere im neuen Jahr seine Energie, sich hier zu engagieren,
statt dem Amateurfunk durch Schlammschlachten und Rücksichtslosigkeit zu
schaden.
Übrigens finde ich es gar nicht zu belächeln, wenn sich in der Silvesternacht
Funkamateure dem THW zur Verfügung stellen oder Relaisfunkstellen mit einer
Notstromversorgung nachrüsten, um für den Fall der Fälle zusätzliche Kommu-
nikationswege verfügbar zu machen.
Beste 73 und guten Rutsch!
Bernd Petermann, DJ1TO
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
DX-Cluster − Ende des Ham Spirits?
DX-Cluster sind unbestritten eine sehr praktische und beliebte Einrichtung:
Man connected per Packet-Radio einen im Netz möglichst in der Nähe ver-
fügbaren Cluster und erhält prompt europa- bzw. weltweite interessante
sowie nützliche Meldungen zum DX-Geschehen auf den Bändern.
Soweit, so gut.
Seit einigen Monaten muß man allerdings eine Entwicklung feststellen,
die mit Ham Spirit nichts mehr im Sinn hat. Es wird gemeckert, gemotzt,
gechattet und diffamiert, was die Tasten hergeben!
Nur ein Beispiel (von vielen): Da wird VK6JQ als „bad operator“ bezeich-
net, nur weil er nicht 599-Rapporte austauscht. Sicher, wenn man wäh-
rend einer der seltenen 6-m-Öffnungen nach Australien lange auf sein
QSO warten muß, kostet das Nerven. Aber letztlich ist es die alleinige
Entscheidung des OPs, wie er seine Verbindungen abwickeln möchte.
Man kann sich dann zwar ins eigene Hinterteil beißen, aber seinen
persönlichen Frust in dieser Art „Kommentar“, und das noch europa-
weit, zum Ausdruck zu bringen, ist gelinde gesagt mehr als unver-
schämt und gehört sich ganz einfach nicht.
Auch „Spaghetti-Makkaroni-Kartoffel“ häuft sich − Widerspiegelung der
bedauerlichen Vorgänge, die sich oftmals auf DXpeditionsfrequenzen
abspielen und sogar schon die IARU-Region-1-Konferenz in Lillehammer
zwang, sich mit derartig unflätigem Benehmen auseinanderzusetzen.
Ob allerdings der zu Papier gebrachte Aufruf an die Landesverbände,
ihre Mitglieder zu besserer Amateurfunkmoral (Ham Spirit) zu bewegen
und gegen Stationen tätig zu werden, die beleidigende und böswillige
Störungen auf den Afu-Bändern verursachen, Früchte trägt, bleibt nur
zu hoffen.
Mit diversen Cluster-Filterfunktionen läßt sich zwar alles mögliche ein- oder
ausblenden, trotzdem eine Bitte: Verschont andere User mit europaweit
lesbaren Announcements, wenn die Nachricht eigentlich nur einen
bestimmten OM erreichen soll, den man auch meistens leicht selbst
lokalisieren kann.
Über ein anderes Thema sollte man auch noch einmal nachdenken:
Inzwischen ist es an der Tagesordnung, speziell bei UKW-Contesten,
sich selbst zu spotten (self announcements) oder „DX-Meldungen“
in Form von „Wir sind jetzt auf 370, drehen die Antenne zu Euch“
abzusetzen.
Da entsteht zwangsläufig die Frage, ob so etwas noch im Sinne der
entsprechenden Contestausschreibung bzw. gegenüber anderen Con-
testern, die sich derartiger Mittel nicht bedienen, fair ist? Etliche
Contestauschreibungen beinhalten seit einiger Zeit schon Extra-Kate-
gorien, falls man sich Meldungen der DX-Cluster bedient; andere, wie
die des WAG-Contests, erlauben es ausdrücklich. Wer sich die Cluster-
meldungen im Contestbetrieb zunutze macht, ist meiner Meinung nach
keine Einmannstation mehr im Sinne der ursprünglichen Definition.
Vielleicht bleibt da nur, die Begriffe für Einmann- und Mehrmannstation
künftig ganz neu zu definieren. Denn kontrollieren kann und sollte es
niemand. So scheiden sich momentan auch hier noch am Ham Spirit
die Geister.
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Die Alternative
Haben Sie sich auch vor kurzem wieder mal geärgert, als Sie Ihren
Windows-PC mit wichtigen Daten gefüttert haben und er Ihnen just vor dem
Klick auf „Abspeichern“ das Betriebssystem mit hämischer Bosheit mitteilte,
ein Fehler wäre durch eine „ungültige Seite im Modul 0-8-15“ verursacht
worden? Na, vielen Dank auch! Die ganze Arbeit von Minuten oder sogar
Stunden (was denn, so lange haben Sie nicht zwischengespeichert?) ist für
die Katz. Und dabei mußten Sie doch mindestens zwei „Blaue“ auf den
Ladentisch legen, um dieses Redmonder Wundersystem zu erwerben.
Apropos wundern: Ist Ihnen irgendwann mal aufgefallen, daß unter Windows
gerade Anwenderprogramme aus dem Hause Micro$oft immer etwas stabiler
und schneller laufen als vergleichbare Konkurrenzprodukte? Schon mal was
von undokumentierten API-Funktionen gehört? Die Wettbewerber nutzen mal
schön die „definierten Standards“, man muß ja nicht wissen, daß auch unter
dem Schottenrock alles andere als „gar nichts“ ist. So nutzt man eine
Monopolstellung, nicht anders! Und kassiert Lizenzgebühren! Wem das
nun allzuviel Polemik sein sollte, dem lege ich als entspannende Lektüre
Wendy Goldman Rohms Bestseller „Die Microsoft Akte − Der geheime Fall
Bill Gates“ ans Herz. Viel Spaß beim Lesen!
Viele Unternehmen, Hersteller, Softwareentwickler und Anwender haben
inzwischen erkannt: Die ausschließliche Verwendung einzelner kommerzi-
eller Betriebssysteme schafft auch kommerzielle Abhängigkeiten. Deshalb
suchen sie nach Alternativen. Und die gibt es doch längst. Das Zauberwort
heißt Linux!
Lizenzgebühren? Für Open-Source-Produkte wie Linux kein Thema.
Einbringen eigener Funktionalität? Bitte sehr! Linux lebt ja gerade davon,
daß es weltweit von Programmierern fortentwickelt wird. Der Quelltext ist
jedermann zugänglich. Klar, daß da auftretende Fehler schnell behoben sind.
Kein Ärger mit „Schutzverletzungen“ oder den berühmt-berüchtigten „Blue
Screens“ des Kommerzkandidaten Windows.
Sicherlich, für eine erfolgreiche Linux-Installation ist man gezwungen, sich
intensiv mit seinen Hardware-Voraussetzungen zu beschäftigen. Aber: Einmal
installiert, hat man danach ein äußerst stabiles und schnelles Betriebssystem
mit minimalem Wartungsaufwand auf der Platte. Und selbst die Software-
kosten halten sich in ausgesprochen bescheidenem Rahmen, denn Linux
bringt vieles, wie z. B. Netzwerkintegration, E-Mail, Intranet, Texteditoren,
Grafikprogramme etc., bereits von Hause aus mit. Dinge, für die man beim
Micro$oft-Betriebssystem schon mal richtig extra löhnen muß.
Besonders, wenn man in Richtung Internet schaut, kann man feststellen, daß
Linux bereits sehr verbreitet ist. Gerade wegen der schon sprichwörtlichen
Stabilität und Absturzsicherheit setzen viele Internet-Provider auf Linux.
Nun gut. Eine derartige Programmvielfalt wie unter Windows, angefangen von
der Briefmarkenverwaltung über die multimediale Dia-Verwutzelungs-Show
bis hin zur Schmiedehammer-Spezialanwendung, ist für das kostenlose
Betriebssystem noch rar gesät. Aber auch auf dem Softwareentwicklungs-
markt zeichnen sich Tendenzen ab: Namhafte Hersteller denken inzwischen
laut über die Portierung ihrer Entwicklungsumgebungen für Anwenderpro-
gramme nach, wie z. B. Borland mit seiner Delphi-IDE. So sollte es eigentlich
nur noch eine Frage der Zeit sein, bis das „Programmvielfalt-Argument“ auch
für Linux seine Berechtigung verliert.
Wie wär’s mit einer Einführung in Linux? Nur noch ein paar Seiten Geduld.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Verpflanzung gelungen
Der Mensch, so weiß man, ist ein Gewohnheitstier. Und so war es nicht
ohne Risiko, die seit 43 Jahren etablierte Fachmesse der UKW-Amateure
vom liebgewonnenen und besucherfreundlichen Weinheim in die Mai-
markthallen vor den Toren des benachbarten Mannheims zu verfrachten.
Gemessen an den Besucherzahen (1000 mehr als im Vorjahr) hat dies
der Attraktivität der Veranstaltung keinen Abbruch getan, auch wenn
einige bekannte VHF/UHF/SHF-Barden nicht gesichtet wurden.
Während Besucher, Aussteller und die diesmal vor eventuellen Witte-
rungsunbilden geschützt untergebrachten Flohmarktanbieter sich
gleichermaßen zufrieden über das neue Ambiente äußerten, wurden die
ohnehin eher niedrigen Erwartungen der Funkfachhändler kaum über-
troffen. Gefragt waren Zubehörteile und nicht wertintensive Grundgeräte
− die Bereitschaft für teure Spontankäufe war praktisch gleich Null.
Einen Punktsieg errangen Difona & Co., denen es durch gemeinschaft-
liche und energische Intervention gelang, die Messeleitung zur Unter-
bindung des illegalen, weil mehrwertsteuerfreien, Geräteverkaufs durch
italienische „Kollegen“ zu bewegen. Schließlich dürfte auch den Kunden
der Fortbestand eines leistungsfähigen Fachhändlernetzes mit konti-
nuierlich übers Jahr präsentiertem Gerätesortiment mehr bringen als
das einmalige zweifelhafte Schnäppchen.
Angesichts allgemeiner Verunsicherung der Funkamateure durch Selbst-
erkärung, HSM-Reglementierung, HF-Hysterie und das Steuer- und
Renten-Hickhack der Bundesregierung ist die Marktsituation so, daß
den Händlern keinerlei Spielräume bei der Preisgestaltung bleiben. Und
schließlich kauft man ja auch High-Tech und nicht Souvenirs auf einem
orientalischen Basar.
Daß trotz kommerzieller Technik noch genügend Möglichkeiten für krea-
tive Entfaltung in unserem Hobby bleiben, haben führende Vordenker
und Konstrukteure der UKW-Gemeinde in ihren Vorträgen vermitteln
können. Kristallisationskerne waren diesmal neben der aus derzeitigen
Diskissionen kaum wegzudenkenden EMV-Problematik 10-GHz-Themen
von ATV bis Regenscatter. Gerade letztgenannte Betriebsweise läßt
erkennen, wie mit sinnvoller Ergänzung durch gemeinhin als „amateur-
funkfeindlich“ eingestufte Dinge wie GSM-Handy und Internet auch
heute noch Pionierleistungen zu vollbringen sind!
Sind es nicht auch häufig Funkamateure, die dank ihres geschärften
Blickes in ihrer hauptberuflichen Tätigkeit Innovationen wie Mobilfunk
und globale Datenkommunikation voranbringen? Kraftquell raffinierter
technischer Errungenschaften ist last but not least der Selbstbau, der
in Mannheim neue Impulse erhielt: Der Weinheimer OV richtet einen
Selbstbauwettbewerb aus, dessen Ausschreibung im Januar u. a. im
FUNKAMATEUR zu lesen sein wird und dessen Ergebnisse dem Fachpu-
blikum bei der im September 2000 abermals in Mannheimer Gefilden
stattfindenden UKW-Tagung präsentiert werden sollen.
Also, dann schon einmal den Lötkolben suchen (?) und vorheizen − hwsat
OMs?
Dr. Werner Hegewald, DL2RD
Aerger ueber praehistorische Realitaeten
Vielleicht sollte man die nun in den meisten Presseerzeugnissen vollzogene
Rechtschreibreform (ja, wir werden uns ihr mit wenig Überzeugung dem-
nächst ebenfalls beugen) zum Anlaß nehmen, einmal über ein in unserer
extrem agilen Kommunikations- und Datenverarbeitungswelt anscheinend
unverrückbares und inzwischen in dieser Relation geradezu archaisches
Relikt nachzudenken.
Der IBM-kompatible PC ist inzwischen volljährig. Aber Packet-Radio oder
e-Mails im deutschsprachigen Raum sind zumindest in einem Detail den
Kinderschuhen immer noch nicht entwachsen: Jeder Anfänger wird in
den einschlägigen Einführungen zu e-Mails und Newsgroups geradezu
händeringend darum gebeten, doch ja alle Umlaute in ihre Bestandteile
zu zerlegen und aus jedem ß doch unbedingt ss zu machen, was bei
letzterem in der Hälfte der Fälle inzwischen durch besagte Rechtschrei-
bung gedeckt ist.
Man kommt sich hier immer noch wie in der Computersteinzeit der Ära von
C 64 oder CP/M vor, die völlig durch ihre angloamerikanische Herkunft
dominiert war. Aber spätestens mit dem erweiterten ASCII-Zeichensatz
wäre es ja besser gegangen. Zumindest gab es sachte Schritt für Schritt
deutsche Versionen verbreiteter Programme, die bald auch mit Umlauten
umgehen konnten und neuerdings auch etliche, bei denen man bei der
Installation die Sprache(n) wählen kann.
Nun komme mir heute keiner mehr damit, daß es spätestens mit Windows
verschiedene gebräuchliche, aber bezüglich Sonderzeichen unverträgliche
Zeichensätze gäbe (liest sich in Primitiv-Schreibweise auch ganz nett).
Zur Anpassung lassen sich ganz simple Umwandlungs-Algorithmen nutzen.
Textverabeitungsprogramme verfügen heute praktisch ausnahmslos über
Konvertierungsfilter, die ganz nebenbei auch die Umlaute sauber über-
tragen.
Wieso geht das aber alles bei Packet-Radio, e-Mail und in Newsgroups
nicht? Weil die Pioniere dieser Medien erzkonservativ sind und/oder
eh nur in Englisch parlieren? Lösungen dafür erfordern nur etwas guten
Willen, eine gegenseitige Abstimmung − und mit der nächsten Programm-
version ist das Problem vergessen. Für ältere DOS-Software käme ein
kleines Zusatzprogramm in Frage.
Wer sich mal den endlosen Kopf einer e-Mail angesehen hat: Dort hat man
so viel für die meisten Nutzer Überflüssiges versteckt, daß daraus im
Normalfall die notwendige Art der Umsetzung ableitbar ist. Wenn nicht,
würde ein unbedeutender Zusatz genügen. Und auch bei Packet-Radio
lassen sich bei etwas gutem Willen und entsprechender Publizierung
zweifellos wirksame Lösungen finden − ein Thema für die nächste Sysop-
Tagung?
Ich jedenfalls schreibe e-Mails nur noch mit Umlauten. Vielleicht ist das
ein wenig ignorant, womöglich trägt es aber auch dazu bei, diesen alten
Hut bald loszuwerden.
Mit besten Gruessen :-((
Bernd Petermann, DJ1TO
Alarmstufe Rot
Die Bilanz der 24. HAM RADIO liest sich nicht schlecht: „Rund 18 000
Funkamateure“ besuchten die Veranstaltung. Aber in Erfolgsmeldungen
bedeutet „rund“ bestenfalls „nicht ganz“, und wir erinnern uns, daß es
zwei Jahre zuvor noch 21 219 waren. Ob es sich ausschließlich um
Funkamateure handelte, darf bezweifelt werden, denn die HAMtronic-
Komponente der Messe hat einige tausend PC-Freaks aus der Umgebung
angelockt, die mit dem Amateurfunk eher wenig zu tun haben.
Das Messe-Management hat 1997 eine Entscheidung getroffen, die sich
schon im Vorjahr als großer Fehler erwies. Zwar dürfte die Verlegung auf
Donnerstag bis Samstag zu Einsparungen bei den Personalkosten ge-
führt haben, aber um den Preis eines drastischen Besucherrückgangs.
Berufstätige und entfernt wohnende Interessenten sind de facto aus-
geschlossen. Nicht jeder kann zwei Tage freinehmen. Oder erwartet
man gar, daß sich Funkamateure am Freitagnachmittag aus Hamburg oder
Cottbus über verstopfte Autobahnen quälen, um einen abgegrasten
Flohmarkt vorzufinden oder den Ausstellern samstags ab 16 Uhr beim
Einpacken zuzusehen?
Am FUNKAMATEUR-Stand jedenfalls haben 83 Besucher aus unterschied-
lichsten Gründen ihre Anschriften hinterlassen, von denen gerademal sechs
aus den Postleitzahlbereichen 0 bis 2 kamen. Und reisten im vorigen Jahr
beispielsweise noch etwa 40 Leute per Bus aus der Steiermark an, reichte
den OE6ern diesmal ein Achtsitzer. Zahlen, die Bände sprechen.
Aber Funkamateure, die nicht kommen, kaufen auch nichts. Immer mehr
Händler bleiben wegen rückläufiger Umsätze bei permanent steigenden
Kosten fern, zumal sie sich angesichts der Marktsituation ohnehin einem
ruinösen Preiskampf aussetzen müßten. Doch weniger Aussteller mindern
die Attraktivität der HAM RADIO, was wiederum die Besucherzahlen
drückt − ein Teufelskreis.
Drei Jahre soll das Donnerstag-bis-Samstag-Experiment laufen. Aber
hätte man den Test nicht schon abbrechen müssen, als sich 1998
erstmals zeigte, daß der Proband Schaden nimmt? Haben die Entschei-
dungsträger vergessen, wie die Interradio in sich zusammengefallen ist?
Und verpflichtet nicht die HAM RADIO-Tradition, alles zu unterlassen,
was der größten europäischen Amateurfunkmesse zum Nachteil
gereichen könnte?
Weil aber so beschlossen, soll es auch nächstes Jahr bei Donnerstag bis
Samstag bleiben. Schließlich fällt der erste Messetag auf den Fronleich-
nam. Und wie gut unterrichtete Quellen wissen, könnte es 2000 noch
eine Erweiterung um den bisher kaum präsenten CB-Funk geben.
Im Klartext: Lediglich Funkamateure aus einigen Bundesländern haben
bessere Chancen, sofern es deren Familien an vier freien Tagen nicht in
andere Gegenden drängt. Selbst wenn sich der spärliche Nachwuchs
der Funkamateure teilweise aus CB-Kreisen rekrutiert, dürften ein paar
hundert Breaker den Besucherschwund nicht wettmachen.
Messeleitung und DARC als ideeller Träger sollten sich also besinnen:
Zurück zu Freitag bis Sonntag. Amateurfunk ist ein Hobby, und das findet
nun mal in der Freizeit statt. Andernfalls wäre schon jetzt zu überlegen,
wie sich im kommenden Jahr rund 17 000 oder gar nur 16 000 Besucher
als gutes Ergebnis bejubeln lassen.
Knut Theurich, DGØZB
Inkompatibilitäten
Portabel und hardwareneutral soll sie sei, die Standardsoftware. Aber einer
Umfrage der Computerwoche zufolge, die einige Anwender und Software-
häuser nach der Hardwareneutralität von Branchenprogrammen befragte,
kam heraus, daß viele Software-Pakete dem Neutralitätsanspruch nicht ge-
recht werden. Statt zu versuchen, vorhandene Software von einem System
auf ein anderes zu portieren, sei es mitunter billiger, gleich ganz die Hard- und
Software auszuwechseln, ganz nach dem Motto: „Nimm die Software und kauf
dir den Rechner dazu.“ Oder: Offene Systeme sind heute für die Datenkommu-
nikation unerläßlich. Durch normierte Ebenenmodelle sollten herstellerspezi-
fische Netzwerkkonzepte kompatibel gemacht werden. In der Praxis sieht das
jedoch ganz anders aus. Für einen reibungslosen Netzknoten-Informations-
austausch sind dann sogenannte „Interface-Emulatoren“ erforderlich.
Was in den eben genannten Beziehungen meist nur Firmen- und Unterneh-
mensansprüche tangiert, bekommt aber auch der Privatanwender zu spüren.
Das Thema Inkompatibilität scheint unerschöpflich zu sein. Nehmen wir z. B.
das ZIP-Plus-Laufwerk. Kürzlich räumte die Firma Iomega indirekt Probleme
beim Betrieb des ZIP-Plus-Laufwerks am SCSI-Bus ein. Zwar windet man sich
damit heraus, daß man einfach darauf achten müsse, das Zip-Drive nicht an
Notebook-SCSI-Adapter anzuschließen und es ansonsten einfach als einziges
Gerät am SCSI-Bus zu betreiben, was dann alle Probleme löst. Doch kann das
die Norm sein? Als „Support“ wird dann sogar noch ein Handbuch angeboten,
welches die Betriebsprobleme dokumentiert. Voilà!
Aber die Ärgernisse mit der Nichtvereinbarkeit gewisser Dinge sind ja meist
viel profaner. So ist beispielsweise die korrekte Darstellung von Sonderzeichen
und Umlauten auf dem PC offensichtlich generell ein Glücksspiel bei Hunder-
ten von verschiedenen Zeichensätzen. Machen Sie doch einfach mal das
Editor-Programm von Windows auf, tippen ein paar „äöü“ und sehen sich
die so erstellte Datei mit dem ebenfalls in Windows integrierten WordPad als
MS-DOS-Textformat an. Kein Kommentar!
Wann findet man hier endlich mal eine verbindliche Standardlösung? Schon
mit einem 16-Bit-Generalzeichensatz ließen sich schließlich bereits 65 536
verschiedene Codes − und zwar eindeutig − definieren, sicherlich genug für
sämtliche europäischen Eigenheiten von Å bis Ω.
Aber ein wirklich einheitliches Datenaustauschformat schmälert Marktvor-
teile. Was dabei herauskommt, wenn man tatsächlich mal so etwas wie einen
Standard etablieren will − siehe HTML − kann man ja an den Stellungskriegen
zwischen Netscape und Microsoft ablesen. Doch damit nicht genug. HTML
hat gewisse Einschränkungen durch seine Statik. Also war es nur eine Zeit-
frage, bis „Dynamic HTML“ entwickelt wurde. Hier spielte Microsoft mit vielen
neuartigen Web-Techniken. Netscape konterte schnell. Ergebnis: Inkompati-
bilität der DHTML-Erweiterungen des Netscape Communicators gegenüber
denen des Internet Explorers − und umgekehrt.
An Inkompatibilität ließ sich’s halt schon immer gut verdienen. Nicht nur
bei der Software, sondern auch bei ganz simpler Hardware. Jüngstens erst
mußte bei mir eine neue Computermaus her. Meine „alte“ Genius-Maus, die
mit WfW 3.11 prima zusammenarbeitete, absolvierte als „Zeigegerät“ auch
noch problemlos das Update auf Windows98. Doch nach dem ersten Start
des neuen „Windoofs“ erkannte das System plötzlich „keine Maus oder
anderes Zeigegerät“ mehr. Nach Kauf einer M$-kompatiblen Maus neuerer
Generation war dann einfach so auch ohne jegliche Treiberinstallation alles
O.K. Ist das nicht wunderbar?
In diesem Sinne − bleiben Sie schön kompatibel.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Mit gemischten Gefühlen
Es ist ein herrlicher Tag. Etliche OMs aus dem OV befassen sich intensiv
mit dem Aufbau diverser Antennenanlagen und den dazu passenden
Stationsausrüstungen. Auf Kurzwelle laufen schon erste QSOs, und die
2-m-Antenne positioniert sich mit freiem Ausblick auf die umgebende
Landschaft. Getränke gehen reihum, auch die Grillkohle fängt allmählich
Feuer. Die Stimmung entwickelt sich prächtig − Herrentag. Man ist der
Stadt und ihrem QRM/QRN-Pegel mal wieder entkommen und genießt
die Amateurfunkbänder in ihrer ursprünglichen Reinheit.
Noch sind solche Unternehmungen an bestimmte Anlässe gebunden,
aber vielleicht ist das in Zukunft die einzige Alternative, die uns zuge-
teilten Frequenzbereiche noch sinnvoll nutzen zu können?
Wie sagte doch MinDir Masson vom BWMi anläßlich der ersten diesjäh-
rigen Tagung des Runden Tischs Amateurfunk (RTA) am 25.4.: Derzeit
befassen sich die Experten mit der Wirtschaftlichkeit von PLC und xDSL,
und somit ist in absehbarer Zukunft nicht mit einer Gefährdung des
Amateurfunkdienstes zu rechnen. Und dann, später, wenn sie zu einem
Ergebnis gekommen sind?
Man kann sich denken, wie es aussehen wird … Da beruhigt auch die
Erfolgsmeldung des DARC bezüglich einer in eine Entschließung des
Europäischen Parlaments zum Grünbuch zur Frequenzpolitik einge-
brachte Regelung nicht, daß der Amateurfunkdienst von öffentlichem
Interesse und wettbewerbsuntauglich sei, daher also geschützt werden
müsse. Läßt sich so etwas tatsächlich wirksam umsetzen? Da bleiben
Zweifel. Wo Konkurrenz ist, bleibt der Schwächere oft auf der Strecke,
und das könnten wohl wir sein.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, in der Bündelung aller Kräfte, die um den
Fortbestand des Amateurfunks kämpfen, nicht nachzulassen. Umso
schwerer fällt es, die wiederholte und unkommentierte Ablehnung des
Aufnahmeantrags der AGZ (Arbeitsgemeinschaft Zukunft Amateurfunk-
dienst) in den RTA zu verstehen. Stehen hier etwa persönliche Animosi-
täten im Vordergrund? Das wäre schlimm!
Als Nächstes steht dann die Abgabe der Selbsterklärung ins Haus, wobei
die Verfügung 306/97 bezüglich der Nahfeldproblematik noch immer
novelliert wird. Wie es heißt, zu unserem Vorteil. Was nach der Abgabe
der Unterlagen kommt, läßt schon jetzt Spannung und ein ungutes
Gefühl im Magen aufkommen.
Aber werfen wir einmal für den Augenblick all unsere berechtigten Sorgen
um den Bestand des Amateurfunks über Bord und freuen uns auf die
Ham Radio vom 24. bis 26.6. in Friedrichshafen, dieses in Europa einzig-
artige Treffen Tausender Gleichgesinnter. Lernen wir Funkpartner per-
sönlich kennen, tauschen Informationen aus, nehmen neue Ideen mit −
und lassen wir uns von Innovationen der Gerätehersteller faszinieren.
Denn sie und die Händler sind für unser Hobby sehr wichtig. Letztere
beklagten allerdings bei der vorigen Ham Radio starke Umsatzeinbußen,
einige verzichten in diesem Jahr auf die Messeteilnahme. Wenn sich die
Tore diesmal schließen, sollte ein Besucherzuwachs zu konstatieren sein.
Ob das so ist, hängt davon ab, ob auch Sie sich auf den Weg machen.
Der FUNKAMATEUR ist jedenfalls dabei, man sieht sich in Halle 10,
Stand 71. Bis dahin beste 73!
Wolfgang Bedrich, DL1UU
Funkamateurs 2K-Problem
Wir alle, so scheint es, sind von Y2K bedroht. Denn keiner kann bis dato ge-
nau sagen, was in der Sekunde geschieht, in der das „neue Jahrtausend“ be-
ginnt. Sollte die Mikrowelle spinnen, weil sie am 1.1.1900 noch nicht erfunden
war, wird man es verschmerzen. Und eigentlich kann man auch darauf ver-
trauen, daß es noch im Januar 2000 wieder Strom gibt. Sorgen mache ich
mir aber über das, was uns Funkamateuren die nähere Zukunft bringt.
Wenn man bedenkt, wie wir zu Tastaturfreaks verkommen sind, wie sich die
Bürger der westlichen Welt über die bunten Bilder aus dem Netz der Netze
freuen, über Webcams und alles, was uns sonst noch Spaß macht. Und
Kohle bringt. Womit wir beim Thema wären. Geld mit Bits und Bytes ver-
dienen ist schön. Und dank Bill Gates weiß jeder, daß es dabei nicht um
Peanuts geht.
Inzwischen hat sich neben den geschäftstüchtigen Programmierern eine
weitere Spezies etabliert: die Eigentümer der Leitungsnetze. Vorstände
und Aktionäre der Netzbetreiber wissen es längst: Datentransfer ist Wert-
schöpfung! Je mehr die Leute via Internet saugen, desto voller die Kassen;
vom kommenden e-Kommerz ganz zu schweigen.
Web ist bares Geld. Unter diesem Gesichtspunkt scheint es naiv, zu glauben,
irgendwer könnte ADSL & Co. stoppen. Arbeitsplätze in Gefahr! Kommu-
nikationsstandort Deutschland bedroht! Grundrecht auf freie Informations-
beschaffung? Etwa auf Mittelwelle? Mit der Modulationsart der Urgroßväter?
Wer meint da, die Interessen einiger tausend ohnehin ungeliebter Funkama-
teure könnten die Entwicklung aufhalten?
Irgendwie erinnert mich PLC/xDSL übrigens an die Verlegenheitslösungen
der DDR-Industrie: Not machte erfinderisch − und heute ist es nicht der
allgegenwärtige Ressourcenmangel, sondern das Besteben, teure und
machbare Lösungen durch ein Billigprodukt zu ersetzen. So müllt man hier
eben mal schnell Lang-, Mittel- und Kurzwelle zu. Eben eine Behelfslösung
− doch werbewirksam als superfortschrittliche, ja geradezu revolutionäre
(und vor allem profitable) Technologie verkauft.
Als hätte man tatsächlich erst jetzt entdeckt, daß die Übertragungskapazität
üblicher Telefonleitungen bis dato geradezu sträflich unausgelastet geblie-
ben wäre. Warum nur hatten die verkalkten Ingenieure von anno Tobak
etwas gegen strahlende Leitungen? Weil der Äther für drahtlose Über-
tragungen brauchbar bleiben sollte! Überholt, weil Hörfunk und Fernsehen
auf höheren Frequenzen und übers Kabel laufen?
Doch gibt es außer durch die Intervention diverser betroffener Funkdienste
noch weitere Hoffnung. Die versprochenen Mega-Datenraten teilen sich ja
entsprechend der Nutzerzahl auf; damit kühlt die hochgekochte Suppe
schon etwas ab. Die volle Geschwindigkeit ist außerdem nur für kommer-
zielle Anwender gedacht. Für sie und auch private Anwender scheint das
Ganze nach gegenwärtigen Aussagen überdies nicht eben billig zu werden.
Bietet außerdem das Internet dann selbst letztlich genügend Durchlaßfähig-
keit? Und gelingt die HF-Entkopplung der Leitungen im Fernsprechkabel bei
sehr vielen Nutzern auch zufriedenstellend?
Immerhin gibt es bereits Alternativen: SkyDSL von Teles soll im Juli starten
und über eine 15-cm-Schüssel bis zu 2 MB/s in den Rechner übertragen.
Sandner Airdata bietet in Großstädten Funkverbindungen bis zu 512 kB/s an.
Nicht zu vergessen die Möglichkeiten der Breitbandkabelnetze.
Irgendwann kommt die Glasfaser − und PCL/xDSL wandern auf den Schrott.
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Bequeme Lösung
Früher habe ich meine Geräte je nach Erfordernis und Ausführung mit
einer zwei- oder dreiadrigen Leitung aus der Steckdose versorgt, mit
einem Netzschalter im (!) Gerät ein- und ausgeschaltet. Eine optische
Rückmeldung signalisierte den Status des Geräts. Jetzt befinde ich mich
in einer neuen Epoche der Geräteentwicklung.
Wo früher eine einzige mittlere Steckdosenleiste eine Gerätegruppe
versorgte, sind es nun schon zwei. Aber dafür größer, umfangreicher.
War ehedem das Ein- bzw. Ausschalten der Geräte mit einer schlappen
Fingerbewegung erledigt, so darf ich heute für diese Vorgänge endlich
wieder die kleinen grauen Zellen aktivieren.
So hocken auf den Steckdosenleisten die allseits bekannten schwarzen
Kästchen, Steckernetzteile aus aller Herren Länder. Und da die Oberfläche
einer Steckdosenleiste begrenzt ist und eigentlich nie zwei solcher
Netzteile nebeneinander passen, muß man ähnlich wie im Hausbau nach
oben ausweichen.
Das führt mitunter zu den seltsamsten Stockungsmethoden und Verfah-
ren, als ideale Hilfe scheinen sich Europa-Doppel- oder Dreifachstecker
als „Abstandsstücke“ zu bewähren. Nur gut, daß man die Innereien
und Kontakte dieser Konstruktion nicht sieht. Abgesehen davon muß ich
nur noch entscheiden, welches Steckernetzteil gerade gesteckt oder ge-
zogen, welches permanent durchlaufen muß.
Warum überhaupt Steckernetzteile? Vermutlich, um leichteres Spiel mit
der elektrischen Sicherheit zu haben und die damit versorgten Geräte
durch geringere Größe, Masse und Wärmeentwicklung attraktiver zu
machen. Auch wenn die angeschlossenen Geräte manchmal über einen
Betriebsspannungsschalter verfügen, das Steckernetzteil bleibt im Leer-
lauf am Netz, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Daß dabei durchaus
Energie verschwendet wird, zeigt der Anfaßtest: Alle erwärmen sich auch
ohne Last. Na, wenigstens reduziert dieser Fakt die Heizkosten.
Immerhin befinden sich diese Dinger in trauter Gesellschaft mit einer zu-
nehmenden Zahl elektronischer Geräte, die das Netzteil zwar eingebaut
haben, dafür aber keinen Einschalter mehr besitzen. Tolle Sache, wenn da
mal in der Nähe der Blitz einschlägt und alles den Überspannungstod stirbt.
Wenn die Steckernetzteile dann wenigstens noch hier und da kompatibel
wären! Aber nein, fast jedes Gerät verlangt seinen speziellen Typ, der um
der Garantie und sonstiger Haftung willen keinesfalls substitiert werden
darf. Sonst könnte man sie ja später weiter verwenden.
Also Steckdosenleisten mit Schalter verwenden. Doch die müssen dann
schon auf dem Tisch stehen, wenn man nicht jedesmal zur Gymnastik
gezwungen sein möchte. Für etwas mehr Lebensqualität fehlen mir funk-
ferngesteuerte Steckernetzteile (natürlich im 70-cm-Band) bzw. Master-
Slave-Steuerungen mit logischer Verknüpfung untereinander. Das wäre
doch ein interessantes Experimentierfeld und ein notwendiges dazu.
Es könnte aber auch sein, daß ich nach Ablauf der Garantiezeit während
einer Frustphase in diese modernen Geräte jeweils ein Netzteil sowie
Schalter und optische Rückmeldung einbaue. Vielleicht ist das eine
Marktlücke?
vy 73
Max Perner, DM2AUO
DX goes Internet?
Es liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber ich bin meinem Funkfreund
„Manne“ heute noch mehr als dankbar, daß er meine Aufmerksamkeit
zuerst auf die damals in ex-Y2 noch neue Betriebsart Packet-Radio und
später dann zum Internet gelenkt hat.
Nicht auszudenken, welchen finanziellen und zeitlichen Aufwand wir bei
unserem binationalen Nachwende-Projekt QSL-Routes derzeit treiben
müßten, um allein den Datenfluß zwischen allen am Projekt Beteiligten
aufrechtzuerhalten. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, den mehr oder
weniger umfassenden Datenbestand der vergangenen 40 Jahre mit den
betreffenden Managern bzw. OPs abzugleichen. Für eine Unternehmung,
die das Maß eines schlichten Aneinanderreihens von zusammengetragenen
QSL-Informationen übersteigt, sind solche Hilfen aus heutiger Sicht
unverzichtbar.
Darüber hinaus findet man natürlich im Internet als DX-interessierter Funk-
amateur eine Vielzahl von Informationen, Homepages und Newsgroups,
die ihm das Leben auf den Bändern ungemein erleichtern. Ob es sich
dabei um die taufrische Information der ARRL handelt, daß mit Zuweisung
des Rufzeichenblockes E4 für Palästina ein neues DXCC-Land (entity)
geboren wurde, ob man sich für eine detaillierte Landkarte des Standorts
der soeben gearbeiteten Station interessiert (ein Herumstöbern bei
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/Map_collection.html
führt fast immer zum Ziel) oder ob man einfach nur einmal einen QSL-
Manager sucht − das WWW hält nach meinem Dafürhalten für jeden
eingefleischten DXer eine Menge Überraschungen bereit.
Für besonders bemerkenswert schätze ich das Versenden der bisher
gedruckten DX-Mitteilungsblätter via e-Mail im Portable Document
Format, PDF, ein. Da die Leserschaft im allgemeinen über den gesamten
Erdball verteilt ist, sind naturgemäß diejenigen DXer im Vorteil, die im
selben Land wie der Herausgeber wohnen. Mittels Internet wird der
Nachteil der Papierversion, der teilweise lange Postweg, ausgeglichen.
Gleich in welcher Ecke unseres Erdballs ich mich befinde, mir sind damit
die publizierten Daten (praktisch) zeitgleich mit den bisher bevorteilten
DXern zugänglich. Dem Vorreiter Carl, N4AA, und seinem Mitteilungsblatt
QRZ DX sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Ähnlich verhält es sich mit der zunehmend Verbreitung findenden Publi-
kation von Logs im Internet. Der sportliche Reiz am DX-Geschehen wird
dadurch erhöht, daß man (zumeist) einen Tag nach der Verbindung mit
einer DX-Expedition weiß, ob am anderen Ende des Pile-Ups das QSO
seinen korrekten Eingang in das Expeditionslog gefunden hat. Das Führen
eines Papierlogs für besonders wichtige QSOs halte ich für unabdingbar,
damit bei technischen Defekten des Computers nicht der große Katzen-
jammer einsetzt. Die Erfinder des On-Line-Log-Checking brachten so viel
Erfahrung ein, nur das Rufzeichen nebst Band zu veröffentlichen…
Allerdings nimmt die Informationsflut mittlerweile schon solche Ausmaße
an, daß bereits jetzt die für die meisten DXer viel zu knapp bemessene
Freizeit für die Sichtung der News nur noch selten ausreicht. Eine noch
stärkere Strukturierung des Datenflusses im Internet ist nach meiner Ansicht
unumgänglich, wollen wir uns im Informationsdickicht nicht über die Maßen
verstricken. Neue Ideen sind gefragt. Dabei setze ich auf die millionenfache
Erfahrung und Kreativität der Funkamateure!
Ihr
Dr. Fritz-Ullrich Schneider, DL9WVM
Was macht einen Funkamateur aus?
Funkamateur ist jemand, der sich aus dem Interesse an der Funktechnik mit
diesem Metier beschäftigt, dabei in der Regel zwar nicht einschlägiger Fach-
mann ist, aber meist autodidaktisch erworben, ein Wissen und Können auf
diesem Gebiet aufweist, das deutlich über der Allgemeinbildung liegt.
Dem „lizenzierten“ Funkamateur räumt der Gesetzgeber dabei Rechte ein,
die sonst nur Firmen oder kommerzielle Funkdienste haben. Einschränkungen
des Nachrichteninhalts gibt es, den Kommerz ausgenommen, nicht mehr.
Diese Rechte erwirbt der Funkamateur, indem er bei einer Prüfung seine
Kenntnisse unter Beweis stellt.
Zu unterscheiden ist ziemlich klar zwischen den technischen und funkbetrieb-
lichen Aspekten des Hobbys. Früher ging das zweite kaum ohne das erste,
denn Fertiges konnte man nicht kaufen (oder nicht bezahlen). Schon damals
gab es aber Funkamateure denen es genügte, wenn ihr Gerät einwandfrei
funktionierte; ihr Interesse am Funkbetrieb erlosch nach einigen QSOs, die
ihnen diesen Fakt bestätigten. Anderen war dagegen die Technik nur Mittel,
um möglichst gut funken zu können.
Diese Zusammenhänge finden sich heute noch im QRP-Bereich, der wohl
einzig weiterhin einen effektiven Selbstbau zuläßt, s. QRP-AG. Einen leistungs-
fähigen Allbandtransceiver auf dem Niveau der kommerziellen selbst auf die
Beine zu stellen oder auch nur seine technischen Details bis zum Prozessor
und der DSP zu verstehen, ist wohl kaum noch jemanden vergönnt.
Entsprechend verlief die Entwicklung in Richtung „Steckdosenamateur“ mit
Betonung des Funkbetriebs. Der verkam dabei merklich zum „Herumgequatsche“,
wozu Relaisfunkstellen und die erwähnte Liberalisierung beitrugen. Inzwischen
ist es zudem durch „Kreuzchenprüfung“ und Auswendiglernen möglich,
eine Amateurfunkprüfung zu bestehen, ohne beide Kategorien des Stoffes
verinnerlicht zu haben.
So sieht nun der Newcomer den Amateurfunk anscheinend gern als (ver-
meintlich) billigen Telefon-Ersatz − und unser kommunikativ gepolter Eleve
fragt sich, wozu eine immer noch komplizierte Prüfung ablegen, wenn er doch
per Telefon, Internet, e-Mail und Newsgroups ebenfalls weltweit kommuni-
zieren kann, mit Handy sogar über Funk? Recht hat er. Wenn es ihm einzig um
störungsfreies Geplauder, Kommunikation genannt, geht, sollte er vielleicht
wirklich einfach zu Telefon oder Tastatur greifen.
Die Entscheidung für den Amateurfunk könnte man heute dort festmachen, wo
er anders ist als die moderne kommunikative Konkurrenz: in der Herausforde-
rung, zum einen im Umgang mit der Technik, zum anderen beim Ausloten
der Grenzen des Medium Funks − gleich, ob als Selbstbauer, beim Erproben
neuer Übertragungstechniken, als QRP-Freak, Contester, DXer, EME- oder
Meteorscatterspezialist oder auch einfach als flotter Telegrafist. Dazu bietet
der Amateurfunk Team-Erlebnisse wie einen Feldtag oder den Kick beim
Punktesammeln in Contesten, beim DXen oder dem Diplomerwerb.
Schön wäre es, wenn der Geprüfte irgendwie erkennbar machen müßte,
daß er vom HF-Bazillus befallen ist, wie man das früher nannte. Eine solche
Infektion äußert sich zum Beispiel (beim UKW-Amateur) dadurch, daß er
jeden Berg weniger nach seiner schönen Aussicht beurteilt, sondern danach,
wie weitreichend man von dort funken könnte − oder daß der Konstrukteur
danach giepert, daß das selbstgebaute Gerät endlich spielt.
Wer zumindest Anzeichen dieser Krankheit bei sich diagnostiziert, ist wohl
Funkamateur − oder sollte bald einer werden!
Mit besten 73!
Bernd Petermann, DJ1TO
Jokes mit Hoax
Einen eigenen Internet-Anschluß zu besitzen gehört heute schon beinahe
zum guten Ton. Der Traffic auf den Datenleitungen wird immer größer. Und
so nimmt es nicht wunder, daß auch in der Redaktion das Aufkommen an
einlaufenden E-Mails ständig zunimmt. Anfragen, Online-Bestellungen,
Manuskripteinsendungen, Leserbriefe.
Apropos Leserbriefe: Fast wöchentlich erreichen sie uns seit kurzem in
schöner Regelmäßigkeit − Online-Warnungen besorgter Leser, die uns
auf neue, „hochgefährliche E-Mail-Viren“ aufmerksam machen. Das ist
durchaus lobenswert und zeigt, wie engagiert sich unsere Leser mit dem
FUNKAMATEUR verbunden fühlen. Da wird der Redaktion z. B. geraten,
auf keinen Fall bestimmte E-Mails, wenn sie denn eintreffen sollten, zu
öffnen, die im Subject beispielsweise „Win A Holiday“ oder ähnliches
enthalten. Anderenfalls würde beim Öffnen diese E-Mail einen bösen,
bösen Virus freilassen, der ganz schlimme Sachen auf dem Computer
anrichten könnte.
Nun, so nett und fürsorglich diese „Informationen“ auch gemeint sind,
meistens hat irgend jemand vielen gutgläubigen Online-Nutzern damit
einen Bären aufgebunden, den diese dann bereitwillig weiterleiten.
Doch es kann Entwarnung gegeben werden. In den meisten Fällen
handelt es sich dabei nämlich um sogenannte „Hoaxes“, was aus dem
Englischen kommt und soviel wie Schwindel, Betrug, Schabernack heißt.
Jokes sozusagen. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt.
Natürlich sollte man Viruswarnungen sicherlich nicht generell als nichtig
abtun, schließlich sind bereits seit längerer Zeit tatsächlich Viren bekannt
geworden und im Umlauf, die sich als Datei-Attachment von E-Mails oder
sogar als Makros von Textverarbeitungssystemen verbreiten, doch wäre
allgemeine Panikmache an dieser Stelle nicht angebracht.
Inzwischen haben auch bereits einige kurze Meldungen in Tageszeitungen
auf das sich offenbar häufende Problem falscher Viruswarnungen auf-
merksam gemacht, und es gibt sogar im Internet einen entsprechenden
Online-Informations-Service der TU Berlin, welcher unter http://www.
tu-berlin.de/www/software/hoax.html erreichbar ist. Dort werden die
Situation erläutert, erklärt, wie man sich beim Eintreffen solcher war-
nenden E-Mails am besten verhält und auch jüngste Beispiele vorge-
stellt. Der Autor vertritt die Auffassung, daß alle diese Warnungen
keinen ernstzunehmenden Hintergrund haben, sondern es sich vielmehr
um ein soziologisches Phänomen handle.
„Verstehen Sie Spaß“ auf online sozusagen? Oder steckt doch mehr
dahinter? Will man uns etwa die Zeit stehlen, obwohl man doch gerade
jetzt mit Euro-Umstellung und „Jahr-2000-Problem“ schon genug
ernsthafte Arbeit mit dem Rechner zu bewältigen hat? Seien Sie auf
jeden Fall wachsam. Aber glauben Sie auch nicht alles. Und wenn Sie
immer schön Backups Ihrer wichtigen Daten und Programme ziehen,
wird auch der gemeinste Plattenputzer-Virus zwar zum lästigen
System-Eindringling, ist aber letztlich für Sie unter „hoax“ zu verbuchen.
Ein gesundes, erfolgreiches und virenfreies 1999 wünscht Ihnen allen
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Zwei Extreme
Die Amateurfunkverbände, durchaus gestützt durch eine Mehrzahl ihrer
Mitglieder, vorwiegend solcher, die ihre einschlägige Prüfung bereits
hinter sich haben, wollen den Zugang zur Kurzwelle auch weiterhin von
Morsekenntnissen abhängig machen, wie u. a. die jüngste IARU-Region-
2-Konferenz bewies. Vorwiegend Anwärter und Inhaber einer telegrafie-
freien Lizenz für die UKW-Bänder finden dagegen viele Argumente, daß
diese Betriebsart ja nicht mehr zeitgemäß sei und drängen, ihnen den
Zugang ohne dieses Hindernis zu gewähren, wobei sie die Daseinsbe-
rechtigung einräumen.
Ich glaube, daß die CW-Hürde, ob es mir zusagt oder nicht, irgendwann
fallen wird − wobei mein Standpunkt sich verändert, wenn ich mich in
einen Außenstehenden zu versetzen suche. Doch was kommt danach?
Und auch: Was geschieht bis dahin? Wie kann man diesen Aspekt
unseres Hobbys davor bewahren, an den Rand gedrängt zu werden?
Der beste Ersatz für den Telegrafienachweis ist meiner Meinung nach
übrigens eine umfassende Betriebstechnikprüfung, was auch dem
Ham-Spirit wieder etwas auf die Sprünge helfen könnte.
Der Internationale Fernmeldevertrag fordert für den Kurzwellenzugang
den Nachweis von Morsekenntnissen, u. a., um andere Funkdienste
identifizieren zu können. Daran wird sich zumindest bis zur WARC 2002
nichts ändern, eine Umsetzung in nationales Recht beansprucht ggf.
weitere Zeit. In einigen nationalen Amateurfunkverbänden denkt man
derweil darüber nach, ob, man nicht wenigstens das Prüfungstempo
generell auf etwa 30 ZpM verringern sollte.
Als ich das erste Mal von einem anders gelagerten Vorschlag des
US-Verbandes ARRL hörte, vergewisserte ich mich zunächst, ob es
damit auch seine Richtigkeit hat. Doch wahrhaftig: Am 24. Oktober regte
das ARRL Board of Directors an, den Technicians (UKW-Lizenzen) ohne
weitere Prüfung den KW-Zugang auf den gegenwärtigen CW-Segmenten
der General Class auf den Bändern 10 bis 80 m zu gewähren – allerdings
auch nur in CW!
Denkansatz: Wer sich zutraut, in Telegrafie im Äther zu erscheinen, wird
sie wohl auch einigermaßen beherrschen. Damit würde man zugleich der
Forderung der Vollzugsordnung Funk gerecht; der Funkamateur bewiese
durch sein Tun ja das Vermögen, CW zu lesen und zu senden. Fehlt nur
der Nachweis durch eine staatliche Prüfung.
Der Gegenpol ist unsere RegTP. Sie vermutet bei Ungeprüften, daß ihre
Zeichen nicht lesbar und folglich die Geber durch die Kontrollinstanzen
auch nicht identifizierbar sein könnten, was der Vollzugsordnung zuwider-
liefe. Und wurde in der gegenwärtigen Gesetzeslage auch das CW-Fenster
für die UKW-Klassen im Bereich 144,125 bis 144,150 MHz geschlossen;
die Klassen 2 und 3 dürfen nicht in CW senden (CW-Kennungen automa-
tischer Stationen sind nicht betroffen). Doch ist man erfreulicherweise
dabei, diese harte Position zu überdenken. Schließlich prüft ja auch nie-
mand die praktische Beherrschung anderer Betriebsarten wie RTTY usw.
Ich meine, daß die ARRL-Position einen interessanten Ansatz darstellt, den
Bestand der Telegrafie zu fördern. Die meisten CWisten werden bestätigen,
daß der Appetit auch gerade hier beim Essen kommt! Und auf den UKW-
Bändern sollte nun wirklich jeder Funkamateur die Taste rühren dürfen −
oder gab es bisher tatsächlich negative Erfahrungen?
Mit besten 73!
Bernd Petermann, DJ1TO
Amateurfunk: die bessere Kommunikation
Sie kennen die Situation: Sie werden unterwegs auf Ihr Funkgerät an-
gesprochen, berichten dem scheinbar Interessierten von weltweiter
Kommunikation, Technik und Freundschaft. Daraufhin zückt dieser
Handy-Mann sein Mobiltelefon und grinst nur noch: „Dann bestell doch
mal ’ne Pizza!“ Da könnte man in die Luft gehen…
…oder aber in den nächsten Laden, zumal auch am OV-Abend immer
mehr dieser Kommunikations-Wunderkästchen auf den Tisch gelegt
werden.
Nach der Solvenz-Prüfung und dem Ausfüllen umfangreicher Formulare
(Frage 17: Sind Sie geboren? j/n) gibt es dann schon für nur 9,95 DM
das neueste Spielzeug (Meeensch − mein letztes Handfunkgerät XYZ-3000
hat 995 Mark gekostet!).
Meistens kommt dann mit der ersten Rechnung die böse Überraschung;
die blieb bei mir aus, denn wen sollte ich schon viel anrufen? Sie kam
dann aber etwas später: Das edle Stück ging nämlich entzwei, und das
kurz vor einer Reise. Macht nichts − wir haben ja den 24-Stunden-Aus-
tauschservice innerhalb der zweijährigen Garantie.
1. Schlag: 24 Stunden ist nicht: Mindestens drei Tage sind angesagt, also
Reise ohne Handy.
2. Schlag: Der Hersteller verweigert die Garantiereparatur, weil das Gerät
(gekauft vor 10 Monaten) über 2 Jahre alt wäre. Da gab es das Modell wohl
noch gar nicht, aber das interessiert niemanden. Laut Service-Provider gab
es solch einen Fall noch nie, man wolle sich erkundigen.
3. Schlag: Das Licht am Ende des Tunnels verblaßt. Der letzte und größte
Zauber, ein dezenter Hinweis auf die Macht der Presse, gemeinhin auch
als vierte Gewalt im Staat bezeichnet − auch er muß vor dem allgemein-
gültigen Prinzip kapitulieren: „Das haben wir ja schon immer so gemacht.“
Also weder Rückerstattung der Grundgebühr noch Entschädigung für Nut-
zungsausfall, vor allem aber auch keine Beschleunigung der Reparatur.
Und: „Genaugenommen, Herr Flechtner, sind Sie doch an allem selbst
schuld.“ Wie wahr, schließlich habe ich ein Mobiltelefon gekauft, Schuld
genug.
Nun bin ich die vierte Woche ohne Handy und genieße die Freiheit, nehme
mein Amateur-Handfunkgerät (altmodisch-analog, garantiert GSM-frei)
auf Wanderungen mit und freue mich über die herbstlichen Ausbreitungs-
bedingungen. Das macht direkt wieder Spaß! Außerdem weiß ich, daß
bei einem Defekt am Funkgerät a) noch weitere Geräte im Schrank
stehen, b) ich es wahrscheinlich selbst reparieren könnte, und wenn alle
Stricke reißen, mir c) mein freundlicher Amateurfunkhändler oder auch
ein OV-Kollege ein Gerät leihen würde. Das ist nämlich der vielgerühmte
Ham-Spirit, der Pizza-bestellfähigen Geräten einfach abgeht.
Übrigens: Versuchen Sie nicht, mich in den nächsten Wochen per Handy
zu erreichen − vielleicht probieren Sie es lieber auf der 145,525 ...
Beste 73
Ulrich Flechtner, DG1NEJ
Der Führerschein des Funkamateurs
Jedem Kraftfahrer ist die Fahrschulzeit wohl noch in guter (?) Erinnerung.
Ein Paket Theorie durfte gelernt werden, Erste-Hilfe-Kurse waren Pflicht.
Diesen Übungen folgte die Praxis. Wohl dem, der als Beifahrer (oder auch
als nicht Gehweg-fahrender Biker) erste Eindrücke im Straßenverkehr
sammeln konnte. Anfahren, überholen, rückwärts einparken und derlei
Notwendigkeiten kann man zwar am Computer simulieren; in der Praxis
sitzt man aber in einem zunächst noch eigenwillig reagierenden Blech-
gehäuse. Gleichzeitig gilt es, den fließenden Verkehr zu beachten. Und
dazu noch die nervenden Hinweise/Belehrungen des Fahrschullehrers!
Erst nach Bestehen sowohl der theoretischen als auch der praktischen
Bestandteile der Prüfung, und immer vorausgesetzt, man ist gesundheit-
lich dazu in der Lage, läßt einen die Administration auf die anderen
Verkehrsteilnehmer los.
Stellen Sie sich vor, diese praktischen Übungen würden Sie ohne unmittel-
bare Anleitung und Hilfe durch den Fahrschullehrer absolvieren dürfen
oder müssen. Welche Versicherung würde den entstehenden Schaden
regulieren? Von den Folgen für Mensch und Tier gar nicht zu reden.
Bei der Vorbereitung auf die Teilnahme am internationalen Amateurfunk-
verkehr hat es der Eleve viel leichter. Er lernt die Antworten auf die
Prüfungsfragen mehr oder weniger auswendig, der Lehrer erläutert das
Verhalten im praktischen Funkverkehr, und nach bestandener Prüfung
erhält er seinen „Führerschein“.
Fragt der Autofahrer zu Recht: Wo ist die praktische Unterweisung geblie-
ben? Oder kann man im Amateurfunk nicht kollidieren? Die Ergebnisse
der lediglich theoretischen Unterweisung erlebt man in der Praxis auf den
Amateurfunkbändern. Hier lernt man Parken, Anfahren usw. von Anfang
an im „fließenden“ Verkehr. Mit viel Unkenntnis oder auch oft mit Arroganz
werden die anderen Teilnehmer gestört oder behindert. Im Gegensatz zum
Straßenverkehr bekommt der eigene Transceiver ja keine Beulen, die
Antenne wird (leider) nicht abgerissen usw. Außerdem trägt die störende
Aussendung oft genug keine Kennzeichentafel, bleibt anonym!
Wenn man sich Gedanken über die Amateurfunkprüfung macht, so ist
das löblich; leider fehlt dann immer noch die Unterweisung in der
Praxis für die Praxis, wahrscheinlich beim Trend zu Fragebogen auch
leider kaum durchsetzbar. Äußerst positiv ist insofern der Betrieb mit
Ausbildungsrufzeichen zu bewerten. Vielleicht vervollkommnet er
den Umgang miteinander auf den Amateurfunkbändern doch etwas.
Auch aus den Erfahrungen als SWL und mit der doch etwas anderen
Betriebstechnik als QRPer kann man später seine Kilowatt-PA
gemeinschaftsschonend einsetzen und betreiben. Gegenseitige Rück-
sichtnahme ist sowohl im Straßenverkehr als auch im Amateurfunk
erlernbar. Der eine lernt das unter Aufsicht, der andere kann es lernen.
Hoffen wir, daß es der andere auch wirklich will.
PS: Wenn es denn einmal keine CW-Hürde für den KW-Zugang mehr gibt;
warum nicht spätestens dann mehr Betriebstechnik prüfen?
vy 73
Max Perner, DL7UMO
Wunsch und Wirklichkeit
Rettung naht. Da plagte man sich die ganzen Jahre, sein PC-System mit
Windows 95 halbwegs stabil zum Laufen zu bekommen − so richtig hat das
alles trotzdem nie funktioniert. Wie oft wurden Anwendungen wegen „un-
gültiger Seiten im Modul xyz…“ geschlossen, oder der inzwischen berühmte
„Blue Screen“ machte uns auf das Auftreten „schwerer Ausnahmefehler“
aufmerksam.
Doch nun kommt ja endlich das neue Windows 98 und mit ihm die Hoffnung,
daß derartige Kinderkrankheiten womöglich überwunden sind…
Die Ernüchterung setzt schlagartig ein. Hatte man schon unter dem Vor-
gängermodell keine Freude, so will dieselbe auch mit den neuen Fenstern
nicht aufkommen. Da erblickt nicht etwa ein komplett in sich geschlossenes
und (so der innige Wunsch) unerschütterlich funktionierendes Betriebssystem
das Licht der Welt − nein, all der alte, in den jungen Win95-Jahren angesam-
melte Treibermüll und ähnliche, sich in den Tiefen des Systemlaufwerks
auf Trebe befindlichen, seit langem vergessenen Linkbibliotheken usw.
werden bei der Überinstallation neuen programmatischen Ehren zugeführt.
Das Ergebnis: Lief schon Windows 95 besch…, so bringt das 98er Dingsda
nun erst recht nicht die Punkte.
Der Hardware-Sektor geht auch vom Wunsche nach immer leistungsfähigerer
Peripherie aus. PC-Motherboards der neuesten Generation warten nun längst
mit AGP- und USB-Unterstützung auf. Die Werbebranche hat’s erkannt.
Das isses. Das Nonplusultra-Verkaufsargument. Zumindest zukunftssicher.
Die Realität sieht aber etwas magerer aus. Noch gibt es kaum in Fülle die
Auswahl an Flachbettscannern, Druckern, Streamern oder CD-Brennern,
bei denen „Plug and Play mit USB“ den Anwenderkunden zum König und
bei neuen Geräte-Installationen „alles easy“ macht.
Manchmal, so will es einem scheinen, geht die Schere zwischen Wunsch und
Wirklichkeit aber nicht deswegen auseinander, weil noch zu wenig Hersteller
mit neuen Geräten „nachgezogen“ haben, sondern einfach des schnöden
Mammons wegen. Muß man zumindest annehmen. Denn es ist doch ein
Unding, wenn beispielsweise Softwareprogramme die Daten ihrer eigenen
Vorgängerversionen nicht mehr verstehen − siehe Winword 2 vs. Word97
oder Corl Draw 6 vs. Corel Draw 8, um nur zwei Kandidaten zu nennen …
Bestandsschutz vs. Kommerz?
Aber so ist das eben mit dem technischen Fortschritt: „Alles fließt.“ Hieß
gestern das Zauberwort schneller Datenübertragungsraten noch ISDN, so
bringt heute schon ADSL die bisherige Analogwelt auf Trab.
Kreiert man heute eine Elektronik-Bauanleitung, so weiß man nie, ob die
Innovationszyklen der eingesetzten Chips nicht so kurz sind, daß sie, kaum
eingelötet, wieder vom Markt sind. Und das Schöne daran: Nachfolgemodelle
werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit immer ein klein
wenig anders funktionieren …
Und vom 26. bis 30. August ist wieder CeBIT-Home-Time. Vor zwei Jahren
ausgegliedert aus der „traditionellen“ CeBIT-Computermesse, scheint sich
auch hier zwischen Wunsch und Wirklichkeit ein Graben aufzutun. Mit dem
Fernbleiben eines Großteils der etablierten Unterhaltungselektronik-Anbieter,
die ihre Novitäten bereits im März auf der „großen“ CeBIT ausgestellt
haben, wird der Schwerpunkt diesmal wahrscheinlich ausschließlich auf
dem „Spiele-Software“-Sektor liegen.
Na, mal abwarten. Wir werden uns auf jeden Fall auch wieder in Hannover
umsehen.
In diesem Sinne. Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Wird der Äther vogelfrei?
„ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) heißt das Zauberwort, das dem
Internet Flügel verleihen und die Benutzer von ihren Leiden befreien soll. Das
Übertragungsverfahren macht sich einen Umstand zunutze, dem bisher wenig
Beachtung geschenkt wurde: Von der eigentlichen Kapazität der Kupferkabel
der Telekom wird nicht einmal 1 % für die Sprachübertragung genutzt, mehr
als 99 % liegen brach.“
Und weiter: „Der große Vorteil von ADSL: Es ist überall einsetzbar. Zu beinahe
jedem Haushalt und zu jedem Unternehmen führt eine Telefonleitung der Post.
Die hohen Übertragungsraten und der geringe Investitionsaufwand … machen
ADSL für die Telekom-Gesellschaften zu einer wichtigen Zukunftstechnologie.“
So euphorisch das Industriemagazin. Mit dem (abgeschirmten) TV-Kabelnetz
hätte man außerdem nur einen Teil der Bevölkerung erreichen können, mit
ADSL praktisch die gesamte.
Asymmetrisch bezieht sich hier auf die verfügbaren Datenraten; sie sind in
Richtung zum Kunden (bis 8 MBit/s) bedarfsgerecht um ein Mehrfaches
größer als umgekehrt (bis 640 Bit/s).
Das Pendant ist die Datenübertragung über Energieversorgungsleitungen.
Nach der Europanorm 50065 können dafür z. Z. Frequenzen bis 148 kHz
verwendet werden, in Nordamerika und Japan bis 500 kHz. Die Energiever-
sorgungsunternehmen wollen aber zur Überwindung der letzten Meile zum
Kunden gern auch weit höhere Frequenzen nutzen. Zupasse dürfte ihnen dabei
kommen, daß es dafür (noch) keine Norm gibt. In englischen Pilotversuchen
mit HFCPN (high frequency conditioned power network) favorisiert man wegen
der leichteren Trennung von Energie und Information Frequenzen über 1 MHz!
Na, prima. In der Begeisterung über wirtschaftliche Expansionsmöglichkeiten
unterschlägt man dabei ganz einfach, daß eine x-beliebige Leitung mit
steigender Frequenz zunehmend Energie abstrahlt und aufnimmt. Deshalb
schirmte man ja bisher in der Regel jede HF-führende oder -anfällige Leitung
ab, sogar die für die Computer-Peripherie. Die ja eigentlich nur für „NF“
gedachten Telefon- oder Energieleitungen sind dagegen offene Scheunentore.
Also gedenkt man, den gerade auf Energieleitungen unausweichlichen
Störungen durch ausgeklügelte Übertragungsverfahren oder Spreizspektrum
ein Schnippchen zu schlagen. Andererseits dürfte man zu selbigem Behufe
auch einen nicht zu knappen Pegel brauchen.
Wird also der gesamte KW-Bereich zukünftig mit einem Schraps-Teppich
überdeckt, der kaum noch den Empfang der dicksten Rundfunkstationen
erlaubt? Der Äther ein digitaler Sumpf?
Erprobt wird ADSL gegenwärtig in Nürnberg und in einem Feldversuch von
Telekom und Siemens mit 100 Studenten an der Universität Münster.
Außerdem will die Telekom noch in diesem Jahr die ersten Anschlüsse in
Berlin, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt/M., Hamburg, Hannover, Köln,
München und Stuttgart schalten, 1999 sollten bereits 40 Ortsnetze beteiligt
sein, und als Ziel peilt man 80 % aller Haushalte an.
In Leverkusen wollte die RWE-Tochter TelLev mit Powerline die Netzleitungen
nutzen. Etwa 25 % der Verbraucher wären so für RWE und Veba erreichbar.
Wenn Sie also im Bereich eines solchen Versuchs wohnen und unzumutbare
Störungen auftreten, senden Sie unbedingt eine Störungsmeldung an die
Regulierungsbehörde! Außerdem finden sich im Internet diverse Quellen,
teils mit Telefonnummern und e-Mail-Adressen. Fragen Sie dort nach dem
aktiven und passiven Störverhalten und tragen Sie ggf. ebenfalls auftretende
Störungsfälle vor!
Mit besten 73!
Bernd Petermann, DJ1TO
Frust am Tresen
Geht es Ihnen auch so? Sie benötigen für Ihre Controllerprojekte normaler-
weise keine soo exotischen Bauteile, daß man sie nicht irgendwoher be-
kommen könnte. Das komplizierteste Bauteil ist oft der Controller selbst.
Den Rest erwartet man eigentlich im gutsortierten Elektronikfachhandel
vorzufinden.
Spätestens am Bauteiletresen des bisherigen Händlers Ihres Vertrauens
personifiziert sich dann die Ernüchterung. Entweder ist das eine Bauteil nicht
da, oder zur Zeit sind wieder mal nur fünf der geforderten zehn lächerlichen
CMOS-Steine am Lager. Und die TTL-Flip-Flops kommen erst wieder zur
Jahrtausendwende herein − bravo.
Der moderne Elektronikmarkt weitet seine Produktpalette erheblich aus.
Nein, nein: Nicht die Bevorratung mit üblichen Bauteilen ist gemeint,
sondern Fahrradzubehör, Gartenschläuche und Christbaumschmuck sind
angesagt. Gelegentlich kann ich kaum den Wunsch unterdrücken, besagten
Ex-Bauteiletresen mit einem in Amerika und neuerdings bei Jugendbanden
beliebten Sportgerät zu zerlegen und dem Verkäufer seine Weihnachtslichter-
ketten, Fahrradluftpumpen und was der Elektronikfachmarkt heutzutage
sonst noch bietet, in eine beliebige Körperöffnung seiner Wahl zu stecken −
ähmm, sorry.
Auch die Qualität der „Fachverkäufer“ ist gelegentlich beeindruckend.
Warum suchen sich Unternehmen immer häufiger Mitarbeiter für den
Verkauf, die vorher schon kaum in der Lage waren, bei Kaufstadt Bonbons
an den Mann bzw. die Frau zu bringen? Nichts gegen Kaufstadt und schon
gar nichts gegen Süßwaren. Aber im Elektronikmarkt erwarte ich Personal,
das wenigstens ungefähr weiß, was es da eigentlich verkauft.
Gut, es kommt auch vor, daß dem einen oder anderen Verkäufer bekannt
ist, daß nicht jedes schwarze Bauelement mit drei Füßen zwangsläufig ein
Spannungsregler sein muß. Der Fachmarkt schadet sich in letzter Konsequenz
selbst. Der notgedrungen zum Elektronikversand abwandernde Elektronik-
freak entzieht dem Fachhandel das Kapital, der Fachhandel reduziert sein
fachspezifisches Angebot, und so schließt sich der Kreis.
Die Versender sind sich dieser Situation bewußt und kämpfen mit knallharten
Preisen um Kunden. Oft sind auch technische Hotlines für Kunden eingerichtet,
und man staunt: Der Service ist vielfach mit richtigen Technikern
besetzt, die ihr Handwerk auch beherrschen − zumindest e i n Lichtblick.
Das Drama nimmt gewaltige Dimensionen an, wenn Sie Bauteile benötigen,
die vielleicht etwas aus der Rolle fallen, aber eigentlich durchaus gängig
sind. Die Palette der Ärgernisse reicht von teilweise für den Privatbereich
absurden Abnahmemengen bis zu peinlichsten Lieferzeiten. Was soll das?
Beim Tante-Emma-Laden um die Ecke kann ich doch Schokolade auch
tafelweise erstehen und muß nicht gleich eine ganze Europalette voll
leckerem Schokozeug nach Hause schleppen.
Nun komme mir keiner mit: „Wo wenig Nachfrage besteht, ist auch das
Angebot gering.“ Pah! Tamagotschis wollte auch keiner − bis den Japanern
gesagt wurde, daß sie ihr Gesicht verlieren, wenn sie nicht mindestens vier
davon besitzen.
Für rechte Rücklichter eines alten Honda Civic besteht auch keine große
Nachfrage. Trotzdem bekomme ich aber bei jedem Kfz-Zubehörhandel
eines … und nicht mindestens fünf!
Ihr
Fred Ziebell
Press any key…
Würden Sie sich ein Auto kaufen, bei dem alle paar Minuten die Fehler-
lampe blinkt: „ Allgemeine Schutzverletzung im Modul: „ZÜNDUNG.EXE“,
gefolgt von einem Totalstillstand mit arretierter Zentralverriegelung, und
zwar von innen?
Würden Sie es akzeptieren, wenn Ihnen der Autohändler das Modell V1.0
verkauft und Sie erst während der Fahrt feststellen, daß die (im Prospekt
ausgewiesene) Bremse gar nicht existiert? Und wenn Ihnen − gesetzt den
Fall, Sie kommen trotzdem heil ans Ziel − bei der Reklamation dann gesagt
wird, daß dieser „Bug“ zwar bekannt sei, Sie aber ein (selbstverständlich
kostenpflichtiges) Update auf das Modell V1.1 bekommen könnten, wo
die Bremse dann auch tatsächlich eingebaut ist, dafür aber die Wind-
schutzscheibe fehlt?
Nein, das würden Sie nicht akzeptieren? Warum denn bloß nicht?
Bei Microsofts Fenster-Betriebssystem tun Sie’s doch auch!
An MS Windows kommt ein Rechnernutzer heute kaum mehr vorbei. Auf
fast allen PCs ist Gates’ Quasi-Standard schon beim Kauf vorinstalliert.
Doch: Was sich in der Industrie, im Handwerk oder sonstwo niemand
trauen würde, scheinen sich Billys Mannen wie selbstverständlich heraus-
zunehmen, nämlich ihrer Klientel ein Betriebssystem mit inzwischen-
schon berühmt-berüchtigten Schutzverletzungen und Fehlermeldungen
zu verkaufen. Na ja, wozu hat man schließlich eine Monopolstellung …
Und wir schlucken das seltsamerweise alle ohne Murren. Keine Firma,
die auf sich hält, kann mit fehleranfälligen Produkten auf Dauer am
Markt bestehen. Da würden wir garantiert auf kostenlose Nachbesserung
pochen. Warum nicht auch bei Microsoft?!
Wenn sich bei einer Präsentation ein mit viel Werbeaufwand vorgestelltes
Produkt ’98 plötzlich direkt vor den Augen seines Großmoguls ins Daten-
Nirvana verabschiedet, dann erahnen wir schon, was uns mit der nächsten
Version von Windows erwarten wird.
Übrigens werden selbst die Ausschriften der Fehlermeldungen immer kryp-
tischer („Fehler $2001 an Adresse ab:cd aufgetreten“, „Ungültige Seite
im Modul xyz.dll“). Schließlich könnte ja der unbefangene Anwender sonst
auf den naheliegenden Gedanken kommen, daß ein Fehler mit klar defi-
nierter Ausschrift erst gar nicht auftreten müßte, wenn die Entwickler bei
Eintreten genau dieses Falles eine entsprechende Behandlungsroutine
implementiert hätten. Eine solche Meldung wäre dann hinfällig und der User
zufrieden. Hofft man etwa, durch möglichst unverständliche und verschlüs-
selte Fehlermeldungen irgendwelchen Rechtsansprüchen auf Produkthaftung
zu entgehen?
Da helfen wohl auch keine Sahnetorten im Gesicht. Vielleicht muß Bill Gates
erst per Flieger unterwegs sein, wenn auf dem Cockpit-Monitor die Meldung
erscheint: „Triebwerk verursachte eine allgemeine Schutzverletzung bei
Adresse: 08:15. Anwendung wird geschlossen.Wünschen Sie Details?“
Ob das dann noch nötig ist? Press any key to continue or any key to exit. ;-)
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Murphy und das wichtigste Bauelement
Irgendwann hatte der Selbstbau-Freak wieder eine Idee. Das Projekt sollte
klein und billig sein und deshalb moderne Bauelementen enthalten. Aus
diversen Unterlagen und Katalogen sucht sich nun unser Freak die Bauele-
mente aus, darunter auch das Herz des Ganzen, erfahrungsgemäß einen
höherintegrierten Schaltkreis, der die zu erfüllenden Aufgaben und gleich
noch ein paar mehr preisgünstig mit wenigen externen Bauelementen
erledigt. Für das Unikat wählt er die DIL-Ausführung, weil SMD das Ein-
und gar Auslöten aus dem Musteraufbau (oder aus mehreren) erheblich
komplizieren würde.
Anfragen beim wirklich kompetenten Fachhändler ergeben, daß unser wich-
tigstes Bauelement am Lager ist, den eigenen preislichen Vorstellungen
entspricht und vor allem weiterhin lieferbar ist. Also Kauf des Bauelements,
Musterplatine entwerfen, testen und korrigieren, Platine in der Endausfüh-
rung entwerfen, ätzen, bestücken und abgleichen. Freude über das Erfolgs-
erlebnis.
Da die Redaktion immer Bedarf an Selbstbauobjekten hat, fragt unser
Freak dort nach. Im positiven Fall wird das Objekt nochmals getestet und
gemessen, das Platinenlayout den Erfordernissen der redaktionellen
Bearbeitung angepaßt, ein Manuskript geschrieben. Da die Redaktion für
die Leser auch ein Foto des Objektes haben möchte, bemüht der Freak
seinen Fotoapparat und den Entwicklungsservice. Das alles braucht Zeit,
zumal der Freak nur eine 24-Stunden-Uhr hat.
Bekannt sein dürfte zudem, daß die Redaktion nicht nur einen zeitlichen
Vorlauf für die jeweils nächste Ausgabe benötigt, sondern außerdem über
einen gewissen Beitragsvorrat verfügt und bestimmte Vorstellungen betreffs
der Zusammensetzung einer Ausgabe hegt, was eine sofortige Veröffentlichung
oft genug in Frage stellt. So können zwischen Kauf des wichtigsten Bauele-
ments und dem Zeitpunkt der Veröffentlichung schon Monate ins Land gehen.
Danach wollen nun, so das Objekt attraktiv genug war, viele Leser besagten
Schaltkreis beim Fachhändler erwerben. Also ist dessen Lagerbestand in
kurzer Zeit aufgebraucht. Nachbestellung ausgelöst, Rückinfo: Bauelement
wird nicht mehr produziert. Was nun? Mit viel Glück kann es aber als
SMD-Variante geliefert werden. Nun stehen Leser, Freak und auch die
Redaktion im Regen. Vor allem der Freak ärgert sich, denn im Internet
als wohl aktuellste Quelle wurde das Bauelement nicht „abgekündigt“.
Bei Bauelementen wie dem PIC 16C84 stürzt dabei die Welt nicht ein, bei
anderen dagegen ist der Nachbau des Objekts nun gestorben. Wohl dem,
der wenigstens noch keine Leiterplatte angefertigt hatte. Oder haben Sie
schon einmal die SMD-Variante eines IC auf ein DIL-Layout gebracht?
Selbst wenn der Freak das Projekt in ein neues Objekt (neue Bauelemente,
neues Layout usw.) umwandelt, wird es die Redaktion selten in der übernächsten
Ausgabe erneut vorstellen.
Der geschilderte Vorgang kann sich leider beliebig oft wiederholen. Die
Industrie stellt spezielle Schaltkreise eben kaum über Jahre hinweg her.
Auch die im Internet verfügbaren Daten werden von Menschen eingegeben.
Irren und vergessen ist menschlich.Ergo: Schießen Sie bitte nicht auf den
Pianisten oder so ähnlich, denn der hat es nicht verdient. Oder bauen Sie
mit Transistoren, da findet sich (fast) immer ein Austauschtyp.
Mit besten 73!
Max Perner, DL7UMO
Nicht totzukriegen
Fürs erste sind die Würfel wieder einmal zugunsten der Telegrafie als
Prüfungsvoraussetzug für eine Kurzwellen-Amateurfunkgenehmigung
gefallen. Das BMPT hielt sich damit an die gültigen Bestimmungen
der ITU. Und auch die werden wohl, wie es aussieht, noch wenigstens
vier Jahre Bestand haben, denn nachdem zunächst bei der kommenden
Funkverwaltungskonferenz im Jahr 2000 darüber neu befunden werden
sollte, hat man diesen Punkt wegen der nicht zu bewältigenden Tages-
ordnung auf die nächste Konferenz 2002 verschoben.
Also wird es wohl auch hierzulande zumindest bis zu diesem Jahr bei
Tempo 60 ZpM für die Zeugnisklasse 1 und damit dem KW-Zugang
schlechthin bleiben. Eigentlich schade, daß der Einstieg über die
bisherige Genehmigungsklasse A und Tempo 30 dann nicht mehr
möglich ist; diejenigen, die noch vor dem 1. Mai durchs geschenkte
„Updating“ mit einer A-Prüfung den kurzen Sprung zur Klasse 1 schaffen
wollen, müssen sich nun sputen.
Andererseits war Tempo 30 ja ohnehin eher ein Alibi für die Fone-Privi-
legien als ein Einstieg in das reale Telegrafiegeschehen auf den Bändern.
Selbst mit Tempo 60 sieht man über weite Bereiche der Telegrafiebänder
eher alt aus. Insofern ist nicht so ganz zu verstehen, weshalb man sich bei
der IARU nicht auf die Festlegung von Low-Speed-Vorzugsfrequenzen ei-
nigen konnte. Die in verschieden Ländern gültigen Novice-Subbänder
sind kein Ersatz dafür. Vielleicht wollte man auch nur Diskussionen à la
„hier darf keiner schneller als 40 geben“ entrinnen.
Unabhängig von erfreulicherweise ja doch zumeist honorierten QRS-
Wünschen hielte ich CW-Anfängerfrequenzen durchaus für sinnvoll − nicht
etwa exklusiv, aber als favorisierte Treffpunkte für Einsteiger. Die CW-
Interessengruppen könnten hier sicher Lorbeeren ernten, indem sie nach
gegenseitiger Absprache Vorschläge machen und sie vor allem auch
wiederholt popularisieren.
Denn wer Telegrafie beherrscht, hat damit sicher kein modernes, jedoch
ein traditionsreiches Übertragungsverfahren im Griff, zwar keine zeitgemäße
Übertragungsrate, aber eine recht störsichere Übermittlung. Vermutlich
geht es an der Grasnarbe mit Pactor & Co. ebenso oder besser, aber ein
Telegrafiekontakt bietet noch hautnahen Kontakt mit dem Übertragungs-
medium Funk, während bei den „echt“ digitalen Verfahren die Entfremdung
doch schon weit gediehen ist.
Und nicht zuletzt, Morsetelegrafie bietet ein Feeling wie keine andere
Betriebsart, macht Spaß. Im Pile-Up läßt sich viel besser differenzieren
und, und, und …
Erfreulicherweise sind die neuen Prüfungsbedingungen auf diesem Gebiet
auch deutlich praxisnäher geworden: Schließlich kommt es im persönlichen
Amateurfunkkontakt nicht unbedingt darauf an, jedes Zeichen exakt
mitzuschreiben. So ist eine größere Fehlerzahl zulässig, es handelt sich
um Amateurfunktext, und die Handtastenpflicht ist endlich gefallen –
wer gibt denn heute noch so?
Also, geben Sie sich einen Ruck, wenn man’s erstmal kann, hat die
„Nostalgie“ durchaus freundliche Züge! Und es gibt so viele komfortable
Computerprogramme zum Üben …
Mit besten 73!
Bernd Petermann, DJ1TO
Neues von der I&T-Front
Seit Anfang Januar ist mit der Öffnung des Telefonmarktes in Deutschland
auch ein Dschungel an sich gegenseitig unterbietenden Tarifmodellen ent-
standen, mit dem die neuen Anbieter ihren Kampf um Marktanteile austra-
gen. Näheres dazu, was Sie wo und wann sparen können, finden Sie auch
in dieser Ausgabe des FUNKAMATEUR.
Bei cleverer Wahl des jeweils zur richtigen Tages- oder Nachtzeit unter
Beachtung dieses Hakens und unter besonderer Berücksichtigung jener
Option günstigsten Anbieters fürs Telefoniervergnügen läßt sich sicher
so manche Mark sparen, und auch das Surfen im Internet oder das
Online-Wühlen in diversen Mailboxen wird billiger.
Apropos Mailboxen: Ihr altes 2.4er-Modem wollen Sie noch nicht verschrot-
ten und haben deshalb Frust mit langen Downloadzeiten? Die FUNKAMATEUR-
Mailbox gibt’s jetzt auch auf CD-ROM. Zum gemütlichen Offline-Surfen für
zwischendurch. Läuft unter DOS, Win 3.x und Windows ’95.
Ach ja, im Sommer soll es fertig sein, das neue Windows ’98, mit dem uns
Microsoft als PC-Benutzer zukünftig beglücken will. Wenn alles so läuft
wie immer, denke ich, daß es zumindest für den deutschen Markt wahr-
scheinlich zu einem Win99 oder Win2000 mutieren wird.
Als leidgeprüfter Windows’95-Anwender habe ich aber gerade meine bisher
genutzten Programme so halbwegs stabil zum Laufen gebracht. Bei einem
eventuellen Umstieg erwarten mich dann höchstwahrscheinlich die gleichen
Probleme, nur in verschärfter Form, wieder.
Ich werde aber trotzdem mit dem geplanten PC-Neukauf bis zum Erscheinen
der nächsten Windows-Version warten, denn erstens hat der Händler dann
den Schwarzen Peter mit der Systemeinrichtung, zweitens gibt es für die
Unterstützung der neuen Rechnerstandards AGP (Grafik) oder USB (Periphe-
rie) im Moment kaum eine Alternative als ein darauf abgestimmtes neues
Betriebssystem, und drittens werden wohl demnächst auch die Preise für
(mir noch zu teure) Pentium-Systeme bald eine hübsche Anpassung nach
unten erfahren. Schließlich wartet Intel bereits mit der dritten Generation
seines Pentium II (Codename ,Deschutes‘ auf, 333 MHz schnell und statt
mit 0,35 μm jetzt in 0,25-μm-Technologie produziert, was schnellere Taktung,
bessere Störspannungsabstände, Absenkung der Betriebsspannung und damit
weniger Energieumsatz, sprich Kühlaufwand, bedeutet.
Auch in der Speichertechnologie kommt man offenbar weiter voran.
Jüngsten Gerüchten zufolge soll eine norwegische Firma bereits in der Lage
sein, einen auf Polymerbasis arbeitenden Protein-Massenspeicher mit mehr
als 100 Terabyte in Scheckkartengröße herzustellen, der also den Inhalt von
mehr als 100 000 der heute gängigen 1-Gigabyte-Platten fassen könnte.
Spekulation oder demnächst greifbare Realität? Noch will ich nicht so recht
an diesen Plastik-Superchip glauben, der vom Material her verwandtschaftlich
dem Nylonstrumpf nahesteht ...
Na, auf der nächsten CeBIT, die jetzt wieder ins Haus steht, wird es solche
Sensationen wohl noch nicht zu sehen geben. Hat auch noch Zeit, statt güns-
tiger zu speichern, lernen wir erst einmal alle, preiswerter zu telefonieren.
Ruf doch mal an.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Besorgnis oder Alibi?
Auf Frequenzen bis 50 MHz gelten lt. Verfügung 306 des ex-BMPT (s. S. 196)
dort, wo nicht vom nur vorübergehenden Aufenthalt von Personen ausgegangen
werden muß und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, an denen keine
Ausweichmöglichkeit für Herzschrittmacherträger besteht, nicht nur die
Personenschutz-Feldstärkegrenzwerte nach VDE 0848, Teil 1, sondern die weit
strengeren, im Teil 2 festgelegten für Herzschrittmacher.
Davon darf abweichen, wer Warnschilder „Beeinflussung besonders stör-
empfindlicher Herzschrittmacher möglich“ aufstellt und/oder die Überschreitung
der Grenzwerte in der relevanten Nachbarschaft bekanntgemacht oder gar
entsprechende schriftliche Einverständniserklärungen eingeholt hat.
Nun ergibt z.B. eine Berechnung (BCC, nach Prof. Wiesbeck) für 10 W auf
28 MHz an einer Groundplane bereits einen Sicherheitsabstand von 14 m bzw.
bei 100 W gar 46 m!
Der erfaßte Bereich dürfte selbst beim Eigenheimbesitzer in der Regel die
Grundstücksgrenzen erheblich überschreiten, von der Situation eines
Mietshausbewohners ganz zu schweigen. Ein wahres Horrorszenario für KW-
Funkamateure. Da möchte man nicht das Gesicht des Gebäudeeigentümers
sehen, der besagtes Schild an seiner Hauswand oder im Vorgarten dulden soll
oder auch nur an die Reaktion der lieben Nachbarn, die eine Erklärung unter-
schreiben sollen, die manchen von ihnen bei der hiesigen Elektrosmog-Hysterie
wie die Einwilligung zur körperlichen Mißhandlung erscheinen mag. Jeder
Funkamateur, der je mit BCI oder TVI zu tun hatte, weiß, was ihn da bei seinem
Bittgang erwarten würde.
Nun mag man einräumen: Was sein muß, muß eben sein; Menschenleben und
Gesundheit gehen vor. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß es weltweit keine
vergleichbaren Auflagen gibt, außerdem kein Fall bekannt ist, daß tatsächlich ein
HSM-Träger durch HF zu Schaden kam und die heutige Europanorm für Herz-
schrittmacher EN 50061 A1 eine Resistenz gegen Feldstärken von 300 V/m
verlangt (in den sonst gern als Vorbild gesehenen USA sind es 200 V/m). Die
hier maßgebenden Exemplare stammen von 1988, wobei bezeichnenderweise
keine Auskünfte über konkrete Typen erteilt wurden.
Führende Vertreter des DARC beklagten sich nach Gesprächen im Rahmen der
Vorbereitung der Vfg. 306 über die harte und absolute Kompromißlosigkeit des
BMPT hinsichtlich der Herzschrittmacherthematik, vermutlich entsprechendem
Druck aus Bund und Ländern folgend. Hat hier die Politik, die sich aus popu-
listischen Gründen selbst angesichts Tausender jährlicher Verkehrstoter und
einem Mehrfachen an gesundheitlich Geschädigten nicht zu einem Tempolimit
und mit Mühe und Not zu einer Senkung der Promillegrenze auf 0,5 durchringen
konnte, im Wahljahr etwa nur eine Gelegenheit gesucht, zu zeigen, daß sie sich
ja doch um das Wohl eines jeden sorgt?
Da diverse ernst zu nehmende Untersuchungen zu EMVU-Gefahren eigentlich
nichts Greifbares brachten, hebt man mit den Schrittmachern eine sachlich
eigentlich EMVG-begründete Gefahr aufs Tapet und schafft es dabei unter der
Hand auch gleich noch, das Objekt der recht irrationalen, der von den Medien
aus Quotengründen geschürten Elektrosmog-Angst zu bekämpfen.
Bis zu diesem Punkt sollte des Problem, auch wegen modernerer Schrittmacher,
durchaus noch diskussionsfähig sein. Aber da regt sich ein anderer Argwohn: Seit
längerem ist von geplanten Rückmeldekanälen für die interaktive Medienzukunft
zu hören, die im Kabelnetz große Bereiche der Kurzwelle umfassen sollen − die
wiederholen dann die S-6-Problematik auf der kurzen Welle. Außerdem wollen
nach dem Ende des Telekom-Telefonmonopols die Konkurrenten die „letzte Meile“
zum Kunden u. a. durch digitale Übertragung entlang der Stromkabel überbrücken,
natürlich auch im Kurzwellenbereich. Bei nicht nur mangelhaft, sondern gar nicht
geschirmten Kabeln kann man sich die Wechselwirkungen mit einer KW-Amateur-
funkstelle bequem ausmalen. Vielleicht weht daher der Wind?
Daß hier einiges nicht den internationalen Regelungen und Gepflogenheiten
entspricht, gibt mir neben der leider zeitlich nicht genau definierten Vorläufgkeit
noch Hoffnung.
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Ist der Selbstbau out?
Wir haben es wieder einmal geschafft. Die Feiertage liegen hinter,
ein noch taufrisches Jahr vor uns. Beste Zeit zur Vorausschau,
für das Anpacken von Chancen, neuen Taten, innovativen Ideen.
Auftrieb auch für das Selbstbau-Hobby. Zumindest hatten wir uns
das zu Silvester, 24 Uhr, noch fest vorgenommen.
Was ist also los mit unseren Hobbyelektronikern? Basteln sie noch?
Oder ist das Feld der Selbstbauprojekte schon hoffnungslos
von Industrie und Kommerz besetzt? Vom funkferngesteuerten
Garagentoröffner über das Hörgerät mit Internet-Anschluß bis hin
zum Nässemelder fürs Katzenklo − es scheint nichts zu geben, was
es nicht gibt. High-Tech-Lösungen für alle möglichen Anwendungen
sind für’n Appel und’n Ei verfügbar. Selbst zum Tamagotchi
gibt es seit kurzem als partysüchtige Weichei-Alternative auch
ein Antigotchi.
Schaltungsentwicklung im Labor? Nein, „Cyber-Löten“ − alles wird
virtuell nur noch im PC simuliert. Multimedia macht’s möglich.
Ist der Selbstbau also ultimativ out? Oder gibt es sie noch, die
Nischenprodukte − individuelle Lösungen, für die kein Massenmarkt
existiert, Einsatzgebiete, die aus ganz persönlichen Bedürfnissen
heraus wachsen, Ideen, deren praktische Umsetzung
einfach nur Spaß macht und Selbstbestätigung bringt?
Die technischen Voraussetzungen dafür sind so gut wie nie zuvor.
Jeder Bastler kann mit kleinem Geld heute Selbstbau-Projekte
realisieren, die vor Jahren noch undenkbar oder nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand machbar waren. Sind mehr als drei
Bauteile für die Schaltung erforderlich, setzt man selbstverständlich
einen Mikrocontrollerbaustein ein, wäre ja noch schöner. Elektronische
Defizite gleicht man durch die Logik der „weichen Ware“ aus.
Betrachtet man den einschlägigen Blätterwald, so stehen Bau-
projekte mit PICs und μCs derzeit ja hoch im Kurs. Die schlechte
Nachricht: Ein Prozessor ohne Software ist zwar zu allem fähig,
aber zu nichts zu gebrauchen. Und nicht jeder kann diese Chips
auf Anhieb programmieren.
Die gute Nachricht: Wir starten in diesem Heft einen Crashkurs
zum Umgang mit und zur Programmierung von modernen RISC-
Controllern. Ohne Wenn und Aber. Und ohne vorausgesetztes
Profi-Wissen. Das ist doch mal was, oder? Und vielleicht entdeckt
dann der eine oder die andere wieder den Spaß am kreativen
Entwickeln, an der Eigenbau-Umsetzung von pfiffigen Ideen.
Behalten Sie Ihre Entwürfe nicht in den Schubladen, lassen Sie
uns und alle interessierten FA-Leser daran teilhaben. Gehen wir
gemeinsam mit frischem Wind und interessanten Projekten in
das neue Jahr. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein
erfolgreiches 1998.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Liberalisierung des Telefonmarkts
Am 1.Januar 1998 wird der Telekommunikationsmarkt freigegeben.
Neben der Telekom dürfen dann andere Unternehmen Telefon-
gespräche vermitteln. Ähnlich wie beim Mobilfunk, wo Sie zwischen
D1, D2 und E-Plus wählen können, haben Sie dann die Auswahl
zwischen verschiedenen Anbietern für Ihre Telefongespräche zu Hause.
Vor allem drei Unternehmen planen, der Telekom Kunden zu entführen:
Arcor, Otelo und VIAG Interkom, die bereits eigene, von der Telekom
unabhängige Telefonnetze aufgebaut haben. Nur für die „Letzte Meile“
müssen sie die Leitungen der Telekom benutzen und dafür Gebühren
zahlen. Aber auch zahlreiche kleinere Unternehmen sitzen in den
Startlöchern, um sich auf bestimmte Zielgruppen zu konzentrieren.
Mit neuen Ideen wollen sich die Telekom-Konkurrenten Marktanteile
sichern. Sie testen kostenloses Telefonieren mit Werbeunterbrechung,
bieten Rabatte für Vieltelefonierer sowie sekundengenaue Abrechnung
und die überregionale Erreichbarkeit unter einer Rufnummer an.
Uns als potentielle Kunden bleibt es, erst einmal abzuwarten, wie die
blumigen Versprechungen von besserem Service und niedrigeren
Gebühren zu bewerten sein werden. Mit genauen Preisen halten Otelo,
VIAG Interkom und Arcor schließlich noch hinter dem Berg − erst
unmittelbar vor Dienstantritt sollen die Tarife bekannt werden. Auch
ist noch nicht klar, ob die Unternehmen tatsächlich ab Anfang Januar
einsatzbereit sind.
Während die Großen mit Startschwierigkeiten zu kämpfen haben,
machen die Kleinen jedoch bereits Nägel mit Köpfen. Talkline und
Mobilcom, bislang Provider für Mobilfunknetze, wollen ab Januar als
Telekom-Konkurrent auftreten und haben sogar schon Preise bekannt-
gegeben. Talkline verlangt 44 Pfennig tagsüber bzw. 22 Pfennig abends
und nachts pro Minute Ferngespräch, Mobilcom verwendet die gleichen
Zonen wie die Telekom, worauf Rabatte von bis zu 30 Prozent
geschlagen werden.
Die Telekom will den neuen Telefongesellschaften den Markt jedoch
nicht kampflos überlassen und verbessert ständig das Angebot −
etwa mit den besonderen Tarifen CityPlus und CityWeekend oder der
T-Net-Box beispielsweise.
Um den neuen Anbietern den Start zu erleichtern, darf die Telekom
die 01188, die bekannte Rufnummer für die Auskunft, nicht mehr
verwenden. Statt dessen hat das Bundesamt für Post und Telekommunikation
(BAPT) allen Anbietern per Los je eine Rufnummer für die
In- und Auslandsauskunft zugeteilt. Bisher betreibt aber neben der
Telekom nur ein zweiter Anbieter − Telegate − einen Auskunftsdienst.
Ich bin mir sicher − im liberalisierten Telekommunikationsbereich wird
es 1998 spannend. Nach Umfragen sind 64 % der Bundesbürger bereit,
von der Telekom Abschied zu nehmen, sofern günstigere Gebühren
offeriert werden. Der FUNKAMATEUR wird die Entwicklungen beobachten
und sich dem Thema in einer der nächsten Ausgaben ausführlich
widmen − abhängig davon, wann Otelo & Co die Karten auf
den Tisch legen und ihre Preisstruktur bekanntgeben.
Ihr
René Meyer
Der Wagen rollt
In seiner Sitzung am 25. und 26. 10., also etwa, wenn diese Ausgabe des
FUNKAMATEUR erscheint, hat der Amateurrat des DARC die Stellungnahme
des Klubs zum Entwurf der Amateurfunkverordnung, AFuV, die ja das neue
Amateurfunkgesetz im Detail umsetzt, abschließend beraten und entschieden.
Die Stellungnahme wird dann den Mitgliedern des Runden Tisches Amateurfunk,
RTA, zugesandt und u.a. auf den Internetseiten des DARC und im Packet-Radio-
Netz veröffentlicht (s. S. 1368).
Wer sich ein Bild machen möchte, sollte neben dem Gesetzestext und den
Gedanken von Wolfgang Martin aus dem BMPT dazu sowie dem DFuV-Entwurf
des BMPT (alles im FA nachzulesen) auch die vorläufige und die erwähnte
endgültige Stellungnahme des DARC zu Kenntnis nehmen. Außerdem gibt es
noch Erläuterungen des BMPT, sowohl zum AFuG auch zur AFuV, die u. a. im
Internet, aber auch im Packet-Radio-Netz zu finden waren.
Alles recht umfangreiche Dokumente, die noch dazu Bezüge auf das EMV-Gesetz
und anderes mehr enthalten. Für jemand, der sich außerdem nicht mit Formu-
lierungsfeinheiten auskennt, ein hartes Stück Arbeit − die anscheinend auch nur
ein paar Funkamateure auf sich genommen haben. Im Packet-Netz fanden sich
jedenfalls nur einige und noch weniger fundierte Beiträge zu diesem Thema,
während man sich beispielsweise mit Vehemenz um das Auslesen fremder Briefe
aus Amateurfunk-Mailboxen oder den Vorlauf bei der Verbreitung des DL-Rund-
spruchs in PR stritt.
Immerhin erhielt die DARC-Zentrale in Baunatal 100 Meinungsäußerungen mit
insgesamt um die 350 A4-Seiten bedruckten Papiers, die von etwa 30 Mitgliedern
der AFuV-Arbeitsgruppe des DARC, Spezialisten aller Couleur, durchgearbeitet
wurden. Nicht viel Zuschriften bei 50 000 Mitgliedern, aber vielleicht waren es
dann ja doch diejenigen, die wirklich etwas zu sagen hatten.
Zugegeben, ich habe zwar auch keine persönliche Stellungnahme zum Entwurf
abgesandt, mich aber intensiv für den Inhalt samt Kommentaren interessiert, und
das nicht nur zum beruflichem Nutzen. Leider war auch die Zeitspanne zwischen
Veröffentlichung des DARC und avisiertem Absendezeitpunkt reichlich kurz.
Für wünschenswert halte ich nach wie vor eine Einsteigerklasse; die Störfall-
regelung scheint teils schlechter, als wenn es einfach nach dem EMV-Gesetz
ginge. Differenzierung lediglich durch die CW-Prüfung provoziert bei leichter Prü-
fung unqualifizierte Funkamateure oder zu eingeengte Rechte. Die Forderungen
an betriebliche Kenntnisse beschränken sich auf einen Torso, der vermutlich
dem Gesetzgeber genügt, nicht aber für ein gedeihliches Miteinander der
Funkamateure.
Rechnet man nach, was eine Amateurfunkprüfung kostet, ergibt sich etwa ein
halber Tausender: schlecht für unbemittelten potentiellen Nachwuchs. Wer nun
eigentlich unter welchen Bedingungen das Ausbildungsrufzeichen erhält, habe
ich nicht verstanden. Sinnvollerweise doch wohl der Ausbilder für eine Person
als Auszubildenden? Hat uns die EMV-Problematik die Rückkehr gegenüber
früheren Entwürfen zu /m, /p und /mm beschert? Immernoch die später kaum
noch benutzte Handtaste als Prüfungspflicht und dabei nur ein echter Fehler …?
Nun darf man also auf die endgültigen Stellungnahmen des DARC und danach
die das RTA gespannt sein – und auf das, was das sich mehr oder weniger
auflösende BMPT davon akzeptiert. Schließlich bleiben für den lizenzierten
Funkamateur noch die Mysterien des Frequenznutzungsplans, der ja Frequenzen
und Leistungen festlegt, und für den Funkamateur in spe die der Prüfung.
Vielleicht multiple Choice, wie schwer sind die Fragen des neuen Katalogs,
und gibt es etwa doch noch eine Einsteigerklasse?
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Modern business
Der Rubel muß rollen, die Wirtschaft florieren. Geschäft ist alles.
Und die neuen digitalen Medien versprechen da branchenübergreifend
einen immensen Wachstumsmarkt. Die Berliner Funkausstellung
ließ davon erst kürzlich wieder etwas erahnen.
Heute, da die Taktfrequenzen moderner PCs UKW-Sender schon
mal wie Langwellenstationen aussehen lassen und sich mit DVD
und CD-RW-Technologien gigantische Speicherkapazitäten
erschließen, scheint nichts mehr unmöglich.
Vorbei die guten alten ZX-Spectrum-Zeiten, wo in den 16 KB RAM
eine komplette Textverarbeitung („TasWord“, man erinnert sich?)
reichlich Platz fand, die auch schon (fast) alles Wichtige konnte, was
heutige Textsysteme leisten. Jetzt muß schon ein einfacher Datei-
betrachter, der auf sich hält, mindestens 10 MB groß sein. Wer hat,
der hat.
Wenn Speicherplatz nicht mehr knapp ist, findet sich auch kein
Programmierer mehr, der damit platzsparend umzugehen weiß. Und
weil die aktuellen digitalen Technologien so viel neue Chancen bieten,
kommt auch der Geschäftssinn nicht zu kurz.
Beispiel gefällig? Wie ist das doch z. B. mit den Kaufvideos? Man
besorgt sich ein Video-Tape mit einem interessanten Spielfilm drauf
und kann ihn sich von da an immer wieder ansehen. Und im Kino?
Für jede Vorstellung muß man eine Eintrittskarte kaufen.
DVD und CD-RW machen’s jetzt möglich: Den digitalen Spielfilm in
bester Ton- und Bildqualität auf der Silberscheibe sieht man sich
zwei-, dreimal an, beim viertenmal erscheint dann nur noch eine
Dialogbox, die zur Eingabe eines Freischaltcodes für weitere drei
Vorstellungen auffordert. Den Code kauft man sich dann selbstver-
ständlich jedesmal beim Produzenten neu. Das Geheimnis ist ein
verschlüsselt auf die Disc zurückgeschriebener Benutzungszähler.
Auch bei den Online-Diensten und im Internet dreht sich alles ums
Geschäft. Die Internet-Explorer und Netscape-Browser werden
schließlich nicht deshalb kostenlos unters Volk gebracht, weil man
so gar nichts anderes damit anzufangen weiß.
Im Gegenteil − wer hier langfristig die Nase vorn hat, bestimmt
künftige Standards und hat somit die Hand am Geldhahn. Und dann
boomt das „modern virtual business“. Bereits heute ist das Internet
keine anarchistische Spielwiese von einigen Technik-Freaks mehr,
sondern zunehmend ein immer mehr kanalisiertes Geschäftsmedium.
Dem trägt auch das in Deutschland zum 1. August in Kraft getretene
Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG) Rechnung.
Wesentliche juristische Punkte sind darin die Funktion digitaler
Signaturen und die vorläufige Abkehr von einem Kryptografiegesetz.
Rechtliche Grauzonen werden sich im Gefolge der neuen Paragraphen
sicher erst in der praktischen Anwendung abzeichnen.
Online abzufragen ist der vollständige Gesetzestext unter
http://www.bmbf.de.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Mehr Klassen für Klasse
Das neue Amateurfunkgesetz ist in Kraft. Wichtige Details wie zulässige
Sendeleistung, Verfahren bezüglich EMVU, Telegrafie, Zeugnisklassen
usw. wird erst die zugehörige DVO regeln. Es gilt zwar schon das neue
AFuG, aber noch die alte Durchführungsverordnung.
Bald nach Erscheinen dieser Ausgabe des FA sollte der neue Entwurf zur
Diskussion verfügbar sein. Erstaunlich, daß sich die Packet-Diskussionen
dieses Themas kaum angenommen haben. Doch von der AGZ kamen
jüngst „Leitlinien und Empfehlungen zu einer AFuV 1997“, mit denen ich
mich in einigen Aussagen nicht identifiziere, die aber doch interessante
Denkanstöße geben.
Wichtige Punkte der Durchführungsbestimmungen sind Anzahl und
Ausgestaltung der Zeugnisklassen. Der DARC favorisiert bis zu fünf, das
Ministerium hätte aus Aufwands- und Kostengründen zunächst am
liebsten nur eine Einheitsklasse gehabt. Da dem die beiden CEPT-Klassen
entgegenstehen, hat man sich auf zwei dazu passende deutsche festgelegt,
die eine sicher (noch) mit, die andere ohne Telegrafieprüfung.
Fragt sich, ob diese Zahl in der Diskussion mit dem Runden Tisch
Amateurfunk diskussionsfähig ist.
Immerhin hat der Amateurfunk lt. AfuG u. a. den Zweck der eigenen
Weiterbildung, die ja zum guten Teil während der Vorbereitung zur
Prüfung stattfindet. Was liegt näher, als ein gestaffeltes System, das das
Erreichen der höchsten Zeugnisklasse über mehrere Stufen und so die
Motivation zur weiteren Qualifizierung aufrechterhält. Zudem könnten
Inhaber der höchsten Klasse ob ihrer nachgewiesenen Befähigung auch
weitreichendere Rechte erhalten, als bei nur zwei Klassen. Die Erfahrungen
mit dem gegenwärtigen System zeigen zudem, daß viele Funkamateure
auch tatsächlich über C und A zur Klasse B gekommen sind.
Mit dem Zweiersystem wäre leider auch die wünschenswerte Einsteiger-
klasse vom Tisch. Für die Newcomer gäbe es ja den Ausbildungsbetrieb.
Da der aber aus gutem Grund Restriktion wie zeitliche Begrenzung,
Aufsicht durch den verantwortlichen Funkamateur, vielleicht auch beson-
deren Genehmigungen, unterliegen wird, stellt er zwar eine sehr erfreu-
liche Option für den Newcomer, aber keine echte Alternative für eine
Einsteigerklasse mit individueller Genehmigung dar.
Wenn doch zwei Klassen, sei der nicht neue, aber weiterhin ketzerische
Gedanke aufgewärmt, im 70-cm-ISM-Band unter bestimmten Randbedin-
gungen Funkbetrieb zwischen Funkamateuren und LPD-Funkern zuzulas-
sen. Da der bisherige Nutzerstatus des Amateurfunkdienstes in diesem
Bereich zumindest in Deutschland offensichtlich nicht mehr durchsetzbar
ist, könnten hier Funkamateure und der potentielle Nachwuchs im positiven
Sinne Berührungspunkte finden, statt Fehden auszutragen.
Was hält das BMPT denn davon ab, die gegenwärtige obskure Situation
im 70-cm-ISM-Band zu beenden; von der ISM-Urdefinition (industrielle,
wissenschaftliche und medizinische Anwendungen) ist man ja auch abge-
rückt. Zur moralischen Unterstützung noch ein Gedankenexperiment:
Da dem LPD-Nutzer in dieser Hinsicht keine Vorschriften gemacht wurden,
könnte er ein Amateurfunkrufzeichen benutzen und amateurfunkähnlichen
Betrieb machen, ohne dadurch straffällig zu werden. Ein Funkamateur
würde dann ohne Argwohn mit ihm in Kontakt treten. Was dann?
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Der Optimist
Mein Freund Thomas ist zur Zeit ziemlich aus dem Häuschen. In vielen
Stunden hat er unermüdlich das neue Amateurfunkgesetz studiert. Seitdem
er auf einem der letzten Klubabende seines OV zum Verantwortlichen in
Sachen Ausbildung avancierte, lassen ihm die gesetzlichen Neuerungen
hinsichtlich des nicht mehr geforderten Mindestalters sowie des nunmehr
möglichen Ausbildungsfunkbetriebes keine Ruhe mehr − vor allem, weil
er nunmal Optimist ist. Das äußert sich derart, daß Thomas vom Glauben
an ein bald anbrechendes neues Zeitalter hinsichtlich Nachwuchsgewinnung
beseelt ist und meint, Menschenmassen jüngeren Jahrgangs würden
in den nächsten Monaten die Ausbildungskapazitäten seiner Klubstation
völlig überfordern.
Vielleicht sollte ich ihm mitteilen, daß ich an seiner Stelle derartige
„Bedenken“ nicht hätte − jedenfalls wenn ich mir eine Reihe meiner
Bekannten, deren Freunde, Kinder und Kindeskinder so ansehe: darunter
nicht wenige, die zwar nicht Funkamateure im Sinne des neuen Gesetzes
sind, sich aber dennoch dem Funk im weitesten Sinne mehr oder weniger
verbunden fühlen − also BC-DXer, CB-Enthusiasten, SWLs usw. Ich glaube
kaum, daß sie demnächst scharenweise, die Ausbildungsunterlagen schon
unter dem Arm, auf Amateurfunklehrgängen gesichtet werden.
Und das oft nicht, weil sie Ausbildungsmühen und Prüfungsstreß scheuen,
sondern vielmehr deshalb, weil Exklusivitätsdünkel und elitäres Getue so
manchen abschrecken. Dabei beruht gegenwärtig die von manchem OM
immer noch beschworene Exklusivität des Amateurfunkdienstes (Was
heißt das überhaupt? – etwa: Wir haben ein eigenes Gesetz, also sind wir
was Besonderes!) doch wohl mehr auf Einbildung.
Angesichts dessen, was auf den Bändern allenthalben so zu hören ist,
muß man dies jedenfalls annehmen: Da wird mehr oder minder offen
zugegeben, daß Leistungsbeschränkungen ja nun wirklich nicht interes-
sierten, und man die entsprechenden Schalter an der Rückwand der
Endstufe schon umlegen würde, wenn die DX-Station nur hinreichend
selten sei. Dann folgen auch schon detaillierte Ausführungen zur Kranken-
geschichte des heimischen Wellensittichs, und schließlich hält noch jemand
ein kleines Referat zum Gurkenwachstumstempo im Garten-QTH.
Aber gut, wer Probleme mit dem Gemüse hat, wird besagten Erzählungen
gespannt lauschen, das sei ihm unbenommen. Das Problem ist nur:
Wie überzeuge ich einen jungen SWL, der Ohrenzeuge all dessen war,
davon, daß er sich nun an die Vorbereitung zur Lizenzprüfung machen
sollte?
Wer sich respektive sein Hobby im positiven Sinne exklusiv nennen will,
darf nicht fünf Minuten nach Erhalt der Genehmigungsurkunde alle vorher
gehörten hehren Aufgaben und Ziele des Amateurfunks vergessen −
frei nach dem Motto: Nach mir die Sintflut!
Nach gründlicher Ausbildung und Prüfung sollte jeder in der Lage sein,
das QSO-Geschehen auf den Bändern „exklusiv“ zu bereichern und
potentielle Nachwuchsfunker in Begeisterung zu versetzen. Wenn wir
das nicht schaffen, verliert mein Freund Thomas am Ende noch seinen
Optimismus, und das kann ja wohl niemand ernsthaft wollen.
Ich hoffe, wir hören uns.
Kay Schöphörster, DL8NTC
Technologien, Trends & Themen
Das Zusammenwachsen von Computern und Consumer-Elektronik wird ja
auf den einschlägigen Messe-Events schon seit einiger Zeit thematisiert.
Microsoft will jetzt so richtig Ernst damit machen. Gemeinsam mit ver-
schiedenen I&K-Unternehmen hat die Firma neue Windows-Komponenten
angekündigt, die Bestandteil der Spezifikationen für den sogenannten
„Entertainment-97-PC“ werden.
Die ersten Entertainment-PCs sollen Ende dieses Sommers verfügbar sein
und das Herz eines Unterhaltungs-Centers für die ganze Familie werden.
Mit ihnen wird man dann gleichzeitig fernsehen, im Internet surfen und
seinen Videorecorder programmieren können, während der PC im Hinter-
grund die neueste Shareware downloaded und die Audio-CD ein Musik-
stück zum besten gibt. Schöne neue Datenwelt…
Fragt sich nur, ob sich irgendjemand auf so viele verschiedene Dinge
gleichzeitig konzentrieren kann. Doch mal Spaß beiseite − natürlich ist es
sinnvoll, unnötige Technologie-Redundanz zu vermeiden. Die Monitore
von Fernsehgerät und PC unterscheiden sich schließlich in technischer
Hinsicht nicht − und wenn eh’ schon Tastatur und Maus vorhanden sind,
benötige ich auch keine …zig unterschiedlichen Fernbedienungen mehr
für TV, Radio, Video und CD-Player.
Mit der wachsenden Leistungsanforderung an die Systeme muß natürlich
auch die Prozessortechnologie mithalten. Intel macht ja inzwischen
ziemlichen Wirbel mit dem Schlagwort MMX. Nur hat die Sache mit der
Multimedia-Erweiterung der Pentium-Prozessoren zur Zeit noch den
Haken, daß die neu eingeführten Mikrobefehle des Prozessors ja nur
dann etwas bewirken, wenn eine Software diese auch verwendet.
Und da sieht’s halt am Markt doch noch einigermaßen bescheiden aus.
Aufmischen will den CPU-Markt gegen Intel demnächst die Firma
Advanced Micro Devices. In zwei Jahren soll in Dresden eine neue Chip-
fabrik fertig sein, wo AMD dann seinen derzeitigen Super-Prozessor K6
bauen wird. Man erhofft sich damit bis zur Jahrtausendwende einen
Marktanteil von bis zu 30 Prozent in diesem Segment. Erste Benchmarks
zeigen, daß der K6 gerade unter Windows95 bei typischen Büroanwen-
dungen schneller ist als Intel’s Pentium MMX. Und er soll sogar um
25 Prozent billiger angeboten werden als die Intel-CPU. Uns als Kunden
kann der Machtkampf der Chipgiganten nur recht sein, werden sich so
doch stets faire Marktpreise realisieren.
Auch im Bereich der Gebrauchselektronik tut sich so einiges in Richtung
PC-Integration. Das neue Schlagwort heißt CEBus. Diese eigentlich schon
zehn Jahre alte Technologie macht aus dem PC ein Fernbedienungsund
Steuerungscenter für Verbrauchergeräte, Sicherheitssysteme und Klima-
anlagen. CEBus verbindet dabei den PC via Netzzuleitung oder per Funk
mit der Peripherie. Der Standard ist derzeit unter der Bezeichnung
„Home-Plug-and-Play“ bekannt.
Vielleicht werden ja schon zur diesjährigen Funkausstellung in Berlin erste
CEBus-Geräte vorgestellt. Die Trends sind klar, die Zukunftstechnologien
anvisiert. Doch das letzte Wort zur Anwenderakzeptanz wird wie immer
nach erster Euphorie die tägliche Praxis sprechen.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Zum Redaktionsschluß dieses FA sollte des neue deutsche Amateurfunk-
gesetz, das man den Umständen nach wohl zufriedenstellend nennen
kann, den Bundesrat passiert haben und damit so gut wie gültig sein.
Zu besagten Umständen, die sich erst in jüngsten Jahren zum Problem
gemausert haben, gehört zuvorderst die EMV-Problematik.
Nun hat also lt. Gesetzestext der Funkamateur „der Regulierungsbehörde
vor Betriebsaufnahme die Berechnungsunterlagen und die ergänzenden
Meßprotokolle für die ungünstigste Antennenkonfiguration seiner Ama-
teurfunkstelle vorzulegen“, was man durchaus noch als Entgegenkommen
werten darf.
Eine harte Nuß. Für den Durchschnittsamateur aus eigener Kraft kaum zu
knacken, zumal es an geeigneter Literatur für Berechnungen im Nahfeld
fehlt; zudem haben die Bauten im Expositionsbereich erheblichen Einfluß.
Ich könnte mir vorstellen, daß versierte Funkamateure für gebräuchliche
Antennentypen eine Sammlung von Grafiken erarbeiten. Die würden z. B.,
auf einen HF-Leistungswert normiert, Kurven gleicher Feldstärke um die
als räumliches Gebilde zu sehende Antenne enthalten. Daraus ließen sich
dann unter Berücksichtigung der tatsächlichen Leistung die gewünschten
Daten für den jeweiligen praktischen Fall ableiten, alles hervorragend
in einer Software integrierbar.
Solange Baulichkeiten die Feldstärke unter das so ermittelte Niveau senken
(Dämpfung, Abschirmung), ergäbe sich nur eine größere Sicherheit gegen-
über zu hohen Feldstärken. Über solche Einflüsse müßten zusätzlich Erkennt-
nisse publiziert und ggf. gewonnen werden.
Punkt zwei: Auch absolute Feldstärkemessungen sind sicher fast allen Funk-
amateuren fremd. Die bekannten „Feldstärkemesser“ liefern bestenfalls
Relativwerte. Immerhin brauchen wir die Empfindlichkeit der teuren
kommerziellen Meßgeräte, wie sie z. B. bei der Funkentstörug zum Einsatz
kommen, nicht: Bei uns geht es um verhältnismäßig hohe und wohl fast
immer dominierende Feldstärken, so daß nicht unbedingt selektiv gemessen
werden muß. Mit ein paar originellen Ideen und unter Verwendung moderner
Bauelemente sollte sich doch da ein, wenn auch nur unter Einschluß
von Frequenzgangkurven, eichbares Meßgerät akzeptabler Genauigkeit
erfinden lassen. Aber vielleicht überrascht uns bald ein Kleinunternehmen
mit einem abgespeckten und trotzdem geeichten Feldstärkemeßgerät?
Um dem einzelnen Funkamateur Hilfestellung zu geben, leisten die im
Aufbau begriffenen bzw. bereits tätigen EMV-Arbeitsgruppen unter dem
Dach des DARC andererseits schon überaus wichtige Vorarbeit.
So oder so wird es zudem nach Inkrafttreten des Gesetzes generell prakti-
kable Lösungen zur Umsetzung seiner Bestimmungen geben müssen, die
nicht der Masse der Funkamateure den Boden unter den Füßen wegziehen,
wobei den Durchführungsbestimmungen, von deren Gehalt ja noch so gut
wie nichts zu vernehmen war, viel abhängt. Hier ist als Verhandlungsgremium
der Runde Tisch Amateurfunk gefordert.
„Die werdens schon richten“ gilt aber nicht, denn in Zukunft erwartet man
auf EMV-Gebiet von jedem einzelnen Funkamateur solides Wissen; schon
die Prüfung wird es dem Kandidaten abverlangen. Damit auch wir es
vermitteln können, würde sich die Redaktion FUNKAMATEUR über
zweckdienliche Manuskriptangebote freuen.
Mit besten 73
Bernd Petermann, DJ1TO
Viva Internet?
Seit kurzem bin ich mit e-Mail-Adresse ausgerüstet und habe Zugriff
aufs Internet, und also wird jetzt ab und zu richtig „gesurft“. Ich weiß,
so manch einer unter den Funkamateuren mag sich mit dieser Materie
nicht recht anfreunden. Das sei neumodischer Kram, Totengräber
des Amateurfunks usw.
Mein Freund Andy rümpfte dann auch sofort verächtlich die Nase
und strafte mich, indem er mehrfach unsere wöchentlichen Skeds
boykottierte und außerdem überall verbreitete, ich bereite meine
Stationsauflösung vor (meine Freundin stieß ebenfalls schon ein paar
unverhüllte Drohungen aus, da mein Telefonanschluß neuerdings
andauernd besetzt ist − aber das nur nebenbei). Dabei wollte ich doch
nur einmal sehen, worüber soviel Aufhebens gemacht wird. Mir ist
nämlich die ganze Aufregung unverständlich, die das Thema in
manchen Funkamateurkreisen zuweilen auslöst.
Aber im Ernst: Ich glaube nicht, daß nun ausgerechnet die weltweite
Computervernetzung für den Amateurfunk wirklich so bedrohlich ist
oder wird, weil sich z. B. potentieller Nachwuchs nun erst recht vor
Ausbildung und Prüfung scheut oder weil eine globale und schnelle
Kommunikation von Tag zu Tag einfacher wird.
Ich denke, DXer werden sich weiterhin den Zorn ihrer Familien
zuziehen, wenn sie für Tage im Shack verschwinden, um die Pile-Ups
zu vergrößern, eher sportlich Orientierte stürzen sich auch in Zukunft
ins Contestgewühl, passionierte Selbstbauer tauschen mit Sicherheit
ihren Lötkolben nicht gegen ein Modem (wenn speziell diesem Bereich
Gefahren drohen, dann hat das andere Gründe) usw. Kurzum: Funk-
amateur bleibt man in aller Regel bis zum letzten „CQ“ − trotz viel-
fältiger neuer Kommunikationsmöglichkeiten. Denn allein aus einem
gesteigerten Mitteilungsbedürfnis kommt wohl kaum jemand zum
Amateurfunk und falls doch, wird er bald eines Besseren belehrt
(ich jedenfalls habe ich mich auf dem Band noch nicht abendfüllend
mit einem OM aus Tonga unterhalten können – aber via Internet).
Viel entscheidender ist doch das Interesse, das bei der Berührung
mit dem Amateurfunk für dessen Besonderheiten entsteht. Und wenn
sich dann daraus so etwas wie Leidenschaft entwickelt, dürfte wohl
jedwede Prüfung kein Problem mehr sein.
Das heißt: Wer Funkamateur werden will, der wird es auch, wer nicht,
der wäre es auch früher, ohne Internet, nie geworden. So bin ich
überzeugt, daß z. B. eine Aufhebung der bisherigen Telegrafieprüfung
die Zahl der Funkamateure nicht signifikant erhöhen würde, höchstens
die Zahl der Rufzeicheninhaber.
Also: Interessen wecken für das Spezifische des Amateurfunks und
bei Bedarf trotzdem jedem seine Mailbox. Übrigens habe ich Andy
schon soweit, und meiner Freundin bringe ich ab morgen Telegrafie
bei.
Ich hoffe, wir hören uns.
Kay Schöphörster, dl8ntc@aol.com
Von der Beständigkeit der Medien
Kürzlich habe ich zum ersten Mal eine Komplettsicherung meiner Daten −
Artikel, Bücher, Hunderte von Screenshots, Zehntausende archivierter
Mails, Notizen − vollzogen. Zur Anwendung kam dabei ein Streamerband,
nicht größer als eine Audiokassette, das den Text von 7500 Büchern
speichert. Mehr Text, als ich je schreiben werde.
Auf den ersten Blick sehr beruhigend, macht sich bei näherer Betrachtung
Nachdenklichkeit breit: Weil noch nie zuvor in der Geschichte der
Menschheit so viele Informationen auf engstem Raum gelagert wurden,
war es noch nie so einfach, sie blitzschnell zu vernichten. Eine (häufig
meinen Schreibtisch zierende) dampfende Tasse mit Kaffee, die einerseits
mit häßlichen Flecken ein Buch signiert, läßt andererseits in Sekunden
Gigabytes sich in Wohlgefallen auflösen.
Das Publikationswesen hat die neuen Medien entdeckt: Auf CD-ROM und
im Internet werden Informationen zugänglich gemacht. Tag für Tag geben
…zig Gigabyte an e-Mails und Beiträgen in elektronischen Diskussionsforen
das Lebensgefühl einer stetig wachsenden Gemeinde wieder. Sie ist heute
noch in der Minderheit; aber in naheliegender Zeit wird die Vernetzung
per Computer genauso verbreitet sein wie die Vernetzung per Telefon.
Man geht davon aus, daß Speichermedien im besten Fall zwanzig bis
dreißig Jahre halten. Zu einer optimistischeren Angabe läßt man sich meist
nicht hinreißen − die 3,5"-Diskette ist seit rund 15 Jahren auf dem Markt;
verläßliche Angaben über die Integrität der Daten über diesen Zeitraum
hinaus existieren nicht. Zwar werden Verfahren angewandt, um Materialien
künstlich schneller altern zu lassen, doch niemand weiß genau, wie lange
die Daten auf einer CD abrufbar sind, wie chemische Prozesse, wie der
Einfluß der Luft einwirken. Dabei haben wir’s mit der CD noch ganz gut:
Die Scheibe speichert sowohl Musik als auch Computerdaten, und ihr
Nachfolger, die DVD, ist abwärtskompatibel.
Dennoch bleibt eine Sorge: Gesetzt den Fall, eine CD ist in hundert Jahren
noch in Ordnung, wie schaut es um die Lesegeräte aus? Computerdaten
sind in einer Art und Weise kodiert, die uns nicht in unmittelbarer Weise
zugänglich ist. Ein Historiker kann problemlos in der Lutherbibel (1534)
schmökern und Höhlenmalerei (30000 bis 8000 v. u. Z.) studieren; für
Lochkarten oder 8"-Disketten müssen dagegen Hilfsmittel zur Verfügung
stehen, die in naher Zukunft womöglich neu zu entwickeln sind. Und wenn
die Bits zu lesen sind, ist das Datenformat zu rekonstruieren. Schon heute
gibt es Probleme mit Dutzenden von Text- und Grafikformaten, die mit
einem von …zig Packern komprimiert sind.
Von den Schriften aus dem Mittelalter oder gar früherer Zeit sind uns heute
nur noch Bruchstücke erhalten geblieben. Eingedenk dessen sollten wir
die Chancen unseres Technologiestands nutzen: Digital werden Daten
verlustfrei übertragen. Wenn es gelingt, Medien zu entwickeln, die einige
Jahrhunderte ihr Wissen sicher behalten, werden wir unseren Nachkommen
unschätzbare Dienste erweisen.
Ihr
René Meyer
It’s CeBIT Time
Es ist wieder einmal soweit: Nachdem im vergangenen Herbst die
„kleine Schwester“ den Consumer-Bereich bediente, kann sich vor allem
der Geschäftskunde vom 13. bis 19. März auf der „großen“ CeBIT ’97
in Hannover über aktuelle Trends und Entwicklungen der Computer-,
Telekommunikations- und Multimedia-Branche informieren. Der FUNK-
AMATEUR wird sich selbstverständlich auch in diesem Jahr für Sie auf
der Mega-Computermesse umsehen und aktuell berichten.
Schon im Vorfeld des Medienspektakels ist abzusehen, wo die Aussteller
ihre Schwerpunkte setzen werden. So ist vor allem klar, daß sich die
Marktaktivitäten am harten Wettbewerb im Zeichen allgemeinen Preis-
verfalls und Produkten mit extrem verkürzten Lebenszyklen orientieren
müssen. Vieles wird sich nicht mehr einfach nur über Produkte und deren
Preise, sondern auch in verstärktem Maß über Dienstleistungen rund um
das Medium Computer realisieren.
Mit zu den Hauptthemen werden auch 1997 sicherlich die Online-Dienste
mit ihren Angeboten zählen. Das Internet verändert schon heute bis
in den privaten Bereich hinein die Kommunikationsstrukturen. Nach
Angaben des Fachverbandes Informationstechnik sind von den insgesamt
etwa 19 Millionen in Deutschland installierten Personalcomputern bereits
jetzt 2,5 Millionen Geräte mit einem Internet- oder Onlinedienst-Zugang
ausgerüstet. Gegenwärtig ist ein regelrechter Gründungsboom von
Internet-Provider-Firmen auszumachen, es wird abzuwarten bleiben,
wie wettbewerbsorientiert diese handeln werden und mit welchem
Service- und Preisniveau sie an den Markt herantreten.
Multimedia wird auf der CeBIT ’97 im Bereich „Network Computing“
wieder zum allumfassenden Thema avancieren. Angesagt haben sich
Systemanbieter mit konkreten Realisierungskonzepten und Produkten
zur netztechnischen Zusammenführung von Daten-, Text-, Bild- und
Sprachkommunikation im gleichen Netz. Dazu kommen technische
Lösungen für die Einbindung unterschiedlichster Kommunikations-
plattformen für Informationsverarbeitung und Geschäftsabwicklung.
Das tägliche Transaktionsvolumen im internationalen Zahlungsverkehr
über Datennetze soll bereits größer sein als Deutschlands Jahresbudgets.
Unvermindert werden im Brennpunkt der Messe auch die Themenbereiche
ISDN und Mobilkommunikation stehen, wobei große Aufmerksamkeit
speziell dem digitalen Funktelefon gilt, dessen Markteinführung derzeit
auf Hochtouren läuft. Die Branche boomt regelrecht, jeden Monat
kommen mehr als einhunderttausend neue Mobilfunkteilnehmer hinzu.
Wen wundert’s, wenn in Hannover deshalb nicht nur sämtliche Netz-
betreiber anwesend sein werden, sondern auch diverse Mehrwertdienste,
die in Verbindung mit den GSM-Netzen Voice- und Non-Voice-Services
anbieten.
Doch ungeachtet aller multimedialen Euphorie, die so eine Messe natur-
bedingt immer mit sich bringt, sollte Technik schließlich kein Selbstzweck
sein. Und so bleibt die eigentlich spannende Frage, welche Auswirkungen
sich aus den neuen Technologien kurz-, mittel- und langfristig am
Arbeitsmarkt ergeben werden − so rosig sieht’s ja im Moment nicht aus.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, DD6AE
Wie hätten Sie es gern?
Der FUNKAMATEUR ist (aus seiner Historie heraus) bekanntlich eine
Zeitschrift mit einem für die deutsche Presselandschaft thematisch
ungewöhnlich breit gefächerten Inhalt. Daß eine solche Mischung
von Ihnen als Leser angenommen wird, erscheint bei der allenthalben
anzutreffenden zunehmenden Spezialisierung zunächst verwunderlich.
Andererseits werden Sie selbst sicher keine auf ein ganz enges
Gebiet konzentrierten Interessen haben, sondern auch Benachbartem
oder Randgebieten gegenüber aufgeschlossen sein.
Selbstverständlich geht eine Zeitschrift mit der Zeit, Hand in Hand
mit der technischen Entwicklung, verändert dabei ihr Profil, inhaltliche
Proportionen, das Erscheinungsbild. Dazu muß die Redaktion
Trends spüren, was uns eher leicht fällt, da alle Redakteure und der
Herausgeber selbst eng mit dem Hobby verbunden sind. Daneben
müssen wir uns in größeren Abständen direkt an Sie wenden,
um Ihre Interessen in Erfahrung zu bringen. Unsere vorige Leser-
befragung ist genau drei Jahre alt. Inzwischen stießen viele neue
Leser, vor allem aus den alten Bundesländern, zu unserem Auditorium.
Aber auch bei den Stammlesern, denen ganz wesentlich zu verdanken
ist, daß Ihr FUNKAMATEUR als Zeitschrift fortbestehen konnte, wandeln
sich die Interessen.
Vergleichen Sie die Ausgabe 2/1994 mit der vorliegenden, fallen kleinere
oder größere Veränderungen ins Auge. Am ehesten Äußerlichkeiten −
Vierfarbdruck, größerer Heftumfang, anderes Papier, verändertes
Zeichnungsdesign … Unter dem Strich ist selbstverständlich der Inhalt
entscheidend, und da muß man schon aufmerksam blättern, um
Unterschiede in den Wichtungen der Themengebiete wahrzunehmen.
Wir möchten also wieder einmal wissen, wie Sie’s denn gern hätten.
Dazu finden Sie in der Heftmitte (Seite 187) eine Antwortkarte,
die Ihnen neben der Kreuzchenparade die Möglichkeit gibt, weitergehende
Meinungen zu äußern. Das dürfen nicht nur thematische
Hinweise sein. Uns interessiert schon, ob Ihnen die oder einige
Beiträge vielleicht zu kompliziert erscheinen, ob Sie möglicherweise
ein aufgelockerteres Erscheinungsbild hätten und, und, und …
Wenn Sie bis spätestens 3. März zum Stift greifen, trägt das also nicht
nur dazu bei, daß Sie eine immer bessere Zeitschrift bekommen −
wir verlosen unter den Einsendern außerdem noch
10 x 100 DM!
Einen Gewinn haben Sie ganz bestimmt, vielleicht sogar einen doppelten.
Wie freuen uns auf einen großen Stapel Karten mit Meinungen,
Anregungen und durchaus auch Kritik.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Petermann, DJ1TO
Verständnisschwierigkeiten
Eine Amateurfunkgenehmigung befindet sich schon seit geraumer Zeit
in meinem Besitz, und frühere Aktivitäten waren den Möglichkeiten eines
damaligen Mitbenutzers durchaus angemessen; alles in allem eine recht
schöne Zeit − amateurfunkmäßig gesehen.
Irgendwann aber erzwangen dann doch Beruf, Wohnungswechsel, Studium,
Examen, aber auch Antennenprobleme und andere unerquickliche Begleit-
umstände des Funkerdaseins eine viel zu lange Funkstille.
Einige Jahre gingen ins Land: Daß mittlerweile die menschliche Natur den
Möglichkeiten des Packet-Radio-Netzes offenbar nicht gewachsen ist,
hatte mir mein Freund Andi schon oft erzählt. Er warnte mich auch vor
allzu großer Euphorie, als ich ihm eines Tages voller Vorfreude ankündigte,
meinen Transceiver wieder zum Leben erwecken zu wollen. Er sollte recht
behalten.
Dann war der große Augenblick da: Ich schaltete ein, suchte mir eine freie
Frequenz und fragte, wie ich es einst gelernt hatte, in allen mir zu Gebote
stehenden Sprachen, ob dieselbe eventuell schon belegt sei (hat da jemand
gelacht?). Da keine Reaktion erfolgte, war ich nun temporärer Besitzer
einer Frequenz. Das erste QSO lief sehr gut; der OM nahm sich Zeit, mit
mir zu testen, ob meine alten Gerätschaften noch in allen Schalterstellungen
ihren Dienst taten. Ich wußte nun, daß ich zwar nicht überall mit „40 dB
über 9“ zu hören war − bestenfalls im Billigradio meiner Freundin im
Nebenzimmer − aber die Technik hatte die Zeiten gut überdauert. Als
nächster rief mich mein Freund Andi: angeregtes Palaver bei guter Ver-
ständlichkeit, plötzlich „rums!“ – ein herrlicher Träger, wenn er nicht gerade
mein QSO verhindern würde. Das geht ein Weilchen so, der Informations-
austausch mit Andi reduzierte sich schnell auf „hier QRM“, die flehentlichen
Bitten an den unbekannten OM mal nicht mitgerechnet. Der hat
inzwischen seine „Träger“-Phase überwunden und ist zu einem rhythmischen
„Ahhh“, „Ahhh“ übergegangen. Ja, wo bin ich denn hier nun, im 80-m-Band
oder ’ner Arztstube − ich merke wie der Adrenalinspiegel steigt …
Die meisten von Ihnen werden solche und ähnliche Geschichten kennen,
und dabei sind das noch die harmlosesten; die wirklich schlimmen erspare
ich Ihnen für heute.
Irgend etwas läuft schief im Amateurfunk. Ich kann mich des Eindrucks
nicht erwehren, daß es früher anders war. Um es ganz deutlich zu sagen,
ich gehöre beileibe nicht zu den Leuten, die sich den Kaiser Wilhelm oder
sonst wen zurückwünschen. Aber nach einem gewissen zivilisatorischen
Standard lechze ich schon. Noch ein eher „harmloses“ Beispiel: Es ist mir
einfach unbegreiflich, wie sich jemand, der das Band selber auf einer
Breite von 6 kHz belegt, fast bis zur Besinnungslosigkeit darüber aufregt,
daß ihm die Leute auf der Nachbarfrequenz etwas zu nahe kommen.
Es könnte so schön sein, wenn jeder ab und zu an seiner eigenen Unfehl-
barkeit zweifeln würde.
… der empfängerlose OM ist nunmehr bei „Ohhh“ und „Uhhh“ angelangt.
Was will er mir sagen? Gibt er mir ein Zeichen, das ich nach so langer
Abstinenz nur nicht verstehe? Was habe ich alles verpaßt? Kann mir
jemand helfen, vielleicht sogar ihm?
Andi hat inzwischen seine Endstufe gestartet und bringt mit ihrer Hilfe noch
rüber: „Ruf mich an“. Ob das die Lösung ist, jetzt, wo ich wieder QRV bin?
Ich hoffe, wir hören uns. Vy 73
Kay Schöphörster, DL8NTC
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Computerfreaks contra Elektronikbastler?
Wieder liegt eine neue Ausgabe des FUNKAMATEUR vor Ihnen, Ihr
Magazin für Funk, Elektronik, Computer. Aus allen diesen Themen-
bereichen versuchen wir Monat für Monat, Aktuelles und Interessantes
vorzustellen. Und doch gibt es ab und zu Stimmen (speziell unter den
Elektronikbastlern), die sich über eine angebliche „Internet-Hysterie“
beklagen, während die Computerfreaks am liebsten aus dem FA ein
Magazin für Computer, Computer und Computer machen würden. Allen
Lesern recht getan…
Wer das aktuelle Geschehen beobachtet, wird nicht umhin kommen,
zuzugeben, daß zukünftig Internet, Intranet & Co. immer mehr (auch
kommerzielle) Bedeutung erlangen werden. Deshalb gehören Beiträge zu
dieser Thematik, so meine ich, einfach mit in eine Zeitschrift, die den obigen
Ansprüchen genügen möchte. Andererseits sind zwei bis drei Seiten zum
Netz der Netze pro Ausgabe sicherlich nicht so übertrieben viel.
Zugegeben, sichtet man beispielsweise das derzeitige Angebot im World
Wide Web, kann man sich durchaus manchmal des Eindrucks nicht −
erwehren, daß der Umgang mit neuen Technologien vielen Anbietern
(auch professionellen!) doch noch relativ fremd ist. Hauptsache, der
Computerfreak ist mit eigener Homepage präsent, auch wenn Aufbau und
Informationswert so mancher Seite eher einen mehr oder minder heftigen
Druck auf die Tränendrüsen verursachen. Der Unkenntnis über die
Möglichkeiten, die HTML, Scripts oder Applets bieten (neben grund-
sätzlich mangelnder Inspiration bei der inhaltlichen Gestaltung), mag es
geschuldet sein.
Aber trotzdem − wer würde denn z. B. heutzutage ernsthaft behaupten
wollen, Fernsehen wäre nur etwas für Hochfrequenztechniker?
Oder mal andersherum gesagt: Auch ohne Ambitionen auf eine eigene
Website und dem dazu erforderlichen Grundlagenwissen erschließt sich
den gestandenen Elektronikbastlern unter unseren Lesern mit der schönen
bunten Online-Welt durchaus ein immenser, nutzbringender Informations-
Pool. Beispiel:
Sie benötigen ein spezielles Datenblatt, z. B. für den A/D-Wandler-
Schaltkreis im Beitrag über das Speicheroszilloskop in dieser Ausgabe?
Kein Problem: Über http://www.analog.com/ holen Sie sich die komplette
Spezifikation auf den heimischen Computer zum Ausdrucken. Unterlagen
zu den elektronischen Potentiometern im Beitrag „IR-gesteuerter Lautstärkesteller“
gefällig? Statten Sie doch http://www.xicor.com/ mal einen
Besuch ab. Den passenden IR-Empfänger-Chip gibt’s bei Siemens unter
http://www.sci.siemens.com/.
Und ansonsten findet sich ein geeigneter Such-Einstieg für alle möglichen
Bauelemente unter dem „Chip directory“ mit der URL http://www.xs4all.nl/
~ganswijk/chipdir/, wo der interessierte „Internet-Elektroniker“ über
umfängliche Listen und Querverweise zu den betreffenden Angebotsseiten
fündig wird. Einfacher, preiswerter und schneller geht’s nicht!
Ja, und wenn Sie schon mal dabei sind, vielleicht finden Sie als
Funkamateur ja Ihren nächsten Transceiver im Online-Inseratenteil von
http://www.funkamateur.de/…?
Ihr
Dr. Reinhard Hennig
Ist Packet-Radio eigentlich Amateurfunk?
Vier Seiten dieser Ausgabe beschäftigen sich mit Entwicklungen, die auf
uns (deutsche) Funkamateure zukommen. Da ist nicht nur unser neues
Amateurfunkgesetz, dessen Entwurf neben vielen positiven Zügen noch
besorgniserregende Punkte birgt, man denkt auch wieder an seine
Durchführungsbestimmungen, deren Ausformung mindestens so wichtig ist,
wie das Gesetz selbst und die erneut heftige Diskussionen initiieren dürften,
von allerlei anderen neuen Gesetzen und Bestimmungen einmal ganz
abgesehen. Dieser Problemkreis wäre bei allem Wohlwollen, das uns das
BMPT entgegenbringt, unter „äußere Bedrohungen“ einzuordnen − ebenso
wie die ETSI-Untersuchungen, nach denen 430 bis 432 MHz und 438
bis 440 MHz verlorengehen könnten; für das ISM-Band um 434 MHz gilt das
ja nach den jüngsten Entscheidungen mehr oder weniger bereits.
Eine Arbeitsgruppe des DARC, die AGZ, andere Amateurfunkverbände und
auch die IARU-Region-1-Tagung in Haifa beschäftig(t)en sich mit der
Zukunft des Amateurfunks. Nicht von ungefähr, denn neben den diversen
äußeren Bedrohungen leidet der Amateurfunk offenbar unter einer gewissen
inneren Aushöhlung und einem Mangel an Attraktivität, der auch eine
Ursache für die unbestreitbaren Nachwuchssorgen darstellt.
Im Informationszeitalter und bei Konkurrenz des Internets, das ja wie der
Amateurfunk in seinen Diskussionsforen Zufallskontakte bietet, läßt sich die
Faszination früherer Jahre, vor allem für potentielle Einsteiger, nicht mehr
so leicht vermitteln.
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einen sicher provozierenden
Gedanken äußern, der mir beim Verlassen einer einschlägigen Mailbox in
den Sinn kam: „Packet-Radio ist kein Amateurfunk“. Zur Erklärung: Wenn die
Funklinie zum heimatlichen Digipeater erst einmal steht, muß ich nur noch
die FM-Funke einschalten, und der Rest unterscheidet sich kaum noch vom
Einloggen in eine Telefonmailbox oder dem Surfen im Internet. Das mögen
auch jene bedenken, die meinen, Telegrafie ist out, nur noch moderne
digitale Übertragungsarten zählen – übelmeinend könnte man es vielleicht
auch lesen als „Amateurfunk ist out“.
Warum nämlich eine schwierige Prüfung ablegen, ein Funkgerät kaufen,
TVI riskieren sowie (zukünftig bestimmt höhere) monatliche Gebühren und
evtl. Klubbeiträge bezahlen? Einen Computer braucht man eh, über ein
Telefon verfügt hierzulande sowieso jeder, und die Kosten müßte man
abwägen; dafür ist bei den anderen Medien der Nachrichteninhalt weitest-
gehend
frei, und als Partner kommen nicht nur Funkamateure in Frage.
Parallelen lassen sich aus User-Sicht bei Relaisfunkstellen ziehen.
Sysops sollen sich hier absolut nicht angesprochen fühlen; gerade sie
betreiben noch Amateurfunk pur, und sie verkörpern auch den berühmten
Ham-Spirit.
Ich meine, „anders als die anderen“ ist der Amateurfunk nicht zuletzt durch
seinen experimentellen und ausgeprägter völkerverbindenden Charakter.
Zuverlässig kommunizieren kann man heute auch auf andere Weise, aber
ein ganz leises Signal (vielleicht in Telegrafie) unter Störeinflüssen doch
noch zu lesen, kaum vorhersagbare Ausbreitungsbedingungen zu nutzen,
selbstgebaute Geräte und Antennen zu testen, QSL-Karten auszutauschen,
Sammler und Jäger (oder Gejagter) zu sein, das gibt es nur beim Amateur-
funk.
Außerdem tickt kein Gebührenzähler − wer mag, kann sich Zeit lassen.
Worin sehen übrigens Sie die Faszination des Amateurfunks? Schreiben Sie uns!
Beste 73!
Bernd Petermann, DJ1TO
Die Seite der Leser
In der linken oberen Ecke der Leserpostseite prangt es − das Logo des
FUNKAMATEUR, versehen mit dem Zusatz „Postbox 73“ und unserer
Postfachadresse. Was nach Editorial und Inhaltsverzeichnis auf den
ersten Blick aussieht wie eine ganz gewöhnliche Leserpostseite,
entpuppt sich beim zweiten Hinsehen als mehr. Denn bei der Postbox,
wie wir die Seite in der Redaktion nennen, handelt es sich nicht einfach
nur um eine weitere Seite der Zeitschrift, auf der wir Leserbriefe unter-
bringen, sondern um eine Seite für die Leser. Im Grunde genommen ist
die Postbox aber nicht nur das. Sie ist vielmehr „Die Seite der Leser“
schlechthin, denn auf ihr kommen Funkamateure und Elektronikbastler,
Computerfreaks und BC-DXer zu Wort.
Hier finden Lesermeinungen und -ansichten zu bestimmten Themen ihren
Platz, wechseln sich Hilferufe auf der Suche nach Schaltungsunterlagen
ab und werden Ideen von Leser zu Leser weitergegeben. Aber auch
konkrete Hinweise veröffentlichen wir an dieser Stelle; woher beispiels-
weise englischsprachige Literatur der RSGB und der ARRL oder die
Diskette mit den Jahresinhaltsverzeichnissen des FUNKAMATEUR
bezogen werden können. Die einen oder anderen Kartengrüße so
mancher DXpedition und Murphys Gesetze, Witziges und Interessantes
runden die Seite ab.
In erster Linie ist die Postbox also ein Forum der Begegnung, gedacht
als eine Bühne des Austauschs zwischen den Lesern untereinander.
Hier können Sie kreativ werden, Ideen weitergeben und Menschen mit
den gleichen Interessen treffen − eine Möglichkeit, von der Sie meines
Erachtens viel zu wenig Gebrauch machen.
Also trauen Sie sich ruhig! Egal, ob Sie Funkamateur, Elektronikbastler,
Computerfreak oder BC-Dxer sind: Greifen Sie zum Stift oder in die
Tastatur, und teilen Sie den anderen Lesern und uns mit, was Sie in den
vergangenen Wochen Interessantes oder Witziges rund um Ihr Hobby
erlebt oder beobachtet haben. Geben Sie Ihre Erfahrungen beim
Antennenbau sowie Tips und Tricks rund um die Amateurfunktechnik
weiter. Profitieren Sie von den Ideen gestandener Elektronikbastler und
den Beobachtungen anderer BC-DXer. Teilen Sie uns einfach Ihre
Meinung zu aktuellen Themen, die Ihr Hobby betreffen, mit. Und
natürlich sind wir daran interessiert, was wir noch besser machen
können. Wichtig hierbei ist, daß Sie Ihre Meinungen oder Kommentare,
Lob und Tadel, Erfahrungen oder Ideen kurz und knapp zu Papier
bringen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, und Sie können
sicher sein, daß Ihr Schreiben auf einer der nächsten Leserpostseiten
Berücksichtigung findet.
Also schreiben Sie uns! Zu erreichen sind wir über die Adresse
Redaktion FUNKAMATEUR, Postfach 73, 10122 Berlin,
Fax (0 30) 44 66 94 69, Packet-Radio DF0FA@DB0GR.DEU.EU,
die Homepage http://www.funkamateur.de, die e-mail-Adresse
101672.1203@compuserve.com und unter CompuServe 101672,1203.
Ihre
Katrin Vester, DL7VET
Fünfzehn Jahre IBM-PC
Am 12. August 1981, vor 15 Jahren also, stellte IBM seinen ersten Personal
Computer vor − ein mit 4,77 MHz getakteter 8/16-Bit-Rechner, dessen
Herz, ein 8088 von Intel, mit 4,77 MHz schlug. Als Massenspeicher stand
eine ergiebige Floppy mit 160 KB zur Verfügung – Festplatten waren sünd-
haft teuer, und dabei unterstützte das stark CP/M entlehnte PC-DOS 1.0
gar keine Verzeichnisse.
Als ich 1989 mit einem PC in Berührung kam, einem DDR-Klone, durfte ich
bereits mit enormen 640 KB und einer 20-MB-Festplatte arbeiten − ein
Genuß im Vergleich zu den (zuvor heißgeliebten) Heimcomputern, bei
denen die 16-KB-Erweiterung und der genaue Bandzählerstand das Maß
aller Dinge waren. Mit dem Kommen der D-Mark in die fünf neuen Länder
war eine meiner ersten Investitionen ein 286er, mit einem ganzen Megabyte
RAM und 40 MB an Festplattenspeicher, der erst nach etlichen Monaten
knapp wurde.
Aber die Ansprüche wuchsen rasch: Das Topmodell von 1992, ein 386-40,
ist heute vielleicht noch ein paar hundert Mark wert. Selbst einen für 1994
pfeilschnellen Pentium-60 bekommt man nicht mehr als Neugerät zu kaufen.
Und ich hoffe, mit den frisch erworbenen 32 MB RAM auf absehbare Zeit
über die Runden zu kommen. Richtig schneller sind PCs aber dennoch
nicht geworden: Die Hardware hinkt immer hinter Software-Monstern wie
Windows 95 und OS/2 her.
Vor zehn Jahren gaben wir uns mit Farbfernseher, Golf und 16 KB
zufrieden; heute sind es möglicherweise noch derselbe Farbfernseher
und derselbe Golf, aber 16 MB. Vor fünf Jahren war eine 40-MB-Festplatte
die größere Alternative; heute beginnt die Palette bei 800 MB.
Die PC-Branche ist eben anders: Alle ein bis zwei Jahre wird eine komplette
Renovierung der Innereien fällig. Über den Wunsch nach einer Beratung im
Geschäft oder gar einer „Probefahrt“ pflegen Verkäufer nur müde zu lächeln.
Ständig dringen neue Standards − VGA, PCI, PCMCIA − ins Ohr, die vielleicht
mal wichtig sein können (EDO-RAM oder Pipeline Burst Cache?). Egal, wir
schlucken’s erstmal. Windows 95 um Jahre verschoben, na und. Neue
Textverarbeitung hat etliche Bugs; was kann ich schon machen.
Schön, daß es einen Standard gibt, der tatsächlich weltweite (breite?)
Kompatibilität bietet und außerdem über 15 Jahre hinweg nicht zum
rigorosen Systemwechsel zwang. Dumm gelaufen aber, daß gerade der
IBM-PC zum Standard avancierte, nach dem sich auch ein Jahrzehnt
später noch alle Nachfolgegenerationen richten. Zur multimedialen
Spielwiese wurde ebendieses Standardgerät erklärt − obwohl es dafür
ungeeigneter ist als alle anderen: Wir haben geschluckt und EMS-Treiber
eingebunden, auf VGA-Karten aufgerüstet, auf Super-VGA, auf 3,5"-Laufwerke,
auf CD-Drive, auf Soundkarte, auf Stereo-Soundkarte, auf General-
MIDI-Soundkarte, und mit einer 3D-Beschleunigerkarte schafft es der PC
vielleicht, dieselben schnellen 3D-Figuren anzuzeigen wie eine gängige
400-Mark-Spielkonsole, wenngleich für Vollbild-Video auch noch ein
entsprechender Chipsatz vonnöten ist.
Zum Dank für die nie endenden Investitionen und immerwährende
Kompromisse laufen Programme für den Ur-PC auch noch auf modernen
Pentium-Rechnern. Doch ein zu hoher Preis?
Ihr
René Meyer
Internet(tigkeiten)
Glückwunsch zum Start ins WWW. Toll, daß es den FUNKAMATEUR
auch endlich im Internet gibt. Jetzt ist mein so begehrtes Amateurfunk-
Magazin mit einer eigenen Homepage online. Herzlich willkommen im
Netz…
Lang ist die Liste der Gratulanten, die es sich nicht haben nehmen
lassen, unserer Zeitschrift einen Online-Besuch abzustatten und mal
kurz bei http://ourworld.compuserve.com/homepages/funkamateur/
„vorbeisurften“. Wir haben uns dem Zeitgeist und vielen Leseranfragen
nicht verschlossen und können bereits jetzt feststellen, daß unser
neuer Service im Netz der Netze durchaus ankommt.
Und doch muß aus aktuellem Anlaß einmal mehr betont werden: Mit
der FUNKAMATEUR-Homepage bieten wir einen unentgeltlichen
zusätzlichen Info-Service, der erhöhten Arbeitsaufwand und auch
Kosten verursacht. Dies mögen bitte all diejenigen zur Kenntnis
nehmen, die immer gleich alles, auf der Stelle und sowieso völlig
kostenlos fordern.
Keine Frage, wir stellen uns durchaus vor, zukünftig mit immer mehr
nützlichen Informationen, Daten und Fakten unseren Lesern auch im
Internet zur Verfügung zu stehen, so daß für viele Nutzer dann der
Kontakt mit dem FUNKAMATEUR zum Ortstarif möglich wird. Nur − es
macht halt einen kleinen, aber wesentlichen Unterschied, ob wir unsere
Zusatzdienstleistung zur Zeit zum für uns günstigen CompuServe-Tarif
anbieten können oder einem Provider dafür monatlich einen größeren
Betrag plus mengenabhängiger Datentransfer-Provision überweisen
müssen. Hier zeigt sich auch ein Dilemma. Je mehr auf unsere
Informationen zugegriffen wird, desto höher werden unsere Kosten.
Okay, ginge es dabei um gewinnträchtige Verkaufsangebote − Sie aber
erwarten von uns Listings, Datenblätter und dergleichen.
So werden wir also in den nächsten Monaten beobachten, wie sich
die Akzeptanz der FA-Homepage entwickelt. Es wird also von Ihnen
abhängen, liebe Leser, in welchem Tempo wir unsere Internet-
Aktivitäten ausbauen und wann wir auf die virtuelle „Nobeladresse“
www.funkamateur.de mit eigener Domain umsteigen.
Die momentan zur Verfügung stehenden 1 MB reservierter Serverplatz
stellen also sicher nur eine Interimslösung dar. Ihre Meinungen und
Vorschläge sind gefragt. Unsere e-Mail-Adresse kennen Sie…
Ihr
Dr. Reinhard Hennig
P.S. Unser reichhaltiger Software-Pool steht, nebenbei bemerkt, auch
weiterhin in der FA-Mailbox allen Anrufern zur freien Verfügung. Mit
einem einigermaßen flinken Modem relativiert sich da auch das Problem
des Ferntarifs der Telekom, zumal, wenn man sich vorher die Dateiliste
saugt und dann ganz gezielt auf bestimmte Files zugreift.
Nachwuchs fördern!
Funkamateure, die schon in jungen Jahren von diesem interessanten
Hobby angetan waren, kennen das Problem: Anfangs stand noch genug
Zeit zur Verfügung, aber es fehlten ganz einfach die Mittel, zu einem
Funkgerät zu kommen. Später war man besser bei Kasse, das eine oder
andere Gerät stand im Regal, aber die Zeit wurde immer knapper, und
man dachte wehmütig daran, was damit früher anzustellen gewesen
wäre. Bei anderen aber erlosch das Interesse mangels Masse bzw.
wandte sich anderen Dingen zu. Die zu Recht beklagten Nachwuchs-
sorgen haben also auch ihren materiellen Aspekt.
Andererseits stehen im Shack besagten längergedienten Funkamateurs
bestimmt noch ein paar ältere Kästchen, die, obwohl noch völlig intakt,
durch etwas Moderneres ersetzt oder durch einen mehr oder weniger
bedeutsamen Fehler aus dem Rennen geworfen wurden.
Aktuelle Gerätetypen glänzen neben nützlichen auch mit vielen durchaus
entbehrlichen Features, sind bedienfreundlicher und oft auch kleiner als
ihre Vorgänger. Trotzdem: Die alten beherrschen die Grundfunktionen,
erzeugen Sendesignale, die sich nicht von denen modernerer unter-
scheiden und sind auch empfangsmäßig prinzipiell o. k.
Die Idee: Warum sollten sich nicht Oldtimer von ihrem älteren, nicht
mehr genutzten, aber noch intakten oder mäßig reparaturbedürftigen
Equipment trennen, dabei auf den möglichen geringen Flohmarkt-Erlös
verzichten, um so dem Nachwuchs, Schülern, Azubis und Studenten
per Leihgerät den Weg zu unserem Hobby zu ebnen? Wir denken dabei
zuerst einmal an Handys, Mobilstationen und KW-Transceiver.
Daß so etwas funktionieren kann, zeigen erste positive Reaktionen von
Geräteimporteuren, von denen mündliche Zusagen vorliegen, bei der
Reparatur und Wiederinbetriebnahme in Form von Ersatzteilen und
technischen Dokumentationen Hilfe zu leisten.
Natürlich gehört zu solch einem Vorhaben ein „Management“: Es muß
einen Sammelpunkt und Lagermöglichkeiten für solche Spenden geben,
Reparaturen wären zu organisieren und ein Modus für die Vergabe
(vielleicht für einen Zeitraum von zwei Jahren) zu finden. Der Bedarfs-
nachweis könnte über Kopien von Ausbildungs- bzw. Studienbescheinigungen
sowie der Amateurfunkgenehmigung erfolgen, bei Schülern sollten die
Eltern bürgen usw.
Vielleicht engagieren sich existierende Amateurfunkgruppierungen
in dieser Sache? Der DARC mit seinen Referaten und Ortsverbänden,
TJFBV, AATiS… − oder es gründet sich gar ein einschlägiger Förderverein?
Der FUNKAMATEUR jedenfalls ist bereit, sich für ein solches Projekt
einzusetzen − durch Propagierung von Akivitäten, publizistische
Unterstützung, Hilfe bei der Koordinierung, die Veröffentlichung von
Spendern u.a.m. Insofern wären uns Mitstreiter, insbesondere aus
dem Berliner Raum, sehr willkommen.
Bitte lassen Sie uns auch I h r e Vorstellungen, Vorschläge, Bereitschafts-
erklärungen zukommen.
Beste 73!
Bernd Petermann, DJ1TO
Kleingeist contra Toleranz?
Vor kurzem erreichte die Redaktion des FUNKAMATEUR ein Brief, der
auf „Entgleisungen“ deutscher OMs aufmerksam macht, derer man sich
„als Funkamateur und Deutscher einfach schämen“ muß. Die Rede ist
von eindeutigen Zweideutigkeiten, die mitunter via Relais oder auf
Direktfrequenzen zu hören sind. Aber nicht nur dort, auch auf dem
80-m-Band war ähnliches zu empfangen. Man äußert sich zwar nicht
unbedingt geradeheraus, aber doch − durch die Blume − in unmiß-
verständlicher Art und Weise.
Was hier auf Amateurfunkfrequenzen stark an Stammtischparolen
erinnert, hat so manche Parallele zur großen Politik. Erst unlängst gab
sich der Spitzenpolitiker einer bekannten Partei in seiner Wahlrede als
Populist zu erkennen, als er die Stimmung gegen Ausländer anzuheizen
versuchte.
Zwar garantiert Art. 5, Abs. 1, S. 1 (1. Halbsatz) GG das Recht auf freie
Meinungsäußerung („Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten…“), die Grenzen sind
jedoch dort erreicht, wo die Rechte anderer, beispielsweise das Recht
der persönlichen Ehre (Art. 5, Abs. 2 GG), verletzt sind.
Das Gesetz über den Amateurfunk beschränkt in seiner Durchführungs-
verordnung den Inhalt der Aussendungen im Amateurfunk zusätzlich
„auf technische Mitteilungen über die Versuche selbst sowie auf
Bemerkungen persönlicher Art“ (§ 7 Abs. 2, 1. Halbsatz DV-AFuG).
Fremdenfeindliche Bemerkungen, egal in welcher Form, fallen mit
Sicherheit nicht darunter! Im Gegenteil. Derartige Äußerungen müssen
als politisches Bekenntnis verstanden werden − und das hat im
Amateurfunk nichts zu suchen!
Zum Selbstverständnis des Amateurfunks gehört seit seinen Anfängen
die weltweite Verständigung − unabhängig von Rasse, Religion oder
Geschlecht. Gerade wir Funkamateure haben daher die Gelegenheit,
über Sprachbarrieren und Kulturschranken hinweg mit Menschen aller
Kontinente unmittelbar in Verbindung zu treten und Freundschaften zu
schließen. Diese Chancen, die auch für das gesellschaftliche Ansehen
des Amateurfunks und seine Zukunft wichtig sind, sollten wir durch
Kleingeist und Intoleranz nicht schon im Vorfeld zerstören!
Aber nicht nur der Möglichkeiten, auch der Verantwortung sollten wir uns
bewußt sein, denn uns hört die ganze Welt! Die Parole lautet bei fremden-
feindlichen Äußerungen daher nicht „Weghören!“, sondern „Eingreifen!“,
denn gegen Ausländer oder Fremde gerichtete Entgleisungen dürfen wir
uns weder als Funkamateure noch als Deutsche leisten.
Übrigens: Eine gute Möglichkeit, einmal mehr zu zeigen, was wir
deutschen Funkamateure unter Hamspirit verstehen, bietet sich auf
der diesjährigen Ham Radio in Friedrichshafen am Bodensee, zu der viele
Gäste aus aller Welt erwartet werden.
Was mir dazu einfällt? Herzlich willkommen in Deutschland! Herzlich
willkommen in Friedrichshafen!
Ihre
Katrin Vester, DL7VET
Wer will den Internet-PC?
Glaubt man den Plänen einiger großer Computerunternehmen, wird er
der Renner der nahen Zukunft: Ein kleines, preisgünstiges Gerät ohne
Festplatte und Diskettenlaufwerk, nur mit Arbeitsspeicher, Grafikkarte
und rudimentärem Betriebssystem ausgestattet. Und einem Internet-
Anschluß. Benötigte Software lädt man „einfach“ aus dem Netz der Netze.
Vereinfacht wird das Verfahren durch Java − eine C-ähnliche Programmier-
sprache, die einzelne Module, sogenannte Applets, ohne viel Federlesens
einer Anwendung hinzufügt.
Sun hatte auf der CeBIT einen Prototyp des Internet-PCs im Gepäck,
das Java Device. Nicht als Produktankündigung, sondern als Beispiel,
wie der Internet-PC aussehen könnte (folgerichtig funktionierte das Ding
auch nicht, als es sollte). Oracle hat dagegen konkrete Pläne, wie ihr
Network Computer aussehen soll: Ein integriertes Softwarepaket namens
Java Works, an dem Oracle gerade bastelt, soll integriert werden. Die
Verbindung mit dem Netz wird mit Hilfe des allgegenwärtigen WWW-
Browsers Netscape aufgenommen. Auch IBM und einige kleinere
Anbieter arbeiten an derartigen Rechnern − von Spielkonsolen, die mit
Internet-Anschluß ausgerüstet werden sollen, einmal abgesehen.
Prognosen sind in der Welt der Computer sehr riskant. Dennoch: Für den
Privatgebrauch ist ein derartiges Gerät unsinnig und kann sich nicht
durchsetzen. Es ist kaum billiger als ein Desktop-PC − mittlerweile spricht
man nicht mehr vom 500-$-, sondern (mindestens) vom 1000-$-PC − und
verursacht ständig Telefongebühren. Wer will sich immer das Textprogramm
bei Bedarf kostenpflichtig laden, wenn er die Software auch als Zugabe
zum neuen Drucker haben kann? Wer will persönliche Briefe und die
Steuererklärung auf einem entfernten Server ablegen? Und das Argument
„immer das neueste Update“ sollte auch nicht in jedem Fall ziehen, denn
wer möchte alle paar Monate umlernen (ich arbeite seit drei Jahren mit
einer DOS-Textverarbeitung)?
Ganz anders hingegen der Einsatz des Internet-PCs als Server in der Firma.
In Unternehmen macht der Gedanke, alle Daten von einem Server zu
laden und auf einen zu speichern, viel Sinn. Updates werden einfach
aufgespielt, lästiges Konfigurieren von CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT
und Windows entfällt. Und vor allem: Dank des fehlenden Diskettenlauf-
werks schleppen die Mitarbeiter keine Viren ins System oder verbringen
ihre Zeit mit Spielen.
Immer mehr Unternehmen nutzen die Technik des Internets für ein
internes Datennetz. Dieses autarke Netz, das sogenannte Intranet, kann
bei Bedarf ans Internet angeschlossen werden. Die Technik des Intranets
scheint derzeit äußerst zukunftssicher: Jedes Tool, das fürs Internet
geschrieben wurde, jeder WWW-Browser und jeder HTML-Standard
funktioniert auch im Intranet. Genau wie im großen, können auch im
kleinen Elemente wie Diskussionsforen, Anschlagbretter oder Software-
Archive aufgebaut und genutzt werden. Das funktioniert mit Mac, Unixund
IBM-PC sowohl in lokalen Netzen als auch weltweit über das
Telefonnetz − somit können Niederlassungen eines Konzerns einfach
miteinander kommunizieren und von gegenseitigen Erfahrungen
profitieren.
Ihr
René Meyer
Wieviel Online darf’s denn sein?
Verfolgt man die entsprechenden Veröffentlichungen in den Medien,
so scheint eine neue Krankheit ausgebrochen zu sein − die Onlinesucht.
Was aber steckt an wirklich brauchbarer Substanz hinter dem ganzen
multimedialen Rummel, der um das goldene Kalb „Onlinedienste“
gemacht wird? Brauche ich tatsächlich CompuServe, Internet, Europe
Online und wie sie alle heißen, um nicht hoffnungslos auf der Strecke
zu bleiben? Jedenfalls wird diese Botschaft beständig aus allen
möglichen Artikelserien suggeriert. Da ist es einem beinahe schon
peinlich, wenn man keine Internet-Adresse auf der Visitenkarte
vorzuweisen hat. Online sein ist heute „in“. Die Party findet nur noch
im Cyberspace statt. Man redet nicht miteinander, man „chattet“.
Wieviel Online darf’s denn sein? Einverstanden, BTX, jetzt T-Online,
verwende ich regelmäßig fürs Homebanking, ganz praktisch − aber das
war’s dann auch fast schon. Einkaufen gehe ich persönlich immer
„offline“ und auch bezüglich der Urlaubsreise lasse ich mich lieber in
einem Reisebüro von Mensch zu Mensch beraten, statt auf Mausklick
zu buchen. CompuServe-Account? Ist bisher auch nicht das Gelbe.
Kaum ein paar e-Mails in der ganzen Zeit − und die vielen Supportund
Diskussionsforen sind eh’ zumeist auf amerikanische Interessen
ausgerichtet.
Auch das Argument der immerwährenden aktuellen Datenverfügbarkeit
in den Netzen sticht nicht. Wer installiert schon alle paar Tage die jeweils
neueste Treiberversion des 08.15xx-Festplattenverwutzelers oder
downloaded unentwegt Shareware-Programme, die sich auch zu
Hunderten auf jeder CD-ROM wiederfinden? Und nicht zu vergessen − der
Online-Spaß kostet schließlich auch Bares. Für nur gelegentliche Chatts
rentiert sich da schon fast wieder die Telekom. Ruf doch mal an…
Aber jeder kann ja selbst entscheiden, wie sinnvoll die Teilnahme an
einem Onlinedienst für sich persönlich ist. Unbestritten: Der derzeitige
Nutzen liegt in der Möglichkeit, sich über alle möglichen und unmöglichen
Dinge in den Netzen informieren zu können und sich weltweit auszu-
tauschen. Das fördert den Dialog und das gegenseitige Verständnis.
Come together! Netsurfer und Online-Chatter sind schon in gewisser
Weise Idealisten und natürlich macht’s ja auch Spaß. Trotzdem bleibt, wie
auch immer, festzustellen − für die Allgemeinheit sind wirklich nutzbare
praktische Anwendungsbereiche bis heute nicht so richtig auszumachen.
Fest steht: Die Zukunft der Netzanwendungen wird sich nicht in e-Mail
und Netsurfing allein erschöpfen. In Amerika ist man in dieser Hinsicht
schon bedeutend weiter. Es gibt dort bereits Firmen, die fast nur noch
„virtuelle“ Angestellte haben. Internet und billige Telefontarife machen’s
möglich. Effektiv ist es auch. Hat Kollege X in New York Feierabend, holt
sich Kollege Y in Anchorage das Programmlisting auf den Schirm, nachdem
er vom Frühstück gekommen ist. Vierundzwanzig Stunden effektive
Arbeitszeit pro Tag sind praktisch drin − und das ohne Schichtsystem…
In Deutschland steckt man da erst in den Kinderschuhen. Statt die
weltweite Vernetzung als innovatives und produktives Potential zu
begreifen und zu nutzen, diskutiert man hier immer noch lieber darüber,
welche „Schmuddelforen“ und Newsgroups besser als nächstes zu
zensieren und zu sperren wären. Na dann − guten Morgen!
Ihr
Dr. Reinhard Hennig, CIS 101675, 2637
Was nützt es, recht zu haben? oder: Viele Hunde sind des Hasen Tod
Eher unauffällig gab im Mai vorigen Jahres eine Amtsblattverfügung des
Bundesministeriums für Post und Telekommunikation die Nutzung des
70-cm-ISM-Bereichs für sogenannte Low Power Devices (LPD) frei,
konkret Alarmanlagen, Fernwirken, Übertragung von Audio- und
Videosignalen, Datenübertragung und -kommunikation für den
Hausgebrauch, aber sogar Kransteuerungen sollen dem Vernehmen
nach auf dieser Basis arbeiten.
In besagtem Frequenzbereich ist jedoch der Amateurfunkdienst primärer
Nutzer, und die LPDs genießen ausdrücklich keinerlei Schutz vor
störenden Beeinflussungen durch Amateurfunkstellen, was denn wohl
auch irgendwo in den LPD-Bedienungsanleitungen vermerkt ist. Den
meisten Wirbel verursachte in Amateurfunkkreisen zunächst die
Nutzung durch CB-ähnliche Sprachkommunikation, verbunden mit dem
Sub-Problem der Berührung jener mit dem im selben Frequenzbereich
angesiedelten Amateurfunk. In dieser Sache läßt sich von den lizenzfreien
Sprechfunkern immerhin noch ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen
in die Problematik erwarten, zumal die Möglichkeit besteht, auf eine
andere Frequenz auszuweichen.
Bedrohlicher sieht es nach meinem Empfinden inzwischen schon mit
Fernwirk-, Datenübertragungsgeräten oder drahtlosen Kopfhörern aus.
Deren Eigentümer haben durchaus nennenswerte Summen für ihre
störempfindlichen Gerätschaften ausgegeben und erwarten dafür − wie
bei jeder Ware – einwandfreie Funktion. Nun muß der arme Funkamateur
seinem Nachbarn klarzumachen versuchen, daß er ja nur ein unzuverlässiges
Spielzeug erworben hat und besser daran täte, sein Garagentor
mit einer neuen Anlage per Infrarot zu öffnen oder sich mit dem
gelegentlichen Dröhnen seiner Alarmanlage abzufinden. Daß sogar
Kransteuerungen mit LPDs arbeiten sollen, dürfte schon nicht mehr als
grobe Fahrlässigkeit abgehen, aber Richter sehen das, gar nach einem
Unglücksfall, wohl nicht unbedingt zugunsten des beeinflussenden
Funkamateurs.
Unbegreiflich ist eigentlich der im Januar-Sonderrundspruch des DARC-
Vorsitzenden, Dr. Horst Ellgering, DL9MH, erwähnte Fall, bei dem eine
Packet-Radio-Broadcast-Genehmigung für einen Funkamateur vom BAPT
zurückgezogen wurde, weil dessen gesetzeskonforme Aussendungen die
Funktion einer Garagen-Zugangseinrichtung beeinträchtigte und letztlich
sogar alle weiteren Anträge auf Eis gelegt wurden.
Das Ganze erinnert fatal an die S6-Problematik, bei der die Verantwortung
greifbarer Institutionen an der Hausübergabestelle aufhört, massive aktive
und passive Störungen auftreten und praktisch nichts zugunsten der
rechtmäßigen Nutzer des Frequenzbereichs geschieht.
Der Funkamateur sieht sich in die Defensive gedrängt, weil er sich in der
Regel nicht mit einer Übermacht von Nachbarn anlegen möchte. Das
geschieht schon oft genug bei der Beeinflussung nicht ausreichend
einstrahlungsfesten Elektronikgeräten. Aber hier ist die Sachlage noch
eindeutiger: Eine Minderheit braucht den ihr zustehenden Schutz durch
BMPT und BAPT. Was nützt es, recht zu haben? Vermutlich eine Menge,
wenn diese Institutionen ihn auch gewähren und nicht wirtschaftlichen
Interessen nachgeben würden.
Beste 73!
Bernd Petermann, DJ1TO
Lektion in Sachen Marktwirtschaft
„Die Tarifreform der Deutschen Telekom ist besser, als Sie denken.“ −
So lautet der Werbeslogan der Telekom, die gleich zu Beginn des Jahres
durch ihre Tarifreform von sich reden machte. Seit 1. Januar soll −
glaubt man der Reklame − Telefonieren gerechter sein; die Reform eben
besser, als wir denken.
Die Telekom ging − nachdem das Telekommunikationsmonopol zuvor
gelockert worden war − 1990 als selbständiges Unternehmen aus der
Deutschen Bundespost und der Deutschen Post hervor. Als die
EU-Kommission im Zuge der europäischen Einheit 1993 die Liberali-
sierung des Telekommunikationsmarktes beschließt, wird aus dem
Unternehmen 1994/95 eine Aktiengesellschaft.
Die Entscheidung der EU-Kommission führt nun dazu, daß die Aktien-
gesellschaft Mitte des Jahres ihr Netzmonopol verliert. Das bedeutet,
daß private Telefongesellschaften künftig firmeninterne Telefonnetze,
sogenannte Corporate Networks, nicht mehr über teure Mietleitungen
der Telekom aufbauen müssen, sondern eigene Leitungen verlegen
dürfen.
Folgt nach dem Börsengang des Unternehmens im November dieses
Jahres schließlich im Januar ’98 die Freigabe des Telekommunikations-
marktes, fällt das Monopol der Telekom endgültig. Wenn jetzt noch
der Bundestag den Gesetzentwürfen des Postministers zustimmt,
kann ab 1998 jede Firma ins Telefongeschäft einsteigen, sofern sie
bestimmte Standards − etwa in Fragen der Netzsicherheit oder des
Datenschutzes − einhält.
Ohne Zweifel, der Weg der Telekom in die Marktwirtschaft ist kostspielig.
Den Milliardenbeträgen, die zu investieren sind, steht ein Schuldenberg
von 126 Milliarden DM gegenüber. Um sich jedoch behaupten zu können,
will die Telekom alte Serviceleistungen verbessern, neue Dienstleistungen
anbieten und nicht zuletzt Arbeitsplätze abbauen. Da die Kassen leer sind,
setzt das Unternehmen verstärkt auf die Kunden. Sie sollen nicht nur für
den Kontakt zu Freunden und Verwandten zur Kasse gebeten werden,
sondern demnächst auch in Aktien der Gesellschaft investieren.
Unklar jedoch bleibt, wie die Telekom die Kunden halten will, die sie
braucht, um sich der künftigen Konkurrenz zu erwehren. Statt die Karten
auf den Tisch zu legen, verkauft das Unternehmen seine Kunden für dumm;
denn Ortsgespräche, die länger als vier Minuten dauern, sind grundsätzlich
teurer als zuvor. Der Kontakt zu Freunden und Verwandten, sprich dem
sozialen Umfeld, ist nun mehr denn je eine Frage des Geldes. Und mit dem
preiswerten Zugang auf die Datenautobahn über das Ortsnetz ist es vorbei.
Aber zum Glück hängt es ja von jedem Kunden selbst ab, wie seine
nächste Telefonrechnung ausfällt, höhnt die Telekom.
Also faßt man sich nicht nur kurz, sondern verschiebt Telefonate generell
auf die Zeit nach 21 Uhr. Wir ändern unsere Lebensgewohnheiten und
hoffen, daß die Reportage im Fernsehen möglichst spät beginnt und wir
die Augen dann noch offenhalten können; vielleicht ändert ja auch das
Fernsehen seine Programmstruktur. Wochentags kann man sich notfalls ja
auch den Wecker auf 2 Uhr stellen, respektive das Telefon dicht ans Bett.
Bei der Telekom aber bedanken wir uns derweil für die Lektion in Sachen
Marktwirtschaft, die uns − entsprechend unserem Telefonierbedürfnis −
teuer zu stehen kommt.
Ihre
Katrin Vester, DL7VET
Das fängt ja gut an…
Sind Sie gut über die Feiertage gekommen ? Schön ! Und was machen
Ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr… ? Wir jedenfalls werden auch in
diesem Jahr weiter daran arbeiten, dem gerecht zu werden, was Sie zu
Recht von uns erwarten – fundierte Sachinformationen, nachbausichere
Bauanleitungen und interessante Tips und Kniffe aus unserer gesamten
Themenvielfalt. Und an Themen wird es uns auch 1996 sicherlich nicht
mangeln. Das Jahr fängt ja diesbezüglich auch schon gut an. Nehmen wir
zum Beispiel die Telekommunikation.
Die Telekom nämlich langt mit Jahresbeginn beim Telefonieren kräftig zu:
Ferngespräche sind zwar etwas verbilligt worden, Ortsgespräche haben
sich aber erheblich verteuert. Zwar bewirbt die Firma mit dem lila „T“ die
Preissenkung der Gesprächsgebühr, allerdings hat sie auch den Zeittakt
stark verkürzt. Damit gewinnt zwar der alte Post-Slogan „Fasse Dich kurz“
wieder sehr an Attraktivität, meist wird man wohl aber seine Telefonier-
gewohnheiten doch nicht so rasch ändern. Im Endeffekt bedeutet das
somit nur eine versteckte Preiserhöhung. Und damit man das auch nicht
so schnell durchschauen kann, wurde alles noch in eine verwirrende
Tarifstruktur eingebettet. Für den ausdauernden „Internet-Surfer“ oder
CompuServe-User ist damit Nachtschicht am PC angesagt − die Zeit
zwischen früh um zwei und morgens um fünf ist tariflich am günstigsten.
Manche Online-Anbieter denken jetzt schon darüber nach, ihre Kunden
mit kostenlosen 0130er Nummern anzubinden und langfristig durch den
Informationsverkauf auf ihre Kosten zu kommen.
Im PC-Bereich selbst haben sich ja inzwischen die neuen Fenster in die
schöne, bunte Datenwelt weit aufgetan. Adieu, DOS − willkommen
Windows ’95. Früher oder später kommt man wohl kaum noch an
Bill Gates’ neuem Kassenfüller als künftigem Betriebssystem-Standard
vorbei. Bereits jetzt gibt es häufig beim Rechnerkauf das gute alte DOS
nur noch gegen Aufpreis. Doch vor Plug & Play, Multitasking und Online-
Papierkorb heißt es, auf Kompatibilität zu hoffen. Wenn die Hälfte der auf
der heimischen Festplatte vorhandenen Programme nach der Installation
plötzlich Laufprobleme hat, geht die Jagd nach aktuellen Gerätetreibern
los. Der fortschrittshungrige PC-Power-User hingegen sucht ab sofort nur
noch nach Produkten mit der Kennzeichnung „Designed for Windows ’95“.
Doch schon gibt’s was Neues, nach „Chicago“ läßt nun „Nashville“ grüßen.
Microsoft wird möglicherweise 1996 noch mit einem Korrekturpack für
Win95-Bugs rüberkommen, danach steht aber bereits die nächste
Betriebsystemgeneration (1997 ??) ins Haus, die sich in puncto System-
sicherheit noch stärker an Windows NT orientieren soll.
A propos Kennzeichnung: Gekennzeichnet sein müssen ab Januar auch
alle Geräte, die irgendwie mit dem Thema EMV in Verbindung zu bringen
sind. Das CE-Kennzeichen ist nunmehr die offizielle Eintrittskarte für den
europaweiten Handel mit elektr(on)ischen Geräten und Baugruppen, was
sicherlich den europäischen Binnenmarkt beleben wird.
Gerade richtig kommt da die neue Generation der nun auch in
Deutschland zugelassenen 80-Kanal-CB-Funkgeräte, die das Geschäft
mit dem „Jedermann-Funk“ kräftig ankurbeln sollen. Auf den bis dato
genehmigten 40 Kanälen ist es ja inzwischen, besonders in Großstädten
und Ballungsräumen, doch schon recht eng geworden.
Wir werden an aktuellen und wissenswerten Themen dranbleiben.
Begleiten Sie uns auch 1996 so aktiv und interessiert wie bisher.
Allen Lesern unserer Zeitschrift ein erfolgreiches neues Jahr.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Zur Beratung zurückgezogen
Etwas überraschend ist sie schon, die Ruhe, die ziemlich unvermittelt
nach der Stellungnahme des Runden Tisches Amateurfunk, RTA,
zum Entwurf eines neuen Amateurfunkgesetzes (s. FA 10/95, S. 1035)
eintrat. Nach Aussagen seines bedeutendsten Mitgliedes,
des DARC e.V., hatten sich immerhin etwa tausend Funkamateure
aus seinen Reihen an der Diskussion über den Entwurf beteiligt.
Nachdem die Vorschläge in verschiedenen Arbeitsgruppen
zusammengeführt und beraten worden sind, lagen sie Anfang Oktober
mit verschiedenen Erläuterungen (s. auch FA 12/95, S. 1252) auf dem
Tisch des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation.
Wie damit verfahren worden ist, mögen bis auf weiteres bestenfalls
Insider ahnen. Nach außen herrscht jedenfalls erst einmal für eine Weile
Windstille, und so wandten sich die Gespräche unter den Funkamateuren
schnell wieder anderen Themen zu.
Doch bleibt es interessant, über die Aufnahme der RTA-Vorschläge
beim BMPT zu mutmaßen: In der schriftlichen Gegenüberstellung
des ursprünglichen Entwurfs und seiner entsprechend den Vorstellungen
des RTA geänderten Fassung (Synopse) findet man von den ursprüng-
lichen 53 Absätzen und Unterabschnitten gerade 14 völlig unverändert.
Andererseits wurde der BMPT-Entwurf durch die vorgeschlagenen
Änderungen, Streichungen, Ergänzungen und Umverteilung von Inhalten
ja nicht etwa völlig auf den Kopf gestellt.
Auch aus der Sicht „des Rests der Welt“ sollte das abgewandelte
Dokument, finde ich, weitestgehend akzeptabel sein. Schließlich richten
sich die darin niedergelegten Vorstellungen hauptsächlich darauf, das
Gesetz entsprechend der von Minister Bötsch dem DARC-Vorsitzenden
gegenüber geäußerten Zusage, daß es „auch in Zukunft keine
gesetzlichen Regelungen zum Nachteil der Funkamateure geben wird“,
zu gestalten. Den Amateurfunk als im Gesetz weiterhin als eigenständigen
Funkdienst und nicht irgendeine Funkanwendung zu definieren
und dabei auch das Bild des Amateurfunks, vor allem durch Aussagen
über seinen Wert und Nutzen in den Text einzubringen, ist legitim.
Selbstredend wurde der erklärte Zweck eines neuen Amateurfunkgesetzes,
der Entwicklung Rechnung zu tragen, erfüllt.
Vieles reduziert sich auf die Gretchenfrage: Wie steht die Genehmigungs-
behörde denn nun wirklich zu den Funkamateuren (und zu ihren Organi-
sationen und Repräsentanten)? Das BMPT hat die Betroffenen immerhin
gefragt und ihnen Zeit zur öffentlichen Diskussion gelassen. Positiv.
Andererseits ist der Amateurfunk im gesamten Funkgeschehen
ein kleiner Bereich, insgesamt weniger wichtig, was mehr Entscheidungs-
spielraum läßt. Dabei wird wiederum von den Entscheidungsträgern
eine Abwägung der Interessen sämtlicher Betroffenen erwartet.
Es ist also vieles möglich.
Um abschätzen zu können, inwieweit die RTA-Fassung Berücksichtigung
finden konnte, würde ich fragen: Wem wird damit unter Beachtung
gültiger Rechtsgrundsätze mehr als recht und billig zu nahe getreten?
Anwort siehe oben.
Bei Erscheinen dieses Editorials sollte der Gesetzentwurf bereits dem
Bundeskabinett vorliegen. Zum Frühlingsbeginn ’96 ist der RTA das
nächste Mal gefragt. Dann sind wir klüger.
Bernd Petermann, DJ1TO
Irgendwann ist (Redaktions-)Schluß
Suchen Sie einen Transceiver? Möchten Sie über besondere Aktivitäten
Ihres OVs oder die Erlebnisse Ihrer letzten DXpedition berichten? −
Einen Transceiver finden Sie am ehesten im Anzeigenteil der Zeitschrift,
für anstehende Aktivitäten empfehlen wir eine Mitteilung im DL-QTC
und auch, wenn Sie über Ihre Erfahrungen der letzten DXpedition
berichten möchten, ist der FUNKAMATEUR das richtige Medium.
Wir in der Redaktion und alle, die an der Entstehung des FUNKAMATEUR
beteiligt sind, bemühen uns, Ihren Wünschen gerecht zu werden −
nur müssen uns Ihre redaktionellen Beiträge, Mitteilungen und Anzeigen
rechtzeitig vorliegen.
Zwischen dem Erscheinen zweier FUNKAMATEURe liegen vier Wochen,
die eigentlichen Vorbereitungen für eine Ausgabe beginnen jedoch
schon viel früher, nämlich eineinhalb Monate, bevor das Heft am Kiosk
erhältlich ist. Bereits in der Vorankündigung im einen Heft äußern sich
die Gedanken der Redaktion zum Erscheinungsbild des nächsten.
Ist die eine Ausgabe „raus“, bleiben uns bis zum nächsten Redaktions-
schluß vier Wochen. − Redaktionsschluß bedeutet übrigens nicht,
wie anscheinend oft vermutet, daß die Redaktion bis zu diesem Tag
sämtliches für eine Ausgabe bestimmtes Material sammelt und erst
dann damit beginnt, die Beiträge für die Zeitschrift zusammenzustellen
und zu bearbeiten. Am Tag des Redaktionsschlusses gehen alle Filme
zusammen mit den Montageanweisungen der Seiten in die Druckerei.
Bis dahin müssen alle Berichte auf die Zeile genau stimmen, alle
Anzeigen erfaßt − kurz, sämtliche Arbeiten für eine Ausgabe abge-
schlossen sein.
Die inhaltliche Feinplanung des Zeitschriftengerüstes erfolgt unmittelbar
nach der Abgabe des vorherigen Heftes. Dabei müssen nicht nur bereits
angekündigte Beiträge berücksichtigt werden, sondern auch die Balance
der Themen, feststehende Rubriken, Fortsetzungen u.v.m. Des weiteren
gilt es, formale Kriterien wie beispielsweise Farbseiten zu beachten.
Die Präzisierung der Feinplanung wird gleichlaufend mit den Arbeiten am
Heft durchgeführt. Beiträge, die der Redaktion schon vorlagen und
bereits bearbeitet wurden, werden konkret eingeplant. Aktuelle Manu-
skripte wie die QTCs oder solche, die speziell für eine Ausgabe in Auftrag
gegeben worden, also bereits ihren festen Platz haben, erreichen uns
meistens wenige Tage vor Redaktionsschluß. Wichtig zu wissen ist
deshalb: Je näher der Redaktionsschluß, desto schwieriger sind
bearbeitete Beiträge zu ändern oder neue hinzuzunehmen.
Suchen Sie also per Kleinanzeige einen Transceiver, beachten Sie bitte
den Redaktionsschluß für Anzeigen, der jeweils im Anzeigenteil des
vorherigen Heftes abgedruckt wird! Für kommerzielle Anbieter ist ein
frühzeitiger Anruf notwendig, damit wir den Platz für Ihre Annonce
einplanen können. Für DXpeditionsberichte oder andere Beiträge des
redaktionellen Teils empfiehlt sich ein Telefonanruf schon bevor Sie Ihren
Artikel schreiben. So sind genaue Absprachen möglich.
Wie gesagt, wir möchten Ihren Wünschen weitestgehend gerecht werden,
aber bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen rechtzeitig! Denn irgendwann
ist Schluß, genauer gesagt, Redaktionsschluß, und der FUNKAMATEUR
muß in die Druckerei, damit er pünktlich bei Ihnen ist.
Ihre
Katrin Vester, DL7VET
IFA ’95 Berlin − Fazit einer Messe
Neuheiten, Neuheiten, wohin man auch schaut. Tatsächlich? Die Renner
unter den als Mega-„in“ angepriesenen Neuvorstellungen waren auf der
IFA ’95 sicherlich die Multimedia-PCs mit all ihren angebotenen Finessen,
wie z. B. Einkaufen direkt mit dem PC, dem sogenannten Tele-Shopping.
Erste Ergebnisse mit Tele-Shopping aus den USA sind jedoch
dazu angetan, die zur Schau gestellte Euphorie etwas zu dämpfen.
Auch hinter dem „großen Teich“ ist man erst in der Phase, Erfahrungen
zu sammeln.
Überhaupt: Was ist Multimedia eigentlich? Das Ineinandergreifen
verschiedenster Medien soll doch wohl vor allem der Industrie unter
die Arme greifen − aber wo bleibt da eigentlich König Kunde?
Tatsache ist, daß quasi auf der Messe niemand die „eierlegende Woll-
milchsau“ anzubieten hatte.
Sicher, viele zukunftsträchtige Ansätze wurden vorgestellt − was fehlte,
waren wirkliche Neuheiten, die auch für Otto Normalverbraucher
bezahlbar sind. Beispiel: Video on demand. Alles ist technisch
realisierbar und auch praktisch möglich − aber eben nur gegen „cash“.
Das 16:9-Breitwandformat soll ja nun allerorts schwungvollen Einzug in
die heimischen Wohnzimmer halten, geht man nach dem Willen der
Hersteller, die überall auf der IFA mit diesen Geräten präsent waren.
Heimkino ist angesagt. Der Kunde wirkt dabei jedoch recht verloren,
ja teilweise regelrecht verwirrt. Vor vier Jahren hieß das Schlagwort noch
HDTV. Doch das hat sich offensichtlich inzwischen totgelaufen. Nun wird
ihm mit dem 16:9-Breitwand-PALplus-Pantoffelkino wieder ein neues
Konsumziel präsentiert.
Oder, wie wäre es mit TV im schwungvollen Colani-Design? RFT hat recht −
dieser Fernseher sieht tatsächlich von hinten besser aus als von vorn…
Flachbildschirme und interaktives Fernsehen − aus der Glotze wird ein
Joystick! Auch diese vollmundigen Sprüche greifen vorerst nur auf
Multimedia-CD-ROMs. Natürlich könnte mit der Einführung des digitalen
Fernsehens dies auch mit dem Fernseher so werden. Aber: Wollen das
die Zuschauer wirklich? Klar ist, daß hier Bedürfnisse geweckt werden
sollen, von denen der Kunde bisher nicht einmal ahnte, daß er sie je
würde haben können.
Set-Top-Boxen bilden das Kernstück der neuen digitalen Kommunikation,
die ab Frühjahr 1996 Wirklichkeit werden soll. Man konnte aber auch hier
den Kampf um Standards und Systeme beobachten. Zur Zeit hat die
Kirch-Gruppe bei Set-Top-Boxen offenbar die Nase vorn, dennoch
bleibt es spannend, ob und wann überhaupt ein einheitlicher Standard
gewährleistet sein wird.
Viele weitere Neuheiten konnte man auf der Funkausstellung bewundern,
wie z. B. die kleinste Satellitenantenne der Welt, Car-Navigator-Systeme,
digitale Handy-Camcorder oder auch wuchtige Sound-Klangsäulen.
Es ist schön, zu wissen, daß uns künftig das Telefon nicht mehr mit
drögem Klingeln das ästhetische Empfinden beleidigen muß,
sondern Tante Frieda dann mit sattem Techno-Sound bei uns anklingeln
kann.
Warten wir ab, was uns von all dem Glanz und Glamour der diesjährigen
IFA im Alltagsleben wiederbegegnen wird. Vielleicht sieht man ja vieles
in neuem Gewand, technisch verbessert und vor allem preiswerter (!)
auf der IFA ’97 wieder!? Lassen wir uns überraschen.
Ihr
Dr. Reinhard Hennig
70 cm doch für alle?
Nachdem eine Frequenzzuteilung für den CB-Funk im ISM-Bereich des
70-cm-Amateurfunkbandes vom Tisch ist, gibt es nun eine Zulassungs-
vorschrift des BAPT 222 ZV 125 über „Funkanlagen geringer Leistung für
nichtöffentliche Zwecke in ISM-Frequenzbereichen“. Solche Low-Power-
Devices auf ISM-Frequenzen wurden per Amtsblatt-Verfügung 120/1995
des BMPT allgemein genehmigt. Also durch die Hintertür doch wieder
CB-Funk im Amateurband?
Eigentlich nicht, denn die Verfügung merkt ausdrücklich an, daß diese
Allgemeingenehmigung nicht für CB-Funkanlagen gilt. Außerdem darf die
Leistung an der Antennenbuchse 10 mW nicht überschreiten. Für die Geräte-
hersteller und den Handel bilden solche QRP-Schächtelchen für diverse
Übertragungsverfahren trotzdem einen willkommenen Konjunkturhebel (und
gute Gewinnmöglichkeiten). So wird es denn wohl zwischen 433,05 und
434,79 MHz bald in allen Tonlagen zirpen und in vielen Dialekten erzählen.
Ein 10-mW-Hemdentaschen-Handy mit exakt auf den ISM-Bereich
beschränktem Frequenzbereich, das ansonsten einem bekannten 70-cm-
Amateurgerät fast aufs Haar gleicht, wird bereits auf der IFA zu sehen (und
auszuprobieren) sein. Als Reichweite werden bis 1000 m angegeben.
Laut Presseinformation darf jedermann das Gerät ohne Genehmigung und
gebührenfrei (!) betreiben. Was ist da eigentlich generell anders als beim
CB-Funk?
Der Funkamateur wird diese Entwicklung mit vielen neuen Nutzern in einem
angestammten Frequenzbereich bestenfalls mit gemischten Gefühlen
betrachten. Nun sind 10 mW sicher nicht die Welt, wer jedoch die Praxis
des Umgangs mit „Ellas“ im CB-Funk und die unter dem Strich doch eher
geringe Gegenwirkung des Gesetzgebers kennt, kann sich schon die Inserate
ausmalen, die Zusatzkästchen zur Reichweitenvergrößerung, vielleicht unter
dem Deckmantel der Amateurfunkanwendung, anpreisen. Und es besteht
auch die Gefahr, daß 70-cm-Amateurfunkgeräte mit ihrer ja höheren Sende-
leistung unmittelbar mißbraucht werden, womöglich auch noch außerhalb
des ISM-Bereichs.
Und umgekehrt? Solch ein ISM-Handy sollte sich von Funkamateuren
durchaus gesetzeskonform auch für den Amateurfunk einsetzen lassen.
Vorteile haben sie dabei vom Kaufpreis her vorausichtlich einstweilen nicht;
nur die wechselseitige Nutzung mit einem Nichtfunkamateur könnte es dem
einen oder anderen schmackhaft machen.
Delikat auch die parallele Nutzung das ISM-Bereichs mit dem Amateurfunk.
Für den Nichtlizenzierten gibt es hier wohl keine funkbetrieblichen Beschrän-
kungen. Anders beim Funkamteur: Er darf ja nur mit weiteren
Funkmateuren arbeiten und eigentlich nicht einmal die Existenz anderer
Aussendungen Dritten mitteilen, geschweige mit den ISM-Funkern in
Verbindung treten. Da ist die Versuchung groß, trotzdem einfach das Afu-
Handy für einen Schwatz mit der unlis Ehefrau im Garten zu nutzen (damit
es nicht auffällt, natürlich ohne Rufzeichennennung). Mal schauen, wie die
Behörde damit klarkommt.
Von ihrem Status als primäre Bandnutzer, zudem mit höheren Sendeleistungen,
haben die Funkamateure in der Konkurrenz eigentlich gute Karten, doch
gruppiert sich ihre nicht sehr üppige 70-cm-Nutzung eher außerhalb des ISM-
Bereichs. Insofern schade, daß man sich bei der DARC-Hauptversammlung
1995 nicht dazu durchringen konnte, PR bei 433 MHz zu empfehlen − findige
Funkamateure planten dort Versuche mit sogenanntem Packet-Broadcast.
Also heißt es, dafür zu sorgen, daß keine Amateurfunkgeräte in unbefugte
Hände gelangen, zu schauen, ob es überhaupt ISM-boomt und sich in
friedlicher Koexistenz zu üben − dabei aber den 70-cm-ISM-Bereich auch
selbst zu nutzen.
Beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Internet − schöne neue Welt?
Gestern Multimedia, heute Datenautobahn: Die Presse überfrachtet
gern mit Schlagwörtern. Ist aber das Internet schon die Datenauto-
bahn? Eher nicht − das, was die Medienmogule planen, ist ein
Kommunikationsnetz großer Kapazität in jeden Haushalt und nicht
die Schmalspurübertragung über 14 400-bps-Modems, die schon bei
einem halbwegs netten TIFF-Bild schlappmachen.
Wir Leser und Macher des FUNKAMATEUR stehen der elektronischen
Kommunikation naturgemäß offen gegenüber, aber der computerlose
„Normalbürger“ kann mit „Internet“ und „Mailboxen“ wenig anfangen,
der Wille nach „Interaktivität“ am TV-Bildschirm ist nicht so groß,
wie es mancher gerne hätte, und auch Teleshopping oder Pay-TV
laufen nicht ganz so, wie erwartet wurde.
Während der Eröffnung des neuen Telekom-Gebäudes sagte Leipzigs
Oberbürgermeister Dr. Hinrich Lehmann-Grube treffend, daß man
sich zur Zeit vor allem Gedanken über die Netze, weniger um die
Benutzer macht und Inhalte wohl erst erfunden werden müßten.
Für die „Netzsurfer“ hingegen ist klar, daß es wohl zur Zeit kaum eine
reizvollere Beschäftigung gibt, als sich in Rechner einzuloggen, die
wer weiß wie weit entfernt sind, und dort nach brauchbaren Dateien
zu fahnden oder mit wildfremden Leuten zu philosophieren.
Gut und schön. Zum einen müssen aber dringendst klare Gesetze
her, die Anbietern von elektronischen Diensten die Sicherheit bieten,
die vor allem nach den neuesten Beschlagnahmungen von Mailboxen
notwendig ist. Keinem dieser Betreiber kann zugemutet werden,
daß er jedes Byte kennt, welches über sein System läuft, und vor allem
darf er bei Mißbrauch nur sehr eingeschränkt verantwortlich gemacht
werden.
Internet & Co. bieten unglaubliche Möglichkeiten der Informations-
beschaffung und Kommunikation, aber auch neuartige Methoden
der kriminellen Nutzung. Online-User werden jedoch zu Recht wütend,
wenn Mailboxen und Netze vor allem in der TV-Welt in die Ecke „be-
liebte Quelle für Raubkopien und Kinderpornos“ abgedrängt werden.
Zum anderen werden die geplanten Gebührenerhöhungen für
Telefongespräche ab 1996 das Aus besonders für einige Hobbyfreaks
bedeuten − egal ob Anbieter oder Nutzer. Es darf aber nicht angehen,
daß stark steigende Ortstarife den privatem Datenverkehr ein-
schränken. Wenn ab 18 Uhr eine 12-Minuten-Verbindung nicht mehr
23, sondern 60 Pfennig kosten wird, werden nicht wenige ihre
Onlinezeit drastisch einschränken müssen − die Dienste allein sind
schon teuer genug. CompuServe etwa mit weltweit über 3 Millionen
Mitgliedern hat es immer noch fertiggebracht, einen Zugangsknoten
in einer ostdeutschen Stadt zu installieren. Für die Anwahl aus
den neuen Ländern (mit Ausnahme Berlins) ist weiterhin der teure
Ferntarif fällig.
Insgesamt ist zu hoffen, daß Politiker und Medienlandschaften mit
mehr Objektivität an das Netzleben herantreten und die Telekom
sich von zahlreichen vor allem in Netzen initiierten Aktionen gegen
die Tarifreform erweichen läßt.
Ihr
René Meyer
Hello, world…
Vor etwa zwanzig Jahren fing es bei mir an. Es war einfach da.
Amateurfunk − ein Hobby, das mich als Kurzwellenhörer und
Elektronikbastler begeisterte. Schon mein damaliger Klubstations-
leiter meinte, daß der HF-Bazillus einen nicht mehr los läßt, hat er
erst einmal zugeschlagen.
Die Zeitschrift FUNKAMATEUR war bereits zu jener Zeit mein
ständiger Begleiter. Alles wurde nachgebaut. Nichts gegen „Steck-
dosen-Amateure“, aber der Eigenbau hat für mich noch heute ein
ganz eigenes Flair. Es ist schon eine tolle Sache, wenn die ersten
Laute aus dem selbstgebauten Empfänger tönen. Oder − erinnern
Sie sich noch an die Beitragsserie mit dem Eigenbau-Computer
AC1? Das war mein Einstieg in die Welt der PC-Technik. Und das
Ding funktioniert heute noch…
Doch wer hätte gedacht, daß ich ein Jahrzehnt später (heute) selbst
zur Redaktion des FUNKAMATEUR stoßen würde, verantwortlich
für die Bereiche PC/Elektronik/Funk? Also dann: „Hello, world!“.
Da bin ich nun und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit
Ihnen allen.
Eine Zeitschrift lebt immer auch von der Meinung und dem Ideen-
reichtum ihrer Leser, macht sie informativ und lesenswert.
Deshalb: Senden Sie uns Ihre Manuskripte zu interessanten Themen,
Nachbauprojekten oder Tips und Tricks aus der Welt der Elektronik.
Dabei sind es garnicht immer die großen, komplexen Projekte, die
zum Nachbauen anregen. Im Gegenteil. Gerade die kleinen „Nischen“
und „elektronischen Marktlücken“ lassen dem engagierten Bastler
Raum, ja zwingen manchmal regelrecht dazu, den Lötkolben zu
zücken. Natürlich sehe ich auch, daß Lust und Frust häufig dicht
beieinander liegen. Die Fortschritte auf dem Bauelementesektor
bedingen das ja förmlich. Da hat man mit viel Aufwand an Zeit und
Geduld endlich eine Schaltung für sein Problem entwickelt, das
Gerätchen zusammengelötet und zum Laufen gebracht. Doch dann
stellt man fest, daß es dafür längst eine integrierte Schaltkreislösung
gibt. Außenbeschaltung nur noch zwei Widerstände, voila, das war’s.
Andererseits lassen sich heute relativ einfach Lösungen schaffen, die
vor Jahren noch einen unvertretbar hohen Aufwand mit sich brachten
oder deren Realisierung für den Elektronikamateur schlichtweg
unmöglich war.
Es kommt darauf an, möglichst pfiffige Ideen zu entwickeln, die bei
Einsteigern wie bei „alten Hasen“ den Spaß am Basteln und
Experimentieren wachhalten. Machen Sie mit. Loben Sie, was
lobenswert scheint. Bringen Sie Ihre Ideen zu Papier (oder besser
noch als ASCII-File auf Diskette), äußern Sie Ihre Meinung, auch
(und gerade), wenn Ihnen etwas nicht an unserer Zeitschrift gefällt.
Sicher, manchmal vertreten Sie Ihren Standpunkt und wir den
unseren. Na, und. Reibung erzeugt bekanntlich Wärme.
Gehen wir’s vertrauensvoll miteinander an, den FUNKAMATEUR
weiter voranzubringen. Gehen Sie mit?
Ihr
Dr. Reinhard Hennig
Das Gefühl, nicht fremd zu sein
Seit nunmehr zwanzig Jahren findet im Frühsommer am Bodensee
die größte Amateurfunk-Ausstellung Europas, die Ham Radio, statt.
Tausende Funkamateure aus allen Teilen der Welt zieht es Ende Juni
wieder dorthin, wo fast 300 Firmen aus 34 Nationen über die neuesten
Techniken und Trends der Branche informieren und um potentielle
Kunden werben.
Drei Tage lang prägen Weltneuheiten und Europapremieren der
großen Aussteller das Gesicht der Messehallen, werden Geräte aus-
probiert und Kataloge eingesammelt, um sich später, in aller Ruhe,
für den einen oder anderen Transceiver zu entscheiden. Aus dieser
Perspektive gesehen, ist die Ham Radio mit ihren großen Firmen und
den vielen Händlern ein Umschlagplatz für Produkte der HF-Technik
und Elektronik, der Hard- und Software. Von den echten Highlights
abgesehen − the same procedure as every year.
Aber ist da nicht noch etwas anderes? Etwas, was uns jedes Jahr
aufs neue magisch anzieht? Etwas, das uns trotz langer Anfahrtswege
und strapaziöser Messetage jedesmal am Ende resümieren läßt,
daß es sich wieder einmal gelohnt hat, dagewesen zu sein?
Friedrichshafen ist ohne Zweifel auch ein Ort der Begegnungen. Hier
kommt man ins Gespräch, hier tauscht man Erfahrungen und Informa-
tionen aus, hier treffen sich alte Bekannte und gute Freunde zum
Plausch. Hier knüpft man Kontakte, die nie wieder abreißen müssen.
Denn schließlich treffen sich hier Funkamateure, die vom Frequenz-
kommerz bedrohte Spezies Mensch, die weltweite Kommunikation
als Hobby kultiviert.
Das erste Mal besuchte ich 1990 die Messe − für einen Tag. Natürlich
war es hochinteressant! Was mich damals beeindruckte? Das war
das internationale Flair und das Gefühl, unter all den Menschen nicht
fremd zu sein. Es schien wie eine große Familie und dieser Eindruck
hat sich bei mir gefestigt.
Und auch die diesjährige Ham Radio verspricht wieder eindrucksvoll
zu werden. Dafür sorgen nicht nur die Neuheiten der Aussteller, sondern
auch die Vorträge und Meetings im Rahmen des Bodenseetreffens,
die Informationsstände von Vereinen und Institutionen sowie die
vielen ausländischen Amateurfunkverbände.
Ich hoffe, in Friedrichshafen viele Bekannte zu treffen und neue
Freundschaften schließen zu können. Ich rechne auch damit, Sie dort
zu treffen. Gleich ob als Funkamateur, mitreisendes Familienmitglied
oder als elektronikbegeisterter Besucher, der sich ein Bild vom
Amateurfunk in seiner ganzen Vielfalt machen will.
Ihre
Katrin Vester, DL7VET
Nichts Besonderes
In seinem jüngsten Sonderrundspruch konstatierte der DARC-
Vorsitzende Dr. Horst Ellgering, DL9MH, einen Mitgliederrückgang
des Klubs von 0,9 % im Jahr 1994 und führt ihn im wesentlichen auf
die verschärfte finanzielle Situation von mehr oder weniger sowieso
passiven Funkamateuren zurück. Hoffentlich hat er recht, denn schon
im gleichen Atemzug macht ihm neben mangelndem Engagement
und Politikverdrossenheit die verringerte Attraktivität des Amateur-
funks Sorgen.
Ich fing mal mit einem Eigenbau-Detektorempfänger an, der als
wesentliche Bestandteile einen regenerierten Wehrmachtskopfhörer
und ein aus Schwefel und Blei selbst zusammengeschmolzenes
„Detektorkristall“ enthielt. Der Moment, als es gelang, damit die
ersten Klänge des Mittelwellen-Ortssenders vernehmbar zu hören,
bleibt unvergeßlich! Eigenbau und das Medium Funk faszinierten
mich gewaltig. Zudem war Selbstbau das einzige Mittel, zu funktions-
fähigen Geräten zu kommen. Ein paar Jahre später erregten Berichte
von meinen ersten Übersee-QSOs im Bekanntenkreis durchaus noch
echtes Interesse und Erstaunen. Selbst legal Senden, wie auch immer,
ging nur mit einer Amateurfunkgenehmigung.
Heute liegt jedermann hierzulande per E-Netz-Telefon die Welt zu
Füßen, Scall und drahtlose Telefone tun ein übriges. Wer etwas
individueller funken will, kauft mal eben ein CB-Gerät. Zig Fernseh-
kanäle bringen Informationen oder was man dafür hält. E-Mail
weltweit öffnet sich auch dem kleinen Geldbeutel. Und nicht zuletzt:
Selbstbau lohnt sich (von der Effektivität her) nur mehr in Ausnahme-
fällen. In diesem Zusammenhang halte ich ernsthaft vorgebrachte
Einwände gegen ETSI (teurere Geräte würden den amateurfunk-
prägenden Eigenbau gewaltig aufwerten) für eine Illusion.
Amateurfunk ist demnach heute eigentlich nichts Besonderes (mehr).
Anreiz und Motivation also dahin? Wer schon mit Begeisterung dabei
ist, wird es wahrscheinlich bleiben. Auch mit herkömmlichen Inhalten.
Hin und wieder bewegt mich jedoch der Gedanke, daß in 50 oder
100 Jahren Amateurfunk anachronistisch sein könnte, weil überall
preisgünstigst Datenkanäle gewaltiger Baudrate zu jedem Punkt der
Erde verfügbar sind, mit deren Hilfe sich einfach alles übertragen läßt.
Vielleicht lohnt es sich deshalb, zur Abwechslung mal über die
gewöhnlich veranschlagten nächsten 5, 10 oder gar 15 Jahre hinaus-
zudenken. Aus welcher Sicht betrachtet ein heute noch nicht
Geborener die Amateurfunkszene von 2015, bzw. wie läßt sich die
Szene so entwickeln, daß er daran Gefallen findet?
Die Chance, technikbegeisterte junge Leute auf unsere Seite zu
ziehen, wächst, wenn es gelingt, den Amateurfunk zumindest auf
einigen Gebieten der Massenkommunikation auch weiterhin ein Stück
voraus sein zu lassen. Fordern wir die kommende Generation heraus.
Mit neuen Technologien. Und mit Besinnung auf echte, freundschaft-
liche Kommunikation. So bleibt unserem Amateurfunk für die über-
schaubare Zukunft doch etwas Besonderes.
Beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Mittel zum Zweck
Die CeBIT ’95 in Hannover hat gezeigt, was mit moderner Kommu-
nikationstechnik schon jetzt möglich oder greifbar nahe ist.
Multimedia, Network Computing und ISDN sind die Schlagworte,
die unser Leben in bedeutendem Maße beeinflussen werden.
Und tatsächlich ist die Welt, kommunikativ gesehen, sehr viel kleiner
geworden. Die ständige Weiterentwicklung der Weltraumsatelliten
und der Mikroelektronik, der Faser- und der Lasertechnik erhöht
unsere Fähigkeit, Daten zu speichern und zu analysieren, Informa-
tionen auszutauschen und zu verarbeiten. Schon heute kann der Inhalt
eines Dutzend Bände der Encyclopaedia Britannica in Sekundenschnelle
um die ganze Welt gesandt werden.
Wie tiefgreifend die Veränderungen sind, die auf unsere Zivilisation
zukommen, bleibt abzuwarten. Abzuwarten? Ich denke, wir sollten
die Möglichkeiten, die sich uns durch das Zusammenspiel von
Spitzentechnologien eröffnen, nicht einfach unkritisch bejubeln,
denn die Entwicklung der Daten- und Kommunikationsnetze birgt
auch Probleme und Gefahren.
Grenzenlose Zugriffsmöglichkeiten auf weltweite Datenbänke werfen
beispielsweise die Frage auf, ob und wie geschützt geheime, vertrau-
liche oder persönliche Daten sind? Werden mit Hilfe modernster
Technik Arbeitsprozesse vereinfacht und beschleunigt, fragt man
sich zu recht, wie sicher Arbeitsplätze sind, die eben noch als
krisenfest galten. Und schließlich bleibt die Frage, ob uns die
Errungenschaften des Informationszeitalters insgesamt glücklicher
machen werden.
Bei der Lösung der Fragen ist die Gesellschaft, sind Politiker, ist
jeder einzelne gefordert. Technischer Fortschritt allein kann nicht die
Lösung aller Probleme sein, wie es Politiker und Wirtschaftsmanager
gern behaupten. Was die Gesellschaft braucht, sind vielmehr Konzepte,
die auftretende Risiken auf ein Minimum beschränken.
Die Computertechnik als Bestandteil der Kommunikationstechnik hat
ihren Siegeszug längst angetreten. In den meisten Berufen gehört
der Rechner mittlerweile zur Standardausrüstung. Und auch ich bin
zufrieden, daß er mir für das Verfassen und Bearbeiten von Texten zur
Verfügung steht. Dank der Computertechnik lassen sich problemlos
Fehler korrigieren, Absätze verschieben usw. Nicht zu vergessen sind
natürlich Speicher-, Transport- und Konvertierungsmöglichkeiten.
Der Computer ist mir eine Arbeitserleichterung, Mittel zum Zweck.
Zugleich schafft er aber auch Freiräume für mehr Kreativität.
Die Anwendung des Computers in der Freizeit bietet jedem weit mehr
Alternativen. Viele experimentieren mit ihrem Computer, bauen und
schrauben an ihm herum, programmieren selbst. Manche katalogi-
sieren ihre Videokassetten oder rechnen mittels Computer Conteste
ab. Andere versuchen, sich in immer neue Netze einzuloggen, und
wieder andere suchen Entspannung bei Computerspielen. Jeder
sollte das machen, was er möchte.
Ich ganz persönlich setze in meiner Freizeit nicht auf Computer,
Fernseher oder Videokassette, sondern auf soziale Kommunikation.
Fast jedes Wochenende treffe ich mich mit Freunden.
Welche Entwicklung und tiefgreifende Veränderung die Kommunika-
tionstechnik in den nächsten Jahren auch durchläuft − sie erleichtert
die Arbeit und beschleunigt Prozeß. Für mich ist sie Mittel zum Zweck.
Moderne Technik kann soziale Kontakte, Vertrauen und Freundschaft
nicht ersetzten.
Ihre
Katrin Vester, DL7VET
Hobby und Beruf
Lerne fürs Leben, so heißt es wohl im Volksmund. Bei alledem, was
wir in der Schule mitbekamen − eigentlich brauchen wir später nur
einen gewissen Teil davon: Lesen, Schreiben, Rechnen, Fremd-
sprachen zum Beispiel. Wer muß im Berufsleben noch zeichnen oder
singen können oder gar Gedichte beherrschen? Was blieb von dem
übrig, was uns früher einmal eingepaukt wurde? Viele − dazu gehöre
auch ich − kamen mehr oder weniger über das Hobby zum Beruf,
wenn sie nicht gerade Zahnarzt, Theologe oder Jurist wurden.
Das Hobby als Wegbereiter zum Beruf ist gerade in der Elektronik ein
entscheidender Faktor geworden. Das Verstehen von elektronischen
Zusammenhängen, kreatives Denken beim Aufbau von Schaltungen
oder der Gebrauch von Fremdsprachen bei der Funkerei − alle Faktoren,
die hierbei eine Rolle spielen, können bei einer späteren Bewerbung
von ausschlaggebender Bedeutung sein. Man denke nur an
Stellenanzeigen, bei denen es ausdrücklich „angenehm“ wäre, wenn
der/die Bewerber/in Lizenzinhaber ist. Hin und wieder ist so etwas
schon zu lesen.
Auch, wenn hauptsächlich nur im Entwicklungslabor oder beim
Service gelötet wird, falsch kann es auf keinen Fall sein, wenn man es
beherrscht. Nicht nur das eigene Ego wird dadurch gestärkt. Beim
Basteln in einer Gemeinschaft, in Gruppen des TJFBV e. V. oder des
Arbeitskreises Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule e. V.
zum Beispiel, gewinnen alle − und nicht nur an Erfahrung. Immerhin
kann man sich hier gegenseitig helfen, Gedanken austauschen und
vielleicht Probleme gemeinsam lösen, die alleine nur schwer
zu bewältigen wären.
Und noch ein wichtiger Aspekt: Alle lernen Teamarbeit, und die ist
heute mehr denn je gefragt. Herausragende Entwicklungen sind in
unserer Gegenwart nur noch in einer Gruppe möglich, wo jeder zwar
sein Spezialwissen hat, aber nur alle gemeinsam zum Ziel kommen
können.
Jeder, der schon Bewerbungsgespräche hinter sich hat, weiß, wie
wichtig den Arbeitgebern die Gruppenarbeit und die Identifikation mit
der Arbeitsaufgabe ist − und die muß und kann man sich aneignen.
Mit den Basteljahren reift die Begeisterung für technische Dinge,
beim Schaltungsaufbau das Verstehen von Zusammenhängen, und
schließlich ist man stolz, etwas Eigenes geschaffen zu haben.
Eltern sollten das erwachende Interesse der Kleinen an der Technik
fördern und nicht unbedingt darauf drängen, daß sie zum Klavieroder
Tennisunterricht gehen. Die wenigsten werden in die Fußstapfen
von Artur Rubinstein oder Steffi Graf treten können, viele aber später
gute Techniker und Ingenieure sein.
Besonders wir, die den HF- oder Elektronikbazillus schon in uns haben,
können viel dafür tun, Kinder und Jugendliche für unser gemeinsames
Hobby zu begeistern und sie aus der Passivität des dumpfen
Konsums herauszuholen. Tun wir es und unterstützen das Anliegen
vieler Arbeitsgemeinschaften. Tun wir es, um ihre Kreativität zu
fördern. Deutschland muß innovativ und Industriestandort bleiben.
Ob es nun das reine Elektronikbasteln oder der Amateurfunk mit
seinen vielen Betätigungsfeldern ist − dem künftigen Lehrling oder
Studenten kann unser liebgewordenes Hobby nur dienlich sein.
Ihr
Jörg Wernicke, DL7UJW
Denkpause
Nachdem bis zum Herbst vergangenen Jahres eine Fülle von
Problemen die Funkamateure bewegte, neue Durchführungs-
bestimmung zum Gesetz über den Amateurfunk, Neufassung des
Gesetzes selbst, CB-Funk im 70-cm-Band, S 6 und vieles andere
mehr, begann im Vorfeld der Bundestagswahl eine gewisse Flaute.
Die Wahl ist gelaufen und angesichts ihres Ausgangs allgemein
Kontinuität zu erwarten. So dürfte die Diskussion allmählich wieder
intensiver in Gang kommen − dort anknüpfend, wo sie abebbte.
Dann ist keine rückgewandte Verteidigungsstrategie am Platze,
sondern eine Positionsbestimmung und mehr noch eine möglichst
realistische Einschätzung der weiteren Entwicklung.
Entscheidende Impulse für die technische Entwicklung wie in seiner
Anfangszeit wird der Amateurfunk nicht mehr geben können, worüber
bestimmte Innovationen, etwa in der Satellitentechnik, nicht
vergessen sein sollen. Technisch-experimenteller Funkdienst zu sein
bleibt aber ein hoher Anspruch. Auch heute gibt es in unseren Reihen
Pioniere, die zumindest mit der technischen Entwicklung Schritt
halten und im Amateurfunkbereich adäquate Lösungen vorantreiben.
Wichtige Faktoren für die Daseinsberechtigung des Amateurfunks
bleiben seine immateriellen Werte, so die Bildungsfunktion. Er schafft
Technikbegeisterung und –verständnis, baut Vorbehalte gegen
Ausländer ab, gibt (nicht nur Jugendlichen) eine interessante
Betätigungsmöglichkeit… Das alles müssen wir auch Außenstehenden
begreiflich machen.
Aber wie geht es weiter? Gegenüber der Gründerzeit gibt es viel
mehr Funkamateure, Sende- und Betriebsarten, dazu Packet-Netze,
DX-Cluster, ATV-Relais usw. Der technische Trend geht, wie auch in
der kommerziellen Nachrichtentechnik, zur digitalen sowie zu immer
mehr, ausgefeilteren und leistungsfähigeren Verfahren mit hoher
Übertragungsrate; damit u. a. auch zu höheren Frequenzen.
Das Ganze spielt sich in einer Landschaft ab, die, Stichwort Daten-
Highway, zur totalen Kommunikation, vielleicht zum Informations-
kollaps strebt. Ob man dadurch glücklicher wird? Deutet sich doch
schon im gegenwärtigen Packet-Radio eine Verschiebung vom
persönlichen Kontakt, wie in Telefonie, SSTV, ATV, auch Telegrafie,
zur unpersönlichen Text-, Daten- oder auch Bildübertragung an.
Zumindest aus der Perspektive eines Industrielandes hat sich durch
aktuellste Nachrichten in Rundfunk und Fernsehen, weltweite
Telefon- und Datennetze, C-, D-, E-Netz-Telefone sowie eine Fülle
von Unterhaltungsmöglichkeiten die Attraktivität des Amateurfunks,
vor allem für junge Leute, verringert. Was also kann heute den
Nachwuchs für den Amateurfunk begeistern?
Ansatzpunkte sind vielleicht die unkonventionelle Kontaktaufnahme
mit den Funkamateuren aus anderen Ländern und Kulturkreisen,
Wettbewerbe, persönliche Kontakte bei Fielddays und ähnlichem,
schnelle Integration und Akzeptanz von neuen technischen
Entwicklungen, hoffentlich noch der Selbstbau von Geräten und −
der Ham Spirit.
Bald wird das BMPT die Bedingungen festlegen, unter denen wir bis
ins 21. Jahrhundert hinein funken dürfen. Möge es gelingen, ihm die
Lebenskraft und den Nutzen des Amateurfunks in einer kommer-
zialisierten Welt erneut nahezubringen.
Beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Auf ein neues!
Ein neues Jahr, ein neuer Anfang. Traditionell nimmt man sich zum
Jahresbeginn etwas vor, das man unbedingt erledigen möchte, meist
etwas, was im Vorjahr oder deren mehrerer nicht geschafft worden
ist. Und dabei geht es durchaus nicht nur um die Pflichten des
täglichen Lebens, sondern auch um das eine oder andere Projekt aus
dem Hobbybereich. So wurde allzuhäufig die Absicht, endlich mal
wieder etwas zu löten, ein lang gehegtes Konzept in die Realität
umzusetzen, immer weiter hinausgeschoben.
Wir geben Ihrem Pferd die Sporen: Nachdem die beiden früheren
FUNKAMATEUR-Konstruktionswettbewerbe gute Resonanz hatten
und die Teilnehmerzahl beim zweiten gegenüber dem ersten deutlich
gestiegen war, schreiben wir 1995 einen weiteren aus; die genauen
Bedingungen finden Sie auf Seite 25. Wer schon lange eine gute Idee
mit sich herumträgt, sollte unseren Wettbewerb zum Anlaß nehmen,
sie zu realisieren − und natürlich den zugehörigen Beitrag dazu
schreiben. Wir versprechen uns davon interessante, nachbaufähige
Bauanleitungen, die wiederum andere Amateure anregen, den
Lötkolben aus dem Schrank zu holen. Es scheint ja ohnehin so, als
würde der Selbstbau einer Renaissance zustreben.
Als Lohn der Mühe winken neben dem üblichen Honorar, das wir
für jeden veröffentlichten Beitrag zahlen, wieder zehn Preise. Weil
Sachpreise nicht immer den persönlichen Wünschen der Gewinner
entsprechen, haben wir uns diesmal für Geldpreise von 750 DM,
500 DM und 300 DM sowie siebenmal 100 DM entschieden, damit sie
selbst disponieren können.
Als Thematik steht die gesamte Breite unseres Zeitschrifteninhalts
zur Wahl, die wesentlichen Teilgebiete sind als Anregung in der
Ausschreibung noch einmal etwas detaillierter aufgeführt. Dabei geht
es nicht um komplizierte und aufwendige Geräte, die es womöglich
viel billiger fertig zu kaufen gibt, sondern eher um das Wochenend-
projekt mit Pfiff, nicht in jedem Fall um ein eigenständiges Objekt,
sondern vielleicht auch ein Stück Peripherie oder die innovative
Modifikation eines verbreiteten oder billig erhältlichen Industrie-
produkts.
Nicht zuletzt liegen uns die Einsteiger am Herzen, namentlich die im
Teenager-Alter. Wir wollen ihnen realisierbare, interessante Bauvor-
haben anbieten, außerdem Jugendliche animieren, ihre Erfahrungen
anderen mitzuteilen. Deshalb haben wir diesmal zusätzlich noch
einen Preis für die beste Einsendung eines Lesers unter 18 Jahren
ausgesetzt.
Basteln macht Spaß! Eigene Ideen umzusetzen oder einfach nur
etwas selbst gemacht zu haben, aktive statt passiver „Unterhaltung“,
das bringt heute wie früher die so wichtigen Erfolgserlebnisse.
Vier Monate haben Sie Zeit, Ihren Beitrag zu Papier oder Diskette zu
bringen, und es spricht auch nichts gegen Mehrfacheinsendungen −
vielleicht haben Sie zum Schluß die „Nase vorn“.
Also frisch ans Werk! Wir freuen uns schon auf Ihre Einsendungen.
Mit besten Grüßen, Ihr
Bernd Petermann, DL7UUU
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Jetzt powert's digital…
Seit dem 1. Oktober 1994 gibt es für zwei CB-Kanäle eine Allgemein-
genehmigung zur Übertragung digitaler Daten. Das ist − genau wie
die Lockerung der Antennenbestimmungen − ein echter Fortschritt,
auf den viele CB-Funker gewartet haben. Allerdings auch ein wenig
eingeschränkt: Es sind nur direkte Verbindungen möglich, genauer
gesagt, erlaubt.
Um mich ein bißchen kundig zu machen, härte ich seit dieser Zeit
ab und zu in die Betriebskanäle 24 und 25 hinein und siehe da −
hin und wieder sind schon vereinzelte Packetsignale zu hören, die
einige Trägersteller aber sporadisch niedermachen wollen.
Die Meinungen scheinen da wohl stark auseinanderzugehen. Einerseits
die „alten Stammis”, andererseits die CBer, die auch mal etwas
Neues ausprobieren und ihre Computer nicht nur zum Spielen
einsetzen möchten.
Die Diskussionen sind heftig, manchmal sogar grob, viele Funker
ungehalten oder gar empört über die neuen, kurzen Geräusche. Das
hilft allerdings nichts: Packetsignale sind recht schnell, und ehe man
mit einem Träger querschießen möchte, ist die digitale Mitteilung
schon über den Äther gegangen. Außerdem lassen sich diese
Datenpakete nicht so gut stören wie eine xy-Telefonieverbindung.
Will sagen: Irgendwie sollte man schon auf einen Nenner kommen −
die Technik läßt sich nicht aufhalten, zu mal Computer immer
preiswerter werden und es Hard- und Software für Packet Radio u. ä.
schon für moderate Preise gibt (z. B. BayCom − aber als MYCALL
nicht etwa ein Amateurfunkrufzeichen einsetzen oder stehenlassen!).
Außerdem kommen damit auch diejenigen „zu Worte”, die nicht
so redegewandt sind oder keine Möglichkeit haben, mit anderen
zu kommunizieren, weil irgendeine "Kiönsnack-Runde" die vielleicht
zaghaften Versuche eines CB-Neulings mit drastischen Maßnahmen
unterbindet.
Normalerweise stören die kurzen, relativ leisen Packet-Signale während
einer guten Telefonieverbindung kaum, es sei denn, jemand sendet
mit viel Leistung große Bilddateien oder Programme. Ein paar positive
Aspekte: Sprachbarrieren bei PR-Auslandsverbindungen fallen weg,
wenn die Abkürzungen benutzt werden, die auch im Amateurfunk
üblich sind. Und wer gar einen TNC besitzt, kann Nachrichten
empfangen, ohne zu Hause sein zu müssen oder auch welche für
jemanden bereithalten. Wenn die eine Seite es zuläßt, kann die
andere auf deren Festplatte zugreifen und Daten bzw. Programme
"herunterfischen". Die Möglichkeiten sind sehr vielseitig.
Aber Packet Radio ist noch nicht alles. Es gibt ja auch andere digitale
Übertragungsarten, die durchaus interessant sein können. Eine
davon ist RTTY (Funkfernschreiben), mit der ebenfalls weite
Verbindungen möglich sind. Oder man experimentiert einfach mal mit
neueren Techniken wie AMTOR bzw. PACTOR und baut sich
Konverter oder Interfaces selbst. Dazu können z. B. neue Klubs oder
Arbeitsgemeinschaften ins Leben gerufen werden.
Sie sehen: Sich mit der digitalen Technik zu beschäftigen kann den
CB-Horizont gewaltig erweitern − ja sogar ein wenig süchtig machen.
Wäre das nicht auch etwas für Sie? Jetzt besteht für alle die Möglichkeit
− keiner ist dafür zu alt!
Ihr
Jörg Wernicke
Gleichmacherei
Eines der in der Szene heiß diskutierten Themen ist gegenwärtig die
vom Gesetzgeber geplante "Einheitslizenz". Unbestritten verringert
eine solche Genehmigung den Verwaltungsaufwand und damit die
Kosten − auch für den einzelnen Funkamateur.
Erhebt sich die Frage, wie hoch denn die Trauben für eine solche
nivellierte Prüfung gehängt werden sollen. Und hier müssen sich die
Geister schon einmal scheiden. Entweder setzt man das Niveau
verhältnismäßig niedrig an, was ja im Sinne eines einfachen Zugangs
und des Fortbestandes des Amateurfunks wünschenswert wäre, oder
legt die Latte höher, was sie für viele potentielle Interessenten
unüberwindlich erscheinen lassen muß.
Bliebe also nur die erste Lösung. Da kommt einem dann der Status
des Amateurfunks als gleichberechtigter technisch-experimenteller
Funkdienst in den Sinn, auf den wohl alle Funkamateure mit Recht
stolz sind. Aber einfacher Zugang heißt ja nichts anderes, als wenig
Kenntnisse − in welchem Teilbereich der Tätigkeit der künftigen
Funkamateure auch immer. Und wer wenig Kenntnisse hat, dem kann
man nicht allzuviel Verantwortung übertragen. Damit trotzdem kein
größerer Schaden entsteht, liegt es nahe, die Rechte und Möglichkeiten
zu beschneiden. Und hier schaut nun der Pferdefuß der gerade
für Neueinsteiger so verlockenden Einheitslizenz heraus: Die Gefahr
der Aushöhlung des Amateurfunks als experimenteller Funkdienst und
eine Gleichbehandlung mit rein kommerziellen Funkanwendungen.
Wie ausländische Fernmeldebehörden eine solche Entwicklung
sähen, wäre − ganz nebenbei − auch nicht uninteressant.
Zu den Vorzügen des Amateurfunks gehört unbestritten, daß er als
gesellschaftlichen Nutzen Bildungseffekte und technisches
Verständnis bewirkt − in unserem Land, dessen wirtschaftliche
Entwicklung eng mit Innovationsfähigkeit und technischem Fortschritt
verknüpft ist, nicht gering einzuschätzen.
Die Praxis beim aktuellen Genehmigungssystem zeigt, daß sich
die überwiegende Zahl der Inhaber der höchsten Klasse B auf dem
Weg über die niedrigeren dazu hochgearbeitet hat: akzeptable
Einstiegsschwelle, danach Zeit zum Weiterlernen, um alle Möglich-
keiten nutzen zu dürfen. Dabei kann man sich streiten, welche
erweiterten Kenntnisse notwendig oder wünschenswert erscheinen.
CW, digitale Übertragungsverfahren, Fremdsprachenkenntnisse,
Betriebsdienst sind einige der Reizworte. Aber das ist bereits ein
anderes Thema.
Eine Lösung sollte es schon geben, und die Funkamateure tun gut
daran, emotionslos und so objektiv wie möglich nach Vorschlägen zu
suchen, die auch die Behörde billigt. Nach der Wahl dürfte wieder
Bewegung in die Sache kommen, wobei der Runde Tisch Amateurfunk
RTA seine Möglichkeiten nutzen wird, eine Differenzierung zu erreichen.
Fazit: Ich bin überzeugt, daß mehrere Genehmigungsklassen für das
Gedeihen des Amateurfunks unabdingbar sind und die vermeintlichen
Nutznießer einer simplen Einheitslizenz vielleicht bald ihren Vorteil
durch Schmälerung der Rechte für alle schwinden sähen. Überdies
finden sich quer durch das deutsche Recht ausgeklügelte Bestim-
mungen, die jeder denkbaren Konstellation Rechnung tragen. Ohne
Bürokratie das Wort reden zu wollen: Es lebe der kleine Unterschied!
Beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Elektronikbasteln out?
Es gab Zeiten, da wurde bei vielen Hobby-Elektronikern der Lötkolben
so gut wie nie kalt. Kreativität stand im Mittelpunkt jedes Bau-
vorhabens, und man fachsimpelte im Kollegen- oder Freundeskreis
über diese oder jene in Angriff genommene Schaltung, über eventuell
eigenentwickelte oder für die nächste Zeit ins Auge gefaßte
Elektronikprojekte. Der Gesprächsstoff zu diesen Themen ging selten
aus.
Das war besonders bei Erichs Untertanen der Fall, die sich seltene
oder schwer beschaffbare Bauelemente über fast schon kriminelle
Kanäle besorgen mußten („Es ist noch mehr aus den Betrieben
herauszuholen.”). Diejenigen, die moderne Schaltkreise oder ähnliches
aus dem anderen Teil Deutschland bekamen, waren gut dran, und
konnten auch mal etwas nachbauen, was andere Elektroniker oder
Funkamateure neidisch machte. Das war schon was!
Und wie sieht es heute aus? Frage ich im Bekannten- und Freundeskreis
nach, was denn der eine oder andere in letzter Zeit so gebastelt
hat, kommt (UKW-Funkamateure ausgenommen) meist nur ein müdes
Lächeln rüber: "Naja, vielleicht mal 'nen Steckverbinder oder eine
Anschlußschnur!" Keine Zeit, ist auch so eine Antwort. Und man merkt
es an sich selbst oder hört es von anderen: Wer Arbeit hat, arbeitet nur
noch, und wer sie verloren hat, besitzt das Geld nicht mehr und sitzt
ständig vor dem Computer, um Bewerbungsbriefe zu schreiben oder
sich weiterzubilden.
Hinzu kommt noch die Tatsache, daß vieles, was vor Jahren noch
einigermaßen unkompliziert aufzubauen war, heute immer aufwendiger
wird. Da muß alles mikroprozessorgesteuert sein, enthalten die
Schaltungen teilweise Bauteile, deren Beschaffbarkeit schon fast
einem Lottogewinn ähnelt, weil die Dinger so exotisch sind, daß alle
bekannten Händler mit den Achseln zucken oder man im zehnten
Katalog immer noch nicht den richtigen Typ gefunden hat.
Auch das Angebot an fertigen Bausätzen kann nur manche
Funkamateure vom Stuhl heben, besonders jene, die sich mit Gebieten
beschäftigen, wo das Angebot noch ziemlich dürftig ist (SHF-Technik
u. ä.). Für Elektroniker sind nur wenige Schmankerln im Bausatztopf.
Müde schauen Sie auf LED-Biinker, die zwanzigste Sirene oder die
dreißigste Alarmanlage. Und ist da mal was Interessantes im Angebot,
schmerzt der Blick auf den Preis.
Zudem gibt es Baste/freaks, die sich immer wieder vornehmen, etwas
zu bauen. Diese Gruppe spaltet sich wiederum in zwei Völkchen:
Die einen besorgen sich die wichtigsten Bauteile und lagern sie dann
für Jahre in irgendeiner Schublade (wollen das gewünschte Projekt
aber irgendwann beginnen), die anderen bleiben sogar nur bei ihrem
Vorsatz. Schade!
Ebenso die Frage, was denn eigentlich noch zum Nachbauen reizt.
Vieles war schon einmal da, anderes gibt es für ein paar Mark fertig
zu kaufen und sieht darüber hinaus noch besser aus, als die eigene
Kreation. Immer wieder die Frage: "Was soll ich denn bauen?"
ln dieser Beziehung bleibt der FUNKAMATEUR am Ball − und
natürlich sind wir auch neugierig auf Ihre Vorschläge und Anregungen.
Selbst, wenn der Lötkolben nicht mehr so oft angeschmissen wird:
Im Herzen bleiben wir der Elektronik treu?
Jörg Wernicke − DL7UJW
Alles Herrn Morses Schuld!
Nur ein paar Monate ist es her, da schreckte das BMPT die
Amateurgemeinde auf: Mitten im 70-cm-Band sollten die GB-Funker
einen Frequenzbereich zugewiesen bekommen. Wer das 10 MHz breite,
zumeist nur rauschende Band kennt, dürfte an sich nicht viel dagegen
haben, zu mal sich bis dato eine gute Million GBer 40 Kanäle teilen
müssen. Der bloße Hinweis auf einen 3 MHz breiten Satellitenbereich
und A TV-Aktivitäten wird bald nicht mehr ausreichen. Immerhin hat man
in Neuseeland und den USA damit begonnen, UHF-Frequenzen
meistbietend an kommerzielle Nutzer zu versteigern. Unsere Bänder
werden wir in Zukunft gemeinsam verteidigen müssen.
Zum Glück derer, die das 70-cm-Band nutzen oder diese Möglichkeit in
ihre Hobbyplanung aufgenommen haben, ließen sich internationale
Regelungen anführen, die eine Zuweisung an weitere Nutzer
ausschließen. So war dem behördlichen Versuch, mal eben eine Million
neue Gebührenzahler herbeizuzaubern, (zumindest vorläufig) kein Erfolg
beschieden.
Nun überrascht uns die Ministerialbürokratie aufs neue: Kurzwellenfunk
soll nach ihren liberalen Überlegungen ohne jede Telegrafieprüfung
möglich sein. Geht man von der rasanten Entwicklung der Kommunika-
tionstechnik aus, so ist dieser Schritt längst überfällig. Gleichzeitig
ginge ein langgehegter Wunsch aller G-Uzenzler in Erfüllung, denen
sich Frequenzbereiche mit großer Reichweite erschließen würden. Weil
es aber auf den Kurzwellenbändern ohnehin schon sehr eng ist und so
mancher die von Repeatern bekannten Runden fürchtet, ist die Haltung
vieler KW-Funkamateure zu verstehen, die auf das QRM Tausender
neuer "Kollegen" keinen Wert legen.
Der DARG − die Interessenvertretung der meisten deutschen
Funkamateure − trat in einem Statement gegenüber dem BMPT sofort
energisch gegen den morsefreien KW-Zugang auf. Internationale
Regeln der IARU waren zusätzliches Argument, den BMPT-Vorstoß
zurückzuweisen. Lang und breit wurde mit richtigen Argumenten, aber
unglücklichen Formulierungen, aus der Feder der KW-Lobbyisten
dargelegt, weshalb Telegrafie so immens wichtig für jeden Funkamateur
ist. Und so ließ der Text dann auch den Rückschluß zu, Telegrafieunkundigen
würde der Harnspirit weitgehend abgesprochen.
Diese durchaus mögliche Interpretation des oben genannten
Statements hat viel Staub aufgewirbelt und zu teils heftigen Reaktionen
aus den Reihen der G-Uzenzler geführt, was den DARG-Vorsitzenden
mittlerweile veranlaßt hat, die betreffenden Darstellungen zu relativieren
bzw. zu rechtfertigen. Nicht an die Funkamateure seien die Argumente
gerichtet gewesen, sondern an die Banner Behörde. Wenn dem so ist,
und daran besteht kein Zweifel, dann hätte man sich zumindest die
Veröffentlichung in der GQ DL sparen können.
Schade, daß die Diskussion einer für die Zukunft des Amateurfunks so
wichtigen Frage wieder mehr gespalten als vereint hat.
Beste 73!
Ihr Knut Theurich, DGOZB
Auf die Dauer hilft nur Power?
An dieser Devise (allerdings mit Ausrufezeichen) orientieren sich
viele Funker, sei es auf den Amateurfunkbändern oder auch im
CB-Bereich. Bekannte Slogans wie "mit Profi-Power durch die
Pile-Up-Mauer" und "Life is too short for QRP" fördern dies noch.
Hier spielen Fragen der Moral und Ethik hinein, Prestigedenken
oder nüchterne Überlegungen, die gewünschten Verbindungen so
schnell wie möglich "abzuhaken".
Sicher, Zeit ist knapp. Insofern ist ein Linearverstärker schon hilfreich.
Ebenso bedingen bestimmte Ausbreitungsarten, wie zum Beispiel
EME auf 2 m/70 cm oder interkontinentale Kurzwellenverbindungen,
nicht nur auf 160 m, einen höheren Sendepegel. Auch für Contester
ist bei einem Anspruch auf vordere Plätze die Endstufe ein Muß.
Dazu kommen unzählige OXer, die eine begehrte Station am anderen
Ende der Weft im Pile Up unbedingt erreichen wollen.
Trotzdem sollte man sich vor Augen halten, wohin diese Leistungs-
spirale führt. QRO erhöht die Wahrscheinlichkeit von Störungen und
vermehrt das QRM auf den Bändern. Vor vielen Jahren war es möglich,
mit 100 W stabile Verbindungen nach allen Erdteilen zu führen.
Das wäre trotz stärkerer Konkurrenz heute sicher auch noch möglich,
aber ehe eine 100-W-Station mal an die Reihe kommt, waren vorher
fast alle Endstufennutzer dran. Mit guter Betriebstechnik läßt sich
das nur eingeschränkt kompensieren; auch unter den PA-Betreibern
sind genügend Könner.
Weltweit gibt es über 2 Millionen lizenzierter Funkamateure. Da wir
den Trend zu höheren Leistungen kaum aufhalten können, bleibt
nur eines: Analog zum Straßenverkehr, wo viele Fahrer nach immer
größeren, sicheren und schnelleren Autos streben, an Vernunft,
Rücksichtnahme und Selbstdisziplin des einzelnen zu appellieren.
ln Deutschland sind auf Kurzwelle 750 WAusgangsleistung
zugelassen - eine vernünftige Größenordnung, aber nur, wenn man
sie sparsam und bei Notwendigkeit einsetzt. Immerhin verlangt
auch der Gesetzgeber, die Leistung auf das erforderliche Maß
zu beschränken.
Der QRPer soll hier keinesfalls vergessen werden − wenn er nach
tagelangem Anstehen die seltene Station auch erreicht, ist sein Erfolg
natürlich ungleich höher zu bewerten. Ich meine damit echten
QRP-Betrieb und nicht eben mal einen Rapportaustausch nach dem
Herunterschalten von 500 W auf 5 W.
Es geht auch um die Art und Weise unseres Umgangs mit QRO.
Rüde Bandkommentare wie: "Jetzt legen wir eine Kohle auf und
werden den Gontest-Kaffern mal zeigen, wem die Frequenz gehört"
zeugen von harter Ellenbogenmentalität Rücksicht zu nehmen auf
Minderheiten und ihre Frequenzen zu akzeptieren, steht uns sicher
besser zu Gesicht. Setzen wir die Endstufen nur ein, wenn sie
wirklich gebraucht werden. Verhalten wir uns betriebstechnisch
fair und praktizieren Ham Spirit.
73 und awdh auf den Bändern
Rolf Thieme, DL7VEE
Eine Lanze für den Sysop
Harn Spirit. Ein großes Wort. Daß es fast in Vergessenheit geraten sei,
wird allenthalben beklagt. Was heißt, daß die bis weit über die Mitte
des Jahrhunderts dem Amateurfunk zugeschriebenen Tugenden
Hilfsbereitschaft und Uneigennützigkeit mehr oder weniger einer
allgemeinen Ellenbogenmentalität und dem sturen Einklagen
vermeintlicher oder tatsächlicher Rechte gewichen seien.
Oder ist das nur eine Variante der immer wiederkehrenden Klage, daß
früher alles besser war und die Jugend von heute nichts mehr taugt?
Doch auch heute gibt es Klubstationsleiter, Ausbilder, Fuchsjagdaus-
richter, Rundspruchredakteure und diverse andere Idealisten… Eine
Gruppe von Enthusiasten steht dabei besonders im Rampenlicht:
die Sysops, System Operateure, wobei hier nicht nur die der Packet
Radio-Szene gemeint sind, sondern beispielsweise auch Relais-
betreiber. Sie agieren im Hintergrund, opfern neben der Freizeit meist
auch noch erkleckliche Summen − um zuletzt oft genug als Prügel-
knaben dazustehen.
Sicher, eine Aufgabe zu übernehmen, heißt auch, sich die Pflicht
aufzubürden, sie ordentlich zu erfüllen. Aber Sysops pflegen ihre
Technik nebenbei, denn sie haben auch noch anderes zu tun.
Und da ist es wohl unbillig, sie aus dem Bett zu klingeln, weil mal ein
Link nicht funktioniert.
Nimmermüde wird über Spenden für Relais, Digipeater oder Mail-
boxen diskutiert. Ich meine, wer solche Einrichtungen häufig nutzt,
sollte schon sein Scherflein zum Betrieb beitragen; wenn das Geld
knapp ist, vielleicht auch einmal in Form einer Arbeitsleistung? Ein
Recht hat der Sysop darauf aber nicht.
Problem zwei: der Zensor. Wer die Packetszene kennt, weiß,
wovon die Rede ist: Dieses leicht zu mißbrauchende Medium hat
sich in einigen Bereichen zur Tribüne für diffamierende Auseinander-
setzungen entwickelt. Nirgendwo kann man außerdem, per Ruf-
zeichenmißbrauch anonym bleibend, leicht ein so großes Publikum
erreichen. Was also soll der Sysop tun, wenn er Mißbrauch vermuten
muß? Schwer genug, die Box ständig durchzustöbern, man muß ihm
wohl zugestehen, "seine" Box nach bestem Wissen und Gewissen
vor dem Gröbsten zu schützen − im Interesse von uns allen.
Drittens: Diskussion über mögliche Nutzungsbeschränkungen
zugunsten zahlender User. Ich meine, wer da keinen anderen Ausweg
findet, muß seine Anlage eben schließen und/oder eine gebühren-
pflichtige Telefon-Mailbox aufmachen, aber zuvor nochmals Hilfe bei
seinen Usern, seinem DARC-Ortsverband o. ä. suchen. Schließlich
wurden die Amateurbänder allen Funkamateuren gleichberechtigt
zugestanden.
Ebenso ungerechtfertigt erscheint mir der Wunsch etlicher Funkama-
teure, die persönlichen Boxfächer vor fremdem Einblick zu schützen.
Amateurfunk war immer öffentlich; wozu gibt es Telefon samt DFÜ
und Fax? Bei DL7UUU@DBOGR und DFOFA@DBOGR mag lesen,
wer möchte. Aber das hat mit den Sysops ja nur noch indirekt zu tun.
Beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Sich ins gemachte Netz setzen?
Inzwischen werden die meisten Funkamateure schon etwas über die
Diskussion der 70-cm-Problematik erfahren haben, in der es darum geht,
daß der Deutsche Arbeitskreis für CB- und Notfunk e. V. (DAKfCBNF)
beim Bundesministerium für Post und Telekommunikation in einem
Gespräch vom 2. 12. 1993 mindestens 1,5 MHzvom 70-cm-Band fürden
CB-Funk forderte. Das BMPT sicherte daraufhin eine Prüfung dieser
Forderung zu.
Am 18. 12. 1993 fanden Gespräche zwischen dem DARG und dem
DAKfCBNF statt, in denen der Vorstand des Deutschen AmateurRadio-
Clubs e. V. sich bereit erklärte, die ins Spiel gebrachte Nutzung
des UHF-Bandes auf der Grundlage des Gesetzes über den Amateurfunk
zu prüfen.
Dies führte von seiten des DARG (12. 4. 1993) zu der logischen
Schlußfolgerung, dem CB-Verband als Entwurf eine Einsteigerlizenz (70 cm,
kein A TV-, Satelliten- und Crossband betrieb, Leistungsbeschränkung
auf 5 W) vorzuschlagen, die auf der Grundlage des Amateurfunkgesetzes
zum Errichten und Betreiben einer Amateurfunksteils berechtigt: Von den
Genehmigungsinhabern wäre also die Einhaltung der IARU-Bandpläne
zu wünschen. Die Prüfung soll auf die Anforderungen einer Anfängerlizenz
zugeschnitten sein und im "Multiple Choice"-Verfahren stattfinden. Im
Prüfungsteil Technik wird überwiegend qualitatives Grundwissen erwartet,
in Betriebstechnik und Kenntnis von Vorschriften ein der derzeitigen
C-Lizenz vergleichbares Wissen. Alles in allem ein Konzept, gegen das
kein Funkamateur etwas haben dürfte, da es letztendlich dazu dient,
Nachwuchs zu schaffen.
Allerdings wäre dann der Ex-CBer auch kein "Jedermann"-Funker mehr −
und dies alles wird dem Vorstand des DAKfCBNF nicht mehr so richtig
in die Rille passen, ist doch sein Motto: "Funk ist zu wichtig, um ihn nur
Amateuren zu überlassen − gut, daß es CB-Funk gibt, Deutschlands
größtes Sprechfunknetz". Ich glaube, dieses Statement spricht für sich!
Anscheinend stößt sich der CB-Arbeitskreis am Wort "Amateur" und
zieht dabei vielleicht auch die Dudenerklärung "Nichtfachmann" heran.
Die Herren hätten doch lieber die Erläuterung im Gesetz zum
Amateurfunk lesen sollen: "Funkamateur ist, wer…", die kennen wir
Lizenzierte alle. Nun ja, jeder kann sich sein Verslein darauf reimen!
Mag sein, daß ein Teil der CB-Funker einen rücksichtsvollen Funkverkehr
wünscht, aber leider kennt die Menge das Wort Höflichkeit nicht. Wer
legt seine Hand dafür ins Feuer, daß die zugewiesenen Frequenzen einge-
halten werden? Gar zu leicht könnten beispielsweise die Spielchen vom
"Trägerstellen" oder andere CB-Praktiken im "echten" Amateurband wei-
tergehen! Hat irgendjemand aus diesem Kreis einmal daran gedacht, daß
uns Funkamateuren die Frequenzen nicht in den Schoß gefallen sind und
der Amateurfunk einen international anerkannten Funkdienst darstellt?
Kennt einer z. B. die (finanziellen) Anstrengungen der Sysops oder Relais-
verantwortlichen, die uneigennützig unserem Hobby dienen, oder gar
jener, die Amateurfunksatelliten bauen und und und…?
Da kann es nicht anders sein: Wer auf Amateurfunkbänder will, der muß
eine fachliche Prüfung ablegen. Wir mußten es auch.
Ihr Jörg Wernicke
How much Multimedia?
Besitzer eines Computers haben sich, wenn sie auf der Höhe der Zeit
sein wollten, natürlich schon ein CD-ROM-Laufwerk installiert, und die
ersten glänzenden Scheiben sind ebenfalls bereits vorhanden. ln
diesem Zusammenhang ist immer häufiger das Wort Multimedia in aller
Munde und verdient natürlich auch der Freaks Aufmerksamkeit. Nun
ist es möglich, Videosequenzen gepaart mit sattem Stereosound vom
PC abspielen zu lassen, ja, sich sogar kleinere Spielfilme anzusehen.
Wer hätte das vor einigen Jahren für möglich gehalten!
Das Geschäft ist in vollem Gange: Aus dem Meer aus Sound- und
Grafikkarten sowie CD-ROM-Laufwerken ist es schon nicht mehr leicht,
sich sein Equipment herauszuangeln − bei der Software allerdings sind
die Anschaffungsprobleme noch größer. Gar nicht einmal der Preise,
vielmehr des Inhalts wegen. Das Angebot an CDs ist mittlerweile
recht groß − und nur die Hersteller wissen, was eigentlich drauf ist.
Bei einer Spiele- oder reinen Utility-Scheibe ahnen die meisten
schon, was sie zu erwarten haben, denn im Grunde genommen reicht
eine CD je Themengebiet völlig aus, da die unterschiedlichen
Hersteller ja auf das gleiche Repertoire zugreifen. Das ist in der Regel
auch bei Grafik- und Soundtiteln der Fall, und so findet sich z. B.
dasselbe Manhatfan-Motiv auf fast allen Bilderscheiben.
Anders bei speziellen Angeboten, wie Lexika, Reise- oder Städteführern
usw. Hier weiß man nicht, was einen erwartet. Trotz relativ hoher
Anschaffungskosten bin ich selbst schon enttäuscht worden, was
angepriesene Videosequenzen usw. betraf. Es kostet eben sehr viel
Mühe und Zeit, eine CD anzufertigen, die speicherplatzmäßig gut
ausgelastet und deren Inhalt optisch wie akustisch gut aufgemacht ist.
Zugegeben, gute Ansätze sind da, das Gelbe vom Ei ist es aber
meist noch längst nicht. Deshalb kann ich vor Anschaffung einer
"Multimedialen" nur dazu raten, sich genau zu erkundigen, was die
CD wirklich "kann".
Um das Thema Photo-CD auch noch zur Sprache zu bringen: Inzwischen
kann sich jeder seine Urlaubs- oder Erinnerungsbilder auf CD bannen
lassen, sie mit entsprechender Software auf dem Monitor ansehen
oder sie gar bearbeiten. Aber das war's auch schon, denn eine gute
Präsentation mit Tonuntermalung kann nur der erreichen, der eine
schnelle Maschine mit viel Speicher besitzt, ansonsten kommt
schnell Gähnen auf Die Qualität eines Diapositivs erreichen Photo-CDs
auf dem Bildschirm trotz großer Pixelanzahl nicht, das wird jeder
Foto-Profi bestätigen können − Brillanz und Kontrast bleiben dabei
auf der Strecke. Bei Fotos sollte der ernsthafte Amateur deshalb den
guten alten Projektor vorziehen und den Rechner nicht auch noch
damit belasten. Hinzu kommt, daß der Blickwinkel eines Monitors
begrenzt ist, das Dia aber mit geringen Helligkeitsverlusten bedeutend
größer darstellbar ist. Allerdings sind Photo-CDs für SSTV- und
Faxamateure eine echte Alternative, kann man dabei doch auf anderes
Equipment verzichten und relativ einfach zu sendefähigen, persönlichen
Vorlagen kommen.
Ihr
Jörg Wernicke
Mit einer Zunge sprechen
Funkamateure lieben Kommunikation. Kommunizieren heißt miteinander
reden, und da liegt der Hase im Pfeffer. Mögen Funkamateure auch noch
so viel Hochfrequenz bei den ihnen eigenen Aktivitäten untereinander
produzieren − wenn es darum geht, ein Miteinander zu demonstrieren, ob
mit oder ohne Mikrofon und Taste, scheint das Kommunikationsmodell
Sender/Empfänger nicht mehr zu funktionieren.
Es war im Oktober 1993, als der Bundestagsausschuß für Post und Tele-
kommunikation einen Appell an die Funkamateure richtete, sich doch −
endlich, meinte man zwischen den Zeilen lesen zu dürfen − zu einer lnte-
ressenvertretung zusammenzufinden. Immerhin hatte es die sich in die
Länge ziehende Diskussion um die neue Durchführungsverordnung zur
Genüge gezeigt: Es gab nicht nur einen Gesprächspartner für das BMPT,
der sich in Bonn zu Wort meldete. Daß dabei allzu häufig nicht mit-,
sondern gegeneinander geredet wurde, blieb auch den Politikern nicht
verborgen, und so kam es schließlich − was Wunder − zu dem Appell,
dem sich das BMPT im Februar in einer Empfehlung anschloß.
Für die Mehrheit der deutschen Funkamateure sprechen sollte diese
lnteressenvertretung, bundesweit organisiert sein, sämtliche Sparten des
Amateurfunks repräsentieren und in ihrer Geschäftsordnung die Ein-
bindung von Minderheitsvoten sicherstellen. Eigentlich kein Problem für
den DARG, diese Punkte zu erfüllen, könnte man meinen. Oder sollte es
mit letzterem doch nicht so einfach bestellt sein? Ein Minderheitsvotum
zuzulassen, heißt ja nicht mehr und nicht weniger als Einzelinteressen zu
berücksichtigen, auch wenn sie nicht durch eine Mehrheit abgedeckt
sind. Voraussetzung für eine solche Berücksichtigung kann natürlich nur
sein, Vertreter solcher Minderheiten in die Diskussion einzubinden. Doch
darin liegt das Problem. Gelänge es dem DARG, dieses Kunststück fertig-
zubringen, wäre auch das Gerangel um die Legitimation zur Zulassung von
Interessengruppen zu dem vom DARG zunächst einberufenen, dann aber
wieder verschobenen "Runden Tisch" vom Tisch. Dies wäre angewandte
Demokratie. Jede Zutrittsverweigerung nicht genehmer Gesprächspartner
und jeder Raussehrniß von unliebsamen, weil unbequemen oder un-
sachlichen, gar feindseligen Kritikern nährt aber das Gefühl, nicht um die
Sache, sondern um die Person zu kämpfen. Konzentration auf die wichtigen
Dinge ist daher vom DARG gefragt, allerdings auch Transparenz seiner
Entscheidungsfindungen. Und jede Kritik daran sollte einen in sich
gefestigten DARG nicht erschüttern können.
Genau besehen hat der DARG in der Praxis bereits längst von der Ge-
nehmigungsbehörde die Aufgabe einer Interessenvertretung für alle
Funkamateure in Deutschland übertragen bekommen, denken wir nur an
die Koordination und Auswertung des jüngst neu gestarteten 50-MHz-
Großversuchs. Der DARG sollte dies als Herausforderung annehmen.
Dazu ist Konsensfähigkeit gefragt, innerhalb des DARG, unter den mit-
einander ringenden Interessenvertretern und zwischen ihnen und dem
DARG. Vielleicht gelangen wir so letzten Endes bei der Diskussion um
eine Interessenvertretung doch zu einer Lösung, die dem kommunikativen
Gedanken des Amateurfunks ein wenig mehr entspricht und, nomen est
omen, den Interessen der Funkamateure dient.
ln diesem Sinne beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Ist das die Rache?
Da hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten (EMVG) im November 1992 eine Grundlage
geschaffen, die die störungsfreie Funktion von elektrotechnischen
Geräten garantieren soll. Dabei wurden Amateurfunkgeräte
ausdrücklich ausgenommen − es sei denn, sie sind im Handel erhältlich.
Störungen zu beseitigen kostet Geld. Dazu trat im Juli 1993 eine
Kostenverordnung für Amtshandlungen nach dem EMVG in Kraft.
Diese Verordnung tritt jedoch nur bei Verstößen gegen das EMVG
ein. Liegt dagegen kein schuldhartes Verhalten vor, werden die Kosten
für die Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit durch
Beiträge gedeckt, die von allen Senderbetreibern − und um die geht
es im Falle dieser Beiträge ausschließlich − zu leisten sind. Dies regelt
eine Beitragsverordnung, die im November 1993 Gültigkeit erlangte.
Sie enthält die Berechnungsverfahren, nach denen die Kosten unter
Berücksichtigung des Teilnehmerpotentials, des Störungsaufkommens
und der Frequenznutzung auf die Senderbetreiber umzulegen sind.
Die Folgen bekam jeder Funkamateur zu spüren, als er im Januar
1994 den angekündigten Beitragsbescheid erhielt.
Ein Sturm der Kritik setzte ein. Der DARG riet seinen 60 000 Mitgliedern
zum Widerspruch gegen die Bescheide, knapp 20 000 waren es bis
zur zweiten Februarwoche, die diesem Rat folgten. Gegenstand der
Kritik ist die Tatsache der erhobenen Beitragsforderung, aber ebenso
ihre Berechnungsgrundlage wie auch das Verfahren des Einzugs.
Nicht nur, daß es alle "Senderbetreiber" trifft, auch wenn sie innerhalb
einer Familie an ein und derselben Station sitzen oder wenn sie seit
Jahren gar kein Funkgerät besitzen. Auch solche Amateurfunk-
Senderbetreiber werden erfaßt, die ihre Geräte selbst gebaut haben
und somit ausdrücklich nicht unter das EMV-Gesetz fallen. Sodann
enthielten die Beitragsbescheide keinen Hinweis darauf, wie sich die
Summe von 38,50 DM jährlich errechnet, obwohl dies ausdrücklich
in der Beitragsverordnung bestimmt worden war. Zu kritisieren ist
auch, daß im EMVG von vornherein festgestellt wird, daß das BMPT
selbständig den Kreis der Beitragspflichtigen, die Beitragssätze sowie
das Verfahren der Beitragserhebung festlegen darf, ganz im Gegensatz
zu den Gebühren nach der Kostenverordnung, die einer Zustimmung
des Bundesrates bedurften. Auch am Erhebungsverfahren zusammen
mit der Fernmelderechnung gibt es harsche Kritik, deren Berechtigung
sogar das BAPT selbst in seinen Beitragsbescheiden in einem
Postscripturn zugibt. Ein hoher Anteil der Fernmelderechnungen −
nach BAPT-Angaben etwa 80 % − macht vom Lastschriftverfahren
Gebrauch. ln bezug auf die EMV-Beiträge liegen jedoch meist keine
gültigen Einzugsermächtigungen vor. Hinzu kommt, daß der
Genehmigungsinhaber häufig gar nicht der Fernmeldekontoinhaber ist.
Das BAPTsteht vor dem Problem, 86,69 Millionen DM an Kosten
auf alle Senderbetreiber aufzuteilen. Darin sind, wie es heißt, auch
Maßnahmen bei 56-Störungen enthalten, soweit S6-Kabelnetz-
betreiber keine Schuld trifft. Im Klartext: Die Kosten für die Bearbeitung
der von den Funkamateuren so fleißig zusammengetragenen
S6-Störmeldungen werden nun eben den Gestörten aufgebürdet.
Ist das die Rache?
Dr. Hans Schwarz, DKSJI
Auf gute Zusammenarbeit!
Der FUNKAMATEUR hat in seiner 42jährigen Geschichte sicherlich
so manche Standortbestimmung erlebt, bis er sein heutiges Gesicht
als "Das Magazin für Funk, Elektronik, Computer" erhielt.
Als "Neuankömmling" in der Redaktion sei es mir an dieser Stelle
dennoch gestattet, ein paar Gedanken zum Inhalt dieser Zeitschrift
zu äußern.
Es hat sicherlich gute traditionelle Gründe, daß die Zeitschrift ihren
Titel FUNKAMATEUR durch alle Zeiten hindurch bis heute verteidigt
hat, bildet doch der Amateurfunk ein wichtiges Bindeglied zwischen
den Themengebieten Funk, Elektronik und Computer, wie sie im
Untertitel ja auch genannt werden. Gerade im Amateurfunk bietet
sich die Synthese zwischen Theorie und Praxis, Planung, Bau
und Anwendung, Technik und Betrieb besonders deutlich dar. Hinzu
gesellen sich andere Funkanwendungen in der Form des CB-Funks,
aber auch des Funkempfangs von BC, Utility usw.
Grundlage all dieses Tuns ist aber die Elektronik, die dem Kreativen
ein schier grenzenloses Betätigungsfeld eröffnet.
ln der Anwendung immer weiter verselbständigte Elektronik findet
sich in der Computertechnologie, die den Menschen nun völlig
einzunehmen scheint, aber auch ständig neue, ungeahnte Möglich-
keiten eröffnet.
Faszination des Funks, Mythos der Elektronik, Geheimnis des
Computers. Hilflosigkeit vor dem technischen Fortschritt ist nicht
angebracht, eher ein Mitgehen, Miterleben, Selbstbeteiligen. ln diesem
Sinne verstehen wir uns als Vermittler der Grundlagen, die notwendig
sind, um an diesem Fortschritt teilzuhaben. Dabei wollen wir keine
hochspezialisierte Zeitschrift sein, da gibt es bereits für fast jedes
Spezialinteresse eine. Unsere Aufgabe soll darin bestehen, eine
breite Grundlage zu schaffen, Freude an der Beschäftigung mit
Technik − ob nun Funk, Elektronik oder Computer − zu vermitteln
und Brücken zu schlagen zwischen den einzelnen Interessen-
richtungen. Der Leser soll angeregt, angeleitet und befähigt werden,
Erkenntnisse nachzuvollziehen und damit seine eigenen Erfahrungen
beständig zu erweitern.
Eines liegt uns aber ganz besonders am Herzen: Fortschritt ist nur im
Dialog möglich, und so möchten wir auch für unsere neuen Leser in
eine Vermittlerrolle treten. Wir wissen, daß es ein gewaltiges Potential
an Fähigkeiten und Ideen gibt. Diesen Schatz gilt es zu heben, um
andere davon profitieren zu lassen. Daher sind wir auf Ihre Mitarbeit
angewiesen. Wenn Sie Bauvorschläge im Bereich der Elektronik oder
der Funkanwendung haben, praktische Tips, interessante Neuigkeiten
− schreiben Sie uns.
Die Zeitschrift soll von Lesern für Leser gemacht werden. Machen Sie
mit? Wir freuen uns darauf!
Mit vielen Grüßen − vy 73
Dr. Hans Schwarz, DK5JI
Packet-Unbill
Immer mehr Funkamateure entdecken ihr Faible für Packet Radio. Obwohl
allen "Digimodes" ja bequeme Speicherbarkeit und leichte Dokumentie-
rung der übertragenen Nachrichten eigen ist, zeichnet sich Packet Radio
auf UKW mit seinen Digipeatern noch durch einfachen Zugang und
hohe Übertragungsgeschwindigkeit aus.
Wie überall gibt es schwarze Schafe, die teils aus Böswilligkeit, teils aus
Ignoranz oder Unvermögen, je nach Betriebsart auf unterschiedliche
Weise Ärger machen. Was im KW-Pile-Up die Trägersteller auf der
DX-Sendefrequenz, sind vielleicht auf UKW die anonymen Relais-
auftaster.
Wenn weniger provozierend die Partner einer zweiseitigen Funkverbin-
dung irgendwelchen Mumpitz erzählen, muß man ja nicht unbedingt
zuhören und dreht weiter. Zum einen Ohr 'rein, zum anderen 'raus −
keine großen Wellen im Karpfenteich. Ungefähr dieselbe Nichtbeachtung
durch Dritte erfahren zwei, die sich perPacket Radio direkt befunken,
selbst, wenn sie dazu das Digipeaternetz bemühen.
Aber nun hat da noch jemand die Packet-Mai/boxen angebunden, dazu
bestimmt, aktuelle amateurfunkrelevante Informationen abrufbereit zu
halten, Satellitenbahndaten, DX-Nachrichten und vieles mehr. Zu den
Rubriken, in die nun jeder Funkamateur Nachrichten mehr oder
weniger geschickt zwecks späteren gezielten Zugriffs durch andere
Funkamateure verteilen kann, gehören auch ALLE, DIVERSES, MEINUNG
und DARG. Schön, daß man dort den vorigen DL-Rundspruch "melken"
kann, aber auch alle anderen Nachrichten in der Box haben letztlich
Rundspruchcharakter, sollen ja von vielen gelesen; können nach Bedarf
sogar ausgedruckt und schwarz auf weiß abgeheftet werden − natürlich
auch von den Überwachungsstellen des BAPT.
Also: Jeder, der möchte, wird zum Rundspruchschreiber. Okay, wenn er
es kann und etwas Vernünftiges zu vermelden hat, fatal, wenn er es nicht
kann oder erst recht, wenn er es könnte, aber vorsätzlich nicht will. Immer
wieder negative Beispiele: persönliche oder allgemeine Diffamierungen,
Beleidigungen, Anwürfe, ohne sich vorher hinreichend informiert zu
haben, bis zu obszönen oder antisemitischen Einspielungen. Auch die
teils geradezu chaotische PR-Podiumsdiskussion über eine neue
DV-AFuG war bestimmt nicht dazu angetan, beim Gesetzgeber Wohl-
wollen oder einen Eindruck von Geschlossenheit der Funkamateure
hervorzurufen. Und die Texte dazu finden sich in den PR-Rubriken auch
gleich aktengerecht aufbereitet.
Besondere Akzente erhält die Misere noch dadurch, daß es leicht möglich
ist, Nachrichten unter einem falschen Absenderrufzeichen in Umlauf zu
bringen, wobei die armen Sysops, die ja für gesetzeskonformen Betrieb
ihrer Box geradestehen müssen, als Zensoren beschimpft werden, wenn
sie Auswüchsen entgegentreten.
Fazit? Wenn jemand einmal überlegt, was er sagt, sollte er dreimal über-
legen, was er in eine Box schreibt. Wer etwas Befremdliches dort liest,
muß bedenken, daß es getürkt sein könnte. Und schließlich gilt es,
eigene Reaktionen auf Negatives sorgfältig auf seine Eignung zur Be-
kämpfung des Übels abzuklopfen, um den Schaden für den Amateurfunk
so gering wie möglich zu halten.
In diesem Sinne beste 73!
Bernd Petermann, DL lUUU
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Und sie basteln doch
Steckdosenamateure, so werden wir Funkamateure schon mal von löt-
kolbenliebenden Elektronikern genannt. Ein verächtliches Wort für die OMs,
die viel und gern zum heißen Kolben greifen − für diejenigen, die über das
gelegentliche Anlöten von Steckern hinaus nichts mehr mit Kolophonium-
dämpfen im Sinn haben (wollen?), eine Feststellung, die sie mit Achsel-
zucken quittieren.
Sei es, wie es sei. An unserem Messestand auf der diesjährigen Interradio
hatte ich Gelegenheit, diese Frage mit vielen Besuchern und auch Aus-
stellern zu diskutieren. Seltsamerweise war immer wieder ein und dieselbe
Meinung zu hören: Basteln? Gern, aber der Aufwand muß im Rahmen
bleiben. Eine von Schaltkreisen strotzende Interfacekarte für einen Rechner
beispielsweise würden die meisten Befragten lieber fertig kaufen oder als
Bausatz beziehen, vorausgesetzt, sie brauchen sie. Aber ein kleines (preis-
wertes) Gerät, das sich − sagen wir, an einem Wochenende − unkompliziert
aufbauen läßt, kann einen schon wieder reizen, in die Basteikiste zu
greifen.
Auf einen Punkt gebracht, kann man resümieren, daß der größte Teil der
Basteiprojekte bestimmte Forderungen erfüllen muß: Erstens darf der Auf-
wand an Zeit und Geld nicht zu hoch sein, zweitens sollte sich ein schnelles
Erfolgserlebnis einstellen und drittens ist es ein großer Anreiz, etwas zu
bauen, was die Industrie nicht schon billig anbietet.
Sicher gibt es auch Amateure, die sich zum Beispiel HiFi-Anlagen selbst
bauen, auch, wenn ein gekaufter Tuner qualitativ besser ist und vielleicht
weniger kostet. Was bei ihnen zählt, ist der Stolz auf Selbstgebautes. Auch
(vermutlich aber nur einige?) Funkamateure scheuen sich nicht, einen
SSB-Transceiver oder ein anderes aufwendiges Gerät aufzubauen.
Betrachtet man in einer Basteifiliale das Treiben vor einem Bausatzregal,
fällt auf, daß man doch gern zu der einen oder anderen Tüte greift. Es
scheint nicht wenige Elektroniker zu geben, die eigene Projekte zugunsten
eines Bausatzes verschieben, zumal diese Art Basteiobjekt meist die er-
wähnten drei Kriterien erfüllt und das Vorhandensein aller erforderlichen
Einzelteile sowie der Platine zu sofortigem Aufbau reizen.
Da hat es ein Magazin, wie beispielsweise der FUNKAMATEUR, nicht ganz
leicht. Es allen recht zu machen, ist sehr schwer, und der Leser muß oft
erst einen gewissen Trägheitspunkt überwinden, da zum einen zumindest
noch einige Bauelemente zu besorgen und zum anderen die Leiterplatte
anzufertigen oder zu bestellen ist.
Bleibt letztlich nur der Trend zu einfachen, aber ideenreichen Bauanleitun-
gen mit Pfiff, die einen zum Basteln anregen und auch dafür sorgen, daß
der Lötkolben nicht einrostet, sei es auf dem Gebiet der Elektronik, der
Computerhardware oder im Amateurfunk Lesermeinungen ist zu entnehmen,
daß es viele Basteisympathisanten gibt, die besonders solchen Beiträgen
den Vorzug geben. Das schnelle Erfolgs- und Lernerlebnis hat in dieser
Beziehung seinen Reiz nicht verloren, und oft kommt der Wunsch auf, die
eine oder andere Schaltung nachzubauen oder gar eigene zu entwickeln.
An dieser Stelle sind Sie angesprochen, da der FUNKAMATEUR weiter
eine Zeitschrift von Lesern für Leser ist. Arbeiten Sie mit, damit sie noch
attraktiver wird und der Ruf eines Steckdosenamateurs mehr und mehr
verhallt. Auch Meinungen und Anregungen interessieren uns, wir haben
die Postbox, in der Sie Ihre Ansichten und Hinweise darlegen können.
Ihr
Jörg Wernicke
3. DV-AFuG-Entwurf: vieles offen
Der "Endgültige Entwurf der Verordnung zum Gesetz über den Amateur-
funk" in unserer Mai-Ausgabe war nun doch wohl so endgültig nicht. Nach
vielem Widerspruch und insbesondere vom DARG durchdachten Gegen-
vorschlägen schloß unser Juli-Editorial zum abschließenden Hearing mit:
"Vieles ist offen. Wir sind auf die nächsten Schritte des BMPT gespannt".
Nun erregte ein (eigentlich interner) 3. Entwurf des nun wieder als Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes über den Amateurfunk (DV-AFuG)
bezeichneten Dokuments die Funkamateur-Gemüter − und danach bleibt
nach wie vor vieles offen.
Diesen erneut erheblich veränderten Entwurf erhielten die Bundesressorts
am 15. 9. 93 zur Abstimmung, die wiederum für den 30. 9. anberaumt war.
Die Amateurfunkverbände sollten danach nicht noch einmal angehört werden,
was inzwischen aber nicht mehr ganz so sicher scheint. Der weitere Weg
wäre die Fertigstellung der DV und deren Weiterleitung an den Bundestags-
ausschuß für Post und Telekommunikation. Wer sich für den genauen
Inhalt interessiert, sei auf die Rubrik Nordlink der Mai/boxen verwiesen.
Was zuerst auffällt, ist die wesentliche Verkürzung der DV. Aus dieser
Abmagerung nährt sich auch ein gewisses Unbehagen: An vielen Stellen,
deren Inhalt im vorigen Entwurf klar formuliert war, wird nämlich nun nur
noch auf das Amtsblatt des BMPT oder eine Verordnung über die fachliche
Prüfung für Funkamateure verwiesen. Das betrifft u. a. so wesentliche
Punkte wie Frequenzen (50 MHz?), Leistungen, technische und betriebliche
Bedingungen (keine Angaben über Lizenzklassen), das Anzeigeverfahren
für "stets unbesetzte Amateurfunkstellen…", CEPT-Regelungen, Zuteilung
und Verwaltung von Rufzeichen und die Störstrahlungsgrenzwerte von Ama-
teurfunkgeräten, die nicht unter das EMV-Gesetz fallen.
Wenn das Amateurfunkgesetz der Rahmen ist, stellt diese DV-Variante
sozusagen nur noch eine Art Unter-Rahmen dar, den die Behörde dann auf
dem Verwaltungswege kurzfristig und auch recht häufig neu ausfüllen kann
− ohne solch umständliche Wege wie bei der DV selbst. Das mag für die
Funkamateure einmal vorteilhaft sein, weil es schnelles Reagieren ermög-
licht, ruft andererseits aber die Besorgnis hervor, das Ermessen der Behör-
de könnte über Nacht auch einmal sehr negative Vorgaben zeitigen.
Zunächst bleibt offen, was im ersten Anlauf überhaupt in den Amtsblättern
stehen wird - erscheint z.B. wieder die beim vorigen Entwurf von den
Verbänden vehement bekämpfte Leistungsreduzierung auf drei UKWBändern?
Auf der anderen Seite läßt sich konstatieren, daß verschiedene Einwände
gegen den vorigen Entwurf beim neuen berücksichtigt wurden. So betragen
die Gebühren für die Erteilung einer Genehmigung nun nur noch 60 DM,
die jährlichen noch 70 DM (für einen Genehmigungsinhaber unabhängig
von der Zahl der erteilten Rufzeichen). Dieser Entwurf kennt auch
wieder den Begriff Klubstationen, die Regelung für die Benutzung einer
anderen Amateurfunkstelle darf als großzügig gelten und er sieht weiterhin
keine Logbuchpflicht vor. Bemerkenswert, daß der §4 über Einschränkungen
im Amateurfunkverkehr nur vier untersagte Sachverhalte aufführt.
Die Verbände sehen vor allem Probleme darin, daß die Administration
keine (Vor-)Koordinierung unbemannter Stationen vornehmen will.
Soweit es die Kürze des Entwurfs erkennen läßt, hat die Liberalisierung
ganz offensichtlich Bestand. Bleibt die Spannung bezüglich der Nachfolge-
dokumente.
Beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Zankapfel Telegrafie
Die Diskussion um Telegrafie als Prüfungsbedingung für eine Kurzwellen-
Amateurfunkgenehmigung flaut nicht ab. Wer die Telegrafie beherrscht,
möchte, daß auch künftige Anwärter diese Hürde nehmen. Auf der
anderen Seite der KW-Drang technisch versierter UKW-Funkamateure,
die auch eine auf anderen Gebieten schwierigere Prüfung meistern
würden. Daß der internationale Fernmeldevertrag von allen Kurzwellen-
funkern Telegrafiekenntnisse fordert, weil sie ja CW-Notrufe aufnehmen
können müßten (wegen der besonders einfachen Technik und der
unübertroffenen Lesbarkeit selbst unter sehr ungünstigen Umständen),
verliert zunehmend an Bedeutung. Im Seefunk ist CW bereits nicht mehr
ausrüstungspflichtig, und auch Streitkräfte verschiedener Couleur
verzichten zunehmend darauf. Aber praktisch alle Amateurfunkverbände
möchten den Zugang zur KW-Lizenz weiter von der Telegrafieprüfung
abhängig sehen. Nur Nostalgie verknöcherter Funktionäre?
Nun, die Telegrafie erfreut sich auf den KW-Amateurfunkbändern nach
wie vor recht großer Beliebtheit, wenn auch viele KW-Operatoren sie
überhaupt nicht (mehr) beherrschen oder zumindest nicht nutzen, und
OH2BH beklagte, daß sich der CW-Anteil von Expedition zu Expedition
verringere. Telegrafie ist eine Kunst, die auszuüben ganz einfach Spaß
macht- wenn sie nach einiger Praxis wirklich leicht von der Hand geht,
denn mit dem Prüfungstempo ist auf den Bändern mit Ausnahme der
Novice-Bereiche kein Staat zu machen.
Als Funkamateur, der hauptsächlich in Telegrafie arbeitet, glaube ich zwar
nicht, daß diese Art zu funken schon morgen ausstirbt, über kurz oder
lang wird man sie aber als Pflicht-Prüfungsfach fallen lassen (müssen).
Und die Verbände, die sie so hartnäckig verteidigen, sehen sie sicher
nicht zuletzt als Einstiegsschwelle. Eine solche Schwelle, deren Überwin-
dung Aufwand und Beharrlichkeit fordert, wünschen eigentlich alle
Funkamateure, weil sie geeignet ist, gegen die vom CB-Funk bekannten
Auswüchse, die sich abgeschwächt hier und da leider auch im Amateurfunk
zeigen, zu wirken − bei der ins Haus stehenden Liberalisierung der
Gesetzgebung um so wichtiger.
Wie könnte nun so eine veränderte Schwelle aussehen? Folgerichtig
kurzwellenspezifisch. Die von vielen belächelte Variante Fremdsprachen-
kenntnisse erscheint mir für den internationalen KW-Funk beispielsweise
absolut logisch; noch mehr fundierte betriebstechnische Kenntnisse,
denn damit sieht es ja bei den Europäern bekanntlich traurig aus. Aber
auch die "Sonderbetriebsarten" eignen sich (vgl. US-Lizenzsystem),
natürlich in erster Linie die, die auf KW vordringlich vorkommen, wie
RTTY, AMTOR, PACTOR, SSTV (man häre sich einmal die Diskussionen
im Bereich der SSTV-Frequenzen, z. B. 14230 kHz, an!). Den höherklassigen
Lizenzanwärter könnte man vielleicht auch über die Packet-RadioParameter
befragen, wenn davon auch zunächst seine UKW-Nachbarn
etwas haben. Trotzdem sollte CW, vielleicht als "Ersatzvariante" für
Fremdsprachenkenntnisse oder dergleichen, prüfenswert bleiben.
Zum Schluß: Warum muß man bei der BAPT-Prüfung (auch nach dem
neuen AFuV-Entwurf) eigentlich mit der Handtaste geben − die benutzt
doch später kaum ein ernsthafter Telegrafist. Oder noch einen Schritt
weiter: Weil ordentlicher Telegrafiebetrieb zuerst vom Hören abhängt,
wozu überhaupt Geben prüfen?
Beste 73!
Bernd Petermann, DL7UUU
Überall, wo man deutsch spricht
Es ist vollbracht. Knapp drei Jahre deutsche Einheit mußten ins Land
gehen, ehe der FUNKAMATEUR die alte Grenze in Richtung Westen
überspringen konnte. Jetzt endlich ist er bundesweit und in den
deutschsprachigen Nachbarländern nicht nur im Abonnement,
sondern flächendeckend auch im Zeitschriftenhandel zu bekommen.
Insidern mit Verwandten oder Freunden in der DDR war die Zeit-
schrift schon lange ein Begriff, die Mehrheit der Altbundesbürger
aber kannte den FUNKAMATEUR noch nicht.
Das ist jetzt anders. Auf der Ham Radio 1993 war Premiere des
FUNKAMATEUR im Altbundesgebiet Über 8000 Besucher konnten
ein kostenloses Probeexemplar mit nach Hause nehmen. Diejenigen,
mit denen wir am Messestand ins Gespräch kamen, äußerten sich
positiv über das für sie neue Produkt. Unter dem Strich stehen über
900 neue Abonnenten, keinesfalls nur Funkamateure.
Was offensichtlich alten und neuen Lesern gleichermaßen gefällt, ist
die Themenvielfalt Praktisch für jeden etwas. Auf den ersten Blick
vielleicht erstaunlich, daß auf dem hochspezialisierten bundes-
deutschen Pressemarkt eine etwas breiter gefächerte Thematik
durchaus Anklang findet. Für Verlag und Redaktion ist das natürlich
nicht mehr so neu, und wir wollen dieses "etwas anders sein", das
sich auch in anderen Einzelheiten unseres Erscheinungsbildes zeigt,
als Markenzeichen erhalten.
Was können Sie, liebe Leser, in Zukunft von Ihrem FUNKAMATEUR
erwarten? Erstens, bei Ost-Produkten keinesfalls die Regel, er bleibt.
Und zweitens, er bleibt, was er zu DDR-Zeiten mangels Papier für
Spezialzeitschriften geworden ist: Ein themenübergreifendes Magazin
für Funk, Elektronik und Computer, gemacht für Leser, die gern hinter
den Horizont ihres eigenen Hobbys schauen wollen, die angenehme
Mischung aus sachlichen Informationen und nützlichen Anregungen,
selbst aktiv zu werden. Eine Zeitschrift für Praktiker.
Kein Gebiet soll dabei zu kurz kommen, was leichter gesagt ist
als getan. Befürchtungen, daß Themen ausgegrenzt werden könnten,
sind unbegründet, aber der technischen Entwicklung folgen wir
selbstverständlich. Ein Mehr an Seiten für den Amateurfunk, wie Sie
es bei den letzten Ausgaben bemerken konnten, wird auch mehr
Seiten für die Elektronik und die Computer nach sich ziehen. Achtzig
Seiten Gesamtumfang sind schon angepeilt, stellen aber keinesfalls
die Obergrenze dar.
Und bestimmt wird auch die Verbreitung über den gesamten deutsch-
sprachigen Raum den einen oder anderen neuen Autor dazu
animieren, die Vielfalt des FUNKAMATEUR zu bereichern.
Viel Spaß bei der Lektüre
wünscht Ihr
Knut Theurich
Nichts wird so heiß gegessen…
Zwei Jahre sind inzwischen vergangen, seit die Internationale Funkausstellung
Berlin 1991 ihre Pforten schloß. Damals kamen 512 752 (zahlende) Besucher
an den Ort der weltweit größten Messe für Unterhaltungs- und Kommuni-
kationselektronik. Immerhin sind viele durch die Ankündigung von neuen
Fernsehsystemen angelockt worden: HDTV, PALplus und D2-MAC schienen
die geeigneten Verfahren zur Verbesserung der inzwischen etliche Jahre
kaum verbessserten Übertragungsqualität bei TV zu sein. Japaner und
Europäer rangen scheinbar um den Markt, jedem s e i n (besseres) System!
Wer sich vor zwei Jahren deutlich vom Qualitätsgewinn des HDTV über-
zeugen wollte, hatte es nicht leicht. Mehrfach sah man Bildschirme mit auf
16: 9 gequältem Normal-TV und ziemlich versteckt eine Demonstration von
PALplus, aber einen direkten Vergleich zwischen HDTV, PALplus, PAL und
vielleicht noch D2-MAC auf nebeneinanderstehenden Bildschirmen gleicher
Fläche konnte ich nicht finden. Die wirklich überzeugende Demonstration
einer entscheidend besseren Bildqualität duch HDTV und seiner Halbbrüder
kamtrotz des Spektakels der Konzernriesen um ihre neuen Technik wohl
nicht so recht zum Messebesucher hinüber. Ein zweiter Dämpfer waren
natürlich die "ansehnlichen" Preise.
Noch Monate nach der IFA hallte es von der europäischen Industrie wider:
Die Zukunft des Fernsehens heißt HDTV, obwohl zwischen der Politik,
Industrie, den Satellitenbetreibern und Programmanbietern Klippen standen.
Wie sollte denn nun die Norm für Europa aussehen? Kommt es zu einer
einheitlichen Richtlinie? Diese Fragen beschäftigten Anfang '92 alle
Beteiligten, darunter auch das Europäische Parlament. Schließlich sah
man ein, daß es nur Schritt für Schritt gehen konnte.
Gedämpfte Stimmung bei der Industrie, Frust bei den Politikern, Gleich-
gültigkeit beim Volke − es mußte eine Ziege zu Melken gefunden werden, und
die hieß Albertville. Mit einem riesigen Aufgebot an Technik (500 Mio Mark)
übertrugen die TV-Anstalten die Olympischen Winterspiele erstmalig in
HDTV-Qualität − aber wohin denn eigentlich? Viel Lärm um nichts, denn bis
auf wenige Ausnahmen flimmerten in den europäischen Wohnzimmern die
Bilder weiter mit 625 Zeilen. Das war auch bei den Sommerspielen aus
Barcelona der Fall. Zwar hatte man in den Großstädten vereinzelt "HDTV-
Stübchen" eingerichtet, wo jeder Sportbegeisterte die positiven Seiten des
neuen Systems besichtigen konnte − aber das war's auch schon. Hunderte
von Millionen Mark für Equipment, die keiner so richtig nutzen konnte und
wohl bis heute wenig nutzt.
Da tut sich die Frage auf, ob die Masse denn HDTV in der heute vorgestellten
Form überhaupt akzeptiert oder ob es nur eine Partykirsche im Alltagsfernseh-
cocktail ist.
Auch wenn im April dieses Jahres JVC den ersten HDTV-Videorecorder für
den Heimgebrauch vorstellte, ist das noch längst kein Zeichen dafür, daß
dieses System von den Konsumenten angenommen wird. Immerhin soll
der Preis unter 10 000 Mark(!) liegen, und da kommt gewiß keine Kauffreude
auf − es sei denn, der Prestigegewinn steht bei dem einen oder anderen
besonders hoch im Kurs. Und noch gibt es praktisch kein Programmangebot
Lassen wir uns aber überraschen. Wenn die diesjährige Internationale
Funkausstellung in ein paar Wochen beendet ist, sind wir sicher klüger, oder?
Ihr
Jörg Wernicke
Gong zur letzten Runde?
Am 18. Juni fand in Banner Ministerium für Post und Telekommunikation das
abschließende Hearing zum Entwurf einer Verordnung zum Gesetz über den
Amateurfunk (AFuV) statt, zu dem sich von den 34 angeschriebenen Verbän-
den bereits termingerecht vorher 12 schriftlich geäußert hatten. Diesmal
blieb genug Zeit, ihn zu verbreiten − so im FA 5/93 und 6/93 − und so jedem
interessierten Funkamateur Gelenheit, seine Argumente zu formulieren. ln
unseren beiden vorigen Ausgaben konnten Sie folgerichtig schon einige
Kommentierungen zu diesem Entwurf lesen.
Denen wäre im Grunde kaum Wesentliches hinzuzufügen, denn beim Hearing
lag der Tenor bei eben diesen Punkten: zu schwierige und wenige Lizenz-
klassen kontra mißbrauchsträchtiger Ausbildungsfunkbetrieb; zu hohe, nicht
transparente und undifferenzierte Gebühren im Zusammenhang mit Nicht-
beachtung des gesellschaftspolitischen Faktors Amateurfunk inklusive seines
Bildungsauftrags; präventives Zurückweichen des Entwurfs vor der aktuellen
Elektrosmog-Hysterie in Form einer unakzeptablen generellen Leistungs-
beschränkung auf den UKW-Bändern; unausgewogene EMVG-Festlegungen,
dadurch Experimentalcharakter des Amateurfunks gefährdet; statt Kennungen
besser Sonder-, Zweitrufzeichen oder eine Anbindung an vorhandene
Rufzeichen…
Die Anhörung machte ihrem Namen übrigens wirklich Ehre. Die Vertreter der
anwesenden Verbände trugen ihre Statements zu dem Entwurf als Ganzes
und zu den einzelnen Paragraphen im Einzelnen vor. Das war's: keine Diskus-
sion, keine Begründungen für bestimmte Regelungen des Entwurfs. Es gibt
nur den bekannten Begfeittext dazu. Abschließende Bemerkung seitens des
BMPT: "Wir prüfen Ihre Vorschläge und werden sehen, was wir daraus
machen können". Dem Vernehmen nach zogen sich die Herren auch gleich
noch am Freitagnachmittag zur Beratung zurück.
Über Nachbesserungen lassen sich im Moment nur Spekulationen anstellen.
ln Friedrichshafen wird folglich nur die DARG-Sicht erläutert. Hoffen wir, daß
das BMPT wirklich "etwas (mehr) daraus macht"; vielleicht sogar noch einen
weiteren Entwurf vorlegt? Das wäre sicher besser, als womöglich vollendete
Tatsachen zu schaffen − die bisherige Aufgeschlossenheit des BMPT läßt da
durchaus hoffen.
Auf der anderen Seite reizt der Deutsche Amateur Radio Club, der die
meisten deutschen Funkamateure vertritt, seine Möglichkeiten aus und ist lt.
DL-Rundspruch 23/93 "auf alle weiteren denkbaren Eventualitäten vorberei-
tet, auch wenn sie über alles bisher Dagewesene wesentlich hinausgingen".
Was ist zu erwarten? Es liegen konstruktive Änderungsvorschläge von den
Verbänden vor, vom DARG sogar eine komplette, auch juristisch abgeklärte
Neufassung. Vernünftige Lösungen hängen u. a. sehr vom Zwang zur Wirt-
schaftlichkeit ab. Ob der gesellschaftliche Nutzen des Amateurfunks zur Auf-
gabe der angestrebten Kostendeckung führt, scheint in Zeiten der Rezession
fragwürdig. Auf die Gefahr hin, unpopulär zu sein, bleibt weiter die Frage,
warum sich amateurfunkinterne Probleme wie Bandpläne und Koordinierung
nicht doch von den Amateuren selbst lösen lassen sollten. Mehr Verantwor-
tungsbewußtsein und Einsicht könnten Kosten senken und Bearbeitungs-
zeiten reduzieren. Womöglich entschließt sich die Behörde doch noch, die
Prüfungen nach US-Vorbild ganz in ehrenamtliche Hände zu geben, strenge
Auswahl der Prüfer vorausgesetzt. Beim Ausbildungsfunkbetrieb müßten
dem Genehmigungsinhaber Pflichten auferlegt werden, die Mißbrauch
ausschließen usw. Eines dürfte feststehen: Jeder Funkamateur wird sich
solides EMV-Wissen aneignen müssen, um jederzeit in der Norm zu bleiben;
eine der Voraussetzungen, um EMV-bedingte Restriktionen überhaupt zu
kippen.
Wieder ist vieles offen. Wir sind auf den nächsten Schritt des BMPT gespannt.
Beste 73!
Bern Petermann, DL7UUU
Marktchancen?
Vielleicht erinnern Sie sich: In der April-Ausgabe zitierten wir den VDE-
Vorsitzenden, der Forderungen zur Erhaltung des Technologiestandortes
Deutschland aufstellte. Jetzt sah sich vor dem Hintergrund des auslaufen-
den Konjunkturzyklus auch der Zentralverband der Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e. V (ZVEI) zu ähnlicher Aussage genötigt: Es bestehe
ein offensichtliches Mißverhältnis zwischen der volkswirtschaftlichen
Bedeutung moderner Technologien − wie der Informationstechnik und
der Mikroelektronik- und den staatlichen Anstrengungen. "Mit Milliarden-
aufwand werden die Branchen der Vergangenheit erhalten, während
künftige Märkte ausländischen Anbietern überlassen werden", kritisierte
der ZVEI- Vorsitzende.
Dr. E. v. Koerber. Wichtiger als die Umschichtung der öffentlichen Mittel,
z. B. in der Forschungsförderung, sei aber die Bereitschaft von Gesell-
schaft und Politik, den technischen Fortschritt nicht nur zu akzeptieren,
sondern aktiv zu unterstützen.
Seit Jahresmitte 1992 sind Auftragseingänge, Produktion, Umsatz,
Außenhandel und Beschäftigung in der westdeutschen Elektroindustrie
rückläufig - das war die globale Aussage auf der Jahrespressekonferenz
des ZVEI. Den Produktionsrückgang 1992 machte der Verband bei real
etwa 4 % fest; für 1993 rechnet er mit weiteren 1 bis 2 %.
Auch unser CeBIT-Bericht (s. S. 262) kommt an den Marktturbulenzen
nicht vorbei.
Natürlich ist der Abschwung differenziert innerhalb der Branche: Die
größten Einbrüche mit mehr als 20 % gab es in der Unterhaltungselek-
tronik − vielleicht ist der lnnovationsschub, wie wir ihn am Beispiel des
RDS (s. S. 251) darstellen, auch mit darin begründet − und in der Infor-
mationstechnik. Auch die Bauelementeproduktion verzeichnete mit einem
Minus von 9 % noch deutliche Verluste. Hier gestatte ich mir, Sie auf die
in dieser Ausgabe beginnende Serie zum heutigen Stand der Elektronik-
industrie hinzuweisen, die die untergegangene DDR in das neue
Deutschland einzubringen bemüht ist (s. S. 259).
ln der Fahrzeugelektrik (1992: +2 %) zeichnet sich nach dem lang anhal-
tenden Hoch seit dem letzten Quartal 1992 ein massiver Einbruch ab. Das
ist um so dramatischer, weil in Deutschland ein hoher Anteil der Automobil-
elektronik (Richtwert 15 %) an der Gesamtproduktion der Branche
zu verzeichnen ist.
Zuwächse dagegen gab es u. a. in der Energieverteiltechnik und der
Beleuchtungstechnik.
ln den neuen Bundesländern stagnierte die Produktion auf dem niedrigen
Niveau des Vorjahres; allerdings zeichnete sich vor dem Hintergrund
hoher Investitionen der westdeutschen Elektroindustrie in den letzten
Monaten des vergangenen Jahres eine leichte Erholung ab.
Der ZVEI-Präsident sprach sich gegen eine bedingungslose und unbefristete
Existenzsicherung für einzelne Unternehmen aus. Dadurch würden
nur unwirtschaftliche Strukturen zementiert, die notwendige Umlenkung
der Finanzmittel vom Konsum in Investitionen behindert und der wirt-
schaftliche Aufbau gehemmt. Allerdings brauchten auch Treuhandunter-
nehmen die Möglichkeit, mit sinnvollen Zukunftsinvestitionen und über-
sehaubaren Planungsperspektiven ihre Chancen am Markt zu verbessern
… In der westdeutschen Elektroindustrie habe sich der Bezug von
Waren und Dienstleistungen aus den neuen Bundesländern im letzten
Jahr von 1, 7 auf 3,5 Milliarden mehr als verdoppelt. Im laufenden Jahr sei
ein weiterer Zuwachs auf über vier Milliarden geplant. Ob damit aber
schon die zwischen Eibe und Oder beheimateten Elektronikunternehmen
über den Berg kommen, bleibt offen. Die Konjunkturflaute herrscht − wie
immer − zur falschen Zeit.
H. Radke
DXen − alter Reiz im neuen Gewand
Der Reiz der Ferne hat sich heute beträchtlich relativiert. Das Fernsehen bringt
Berichte aus aller Welt in jede Wohnstube, gut ausgebaute Telekommunika-
tionsnetze mit weltweiten Verbindungsmöglichkeiten stehen jedermann offen,
und selbst Fernreisen sind für die meisten Deutschen längst nicht mehr
undenkbar.
Gerade aufeben diese Ferne, das DX, richtet sich von den Ursprüngen her das
Interesse der Funkamateure. Aber die Welt ist rund und die Sphäre der Funk-
amateure damit begrenzt. Der Fortschritt der Technik und der Preisverfall
brachten es mit sich, daß Funkverbindungen rund um den Erdball vielen Funk-
amateuren verhältnismäßig leicht möglich sind.
Demnach ist DX heutzutage wirklich nichts so Außergewöhnliches mehr,
denn die Entfernungen haben sich ideell mehr und mehr verkürzt. Trotzdem
gibt es überall auf der Welt eine Menge begeisterter OXer. Was treibt sie an?
DX bleibt eine Herausforderung, denn so einfach wie mitdem Telefon geht es
halt doch nicht; das Übertragungsmedium Ionosphäre ist überaus launisch
und unbeständig. Nicht alle Punkte des Globus sind gleich gut und jederzeit,
Gebiete wie der Pazifik schwerer als das weiter entfernte Neuseeland erreichbar.
Und ob niedrigerer Bevölkerungsdichte, politischer Restriktionen oder
schwacher wirtschaftlicher Entwicklung ist die Zahl der Funkamateure über
weite Gebiete unserer Erde gering. Und die Sammelleidenschaft gebietet,
trotzdem überall einen Partner gefunden zu haben.
Dazu kommt sportlicher Ehrgeiz. So kann man es nennen, wenn er hier auchmit
Ausnahme Antennenbau, Fieldday oder gar einer DXpedition- mit Konditionierung
des Körpers zumeist wenig zu tun hat. Gemeint sind eher einschlägige
Fertigkeiten, Taktik, ordentliche Sport- (sprich Funk-) Geräte, Reaktionsfähigkeit,
Schnelligkeit, auch Ausdauer sowie − leider oft genug − je nach Charakter
baseballmäßige Ruppigkeit.
Jeder stellt sich da seine Ziele entsprechend verfügbarer Freizeit, besonderen
Interessen oder simpel den technischen Möglichkeiten, die vom Geldbeutel
und diversen Beschränkungen durch Vermieter und Bauordnungen beeinträchtigt
werden.
Meßlatten gibt es genug. Eine international allgemein akzeptierte ist die
ARRL- (American Radio Relais League) Länderliste, die nach einem oft schwer
nachvollziehbaren Modus zur Zeit 326 "Länder" definiert, und sei es manchmal
nur eine unbewohnte Sandbank mitten in der Südsee.
Alle dem zum Trotz mit möglichst vielen solchen Ländern auf allen Amateurfunk-
bändern und wenn's geht noch in diversen Betriebsarten in Funkkontakt
zu kommen − das macht die OXer glücklich. Dazu heißt es, sorgfältig über die
Bänder zu kurbeln, zu wissen, wann die ionosphärischen Bedingungen überhaupt
eine Verbindung zu einem bestimmten Land zulassen, ob irgendwann
einmal jemand die letzte fehlende Sandbank zum Zwecke das Funkens ansteuert
und- prickelnde Situation − diese Station schließlich gentlemanlike im
"Pile-Up" der massenhaft rufenden Herde Gleichgesinnter zu erreichen. Damit
nicht genug, zum guten Ende heißt es noch, an die beweiskräftige Trophäe
dieses Erfolgs, die begehrte QSL-Karte der seltenen Station heranzukommen,
was durchaus nicht immer über die internationalen OSL-Büros der Amateurfunk-
verbände funktioniert. Da muß man dann noch warten können.
Lohn der ganzen Mühe? Ein Platz mehr oder weniger weit oben in der Liste
Länderstand (s. Seite 236) und der Stolz auf über lange Jahre erkämpfte Erfolge.
Aber zunehmend zieht es auch den einen oder anderen Funkamateur zu
einer DXpedition hinaus an einen Platz, der unter Funkamateuren als "selten"
gilt, von dem aus man auch einmal der umworbene, gefragte Funkpartner ist,
nach dem sich alle reißen (s. Seite 788).
Faszination DX. Ich bin sicher, sie ist bis heute ungebrochen. Wir werden ihr
mit Expeditionsberichten, dem wiedererstandenen DX-OTC und anderen Beiträgen
Raum im FUNKAMATEUR verschaffen. Versuchen Sie doch auch einmalihr
Glück im "Pile-Up"-Getümmel, und wenn Sie noch kein Funkamateur
sind: Vielleicht könnte Sie gerade diese Spielart des Amateurfunks reizen!
Beste 73 und gut DX!
B. Petermann, DL7UUU
Mit neuem Schwung
ln Ausgabe 2193 haben Sie es gelesen: Der FUNKAMATEUR hat den
Verlag gewechselt- ein recht großer Einschnitt für uns Macher, zugleich
einer, von dem wir uns viel versprechen. Die Zeichen sind günstig- die
Theuberger Verlag GmbH, ein noch junges Unternehmen in Berlin-Mitte,
ist im Begriff, sich zunehmend auf Amateurfunkbedürfnisse zu speziali-
sieren, und da ist ein FUNKAMATEUR richtig.
Naturgemäß ist und bleibt es Anliegen der Redaktion, mit der Zeitschrift
Funkamateure anzusprechen- viele neue Leser sind solche − sowie Nicht-
funkamateuren dieses fordernde und interessante Hobby so herüber-
zubringen, daß sie es als Möglichkeit für sich in Betracht ziehen. In der
vorliegenden Ausgabe werden so gesehen der Bericht über die Expedition
zu den St. Peter & St. Paul Rocks und der über neue Amateurfunksatelliten
Ihr Interesse finden.
Weil Funkamateure auch auf anderen Funk- und elektronischen Gebieten
Interessen hatten, wurde der FUNKAMATEUR in seinen 42 Jahren thema-
tisch immer breiter, war sogar hin und wieder Wegbereiter. So entstand
seine Vielfalt, und bei der bleiben wir, bieten gleichermaßen − ab Ausgabe
4193 − für die BC-DXer sowie die Funkamateure ein wenig mehr.
Ansonsten gilt, was immer galt: Was Sie im FUNKAMATEUR lesen können,
bestimmen Sie zum großen Teil selbst. Wir verstehen uns nach wie
vor als Mittler zwischen den Lesern, und selbst wenn die Gründe für die
Elektronikselbstbaupraxis unterdessen andere geworden sind (Was
haben wir früher alles zum zweiten Mal erfinden müssen!?) brauchen wir
für diese Mittlerrolle auch die Beschreibung Ihres Bauprojektes, Ihrer
Computeranwendungsidee … Wobei es der Interessenwandel in der
Selbstbaupraxis vielleicht mit sich bringt, daß zu bauen "nur" noch lohnt,
was an Zubehör, an Low-cost-Varianten, an Modifikationen, an speziellen
Einsatzvarianten fehlt. Es geht also um Ihre große kleine Idee mit Pfiff! Ein
anderes schier unerschöpfliches Gebiet des Schreibens im FUNKAMATEUR
ist das der Übersichten, z. B., welche Einsatzmöglichkeiten Bauelemente
haben − wir erwarten Ihre Beiträge.
Zu den guten Zeichen für einen neuen Schwung zählt auch, daß wir durch
Ihre hohe Beteiligung am Weihnachtsrätsel- vielen Dank auch an alle, die
die zusätzlichen Fragen beantworteten- genauere Kenntnis haben, was
Sie interessiert, was Sie gern lesen, womit wir Ihren Hobby- oder Interes-
sen-Nerv treffen. Und wir haben erfahren, daß unser Konzept, Wissenslücken
schließen zu helfen, bis hin zu lebenspraktischen Tips, richtig ist.
Ich meine, es gibt keinen Grund, hiermit aufzuhören. Themen dieser Art
gibt es genug, die technische Entwicklung bringt ständig neue. Und wer
heute etwa ein Produkt beurteilen will, vielleicht vor einer Kaufentscheidung,
ist schon gut beraten, sich mit speziellem Wissen auszurüsten − aus
dem FUNKAMATEUR.
Der im vorigen Heft von unserem Verleger ctngekündigte allmähliche
Übergang zu moderneren Redaktionstechnologien wird uns ermöglichen,
Sie über so manches Ereignis schneller zu informieren. Wobei einer
Monatszeitschrift hier Grenzen gesetzt sind, denn Redaktionsschlußund
sei der noch so nah am Termin des Druckens − ist halt nur einmal im
Monat … Ein Printmedium wird an Aktualität niemals den elektronischen
das Wasser reichen können.
Aber Sie, liebe Leser, kaufen eine Zeitschrift wie den FUNKAMATEUR
wegen deren Vorzug: Man kann sie getrost nach Hause tragen, die ent-
haltenen Informationen und Anregungen ständig ohne technische Hilfsmittel
abrufen.
Ihre Weihnachtsrätselzuschriften haben auch gezeigt, daß die weitaus
meisten unserer Abonnenten uns seit vielen Jahren die Treue halten.
Gleichermaßen ist damit aber auch gesagt, daß die Zeitschrift in den alten
Bundesländern und im Ausland immer noch zu wenig bekannt ist − hier
sieht unser neuer Verleger sein Feld. Ich muß aber auch sagen, daß die
Treuhandverwaltung des FUNKAMATEUR mit den Auflagen verbunden
war, praktisch keine Investitionen vorzunehmen, fast kein Geld in Wer-
bung zu stecken, und so stockte einiges- es ist Zeit für einen neuen
Schwung.
H. Radke, Chefredakteur
FUNKAMATEUR nicht mehr unter Treuhandverwaltung
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Anfang des Jahres hat der in Berlin ansässige
Theuberger Verlag den FUNKAMATEUR
vom Brandenburgischen Verlagshaus, das unter
Treuhandverwaltung steht, übernommen. Damit
ist die Zeitschrift in ihrem 42. Erscheinungsjahr
endgültig in die Marktwirtschaft entlassen und
gehört − entgegen manch anderslautender Pro-
gnose − zu den wenigen Zeitschriften, die das
große Zeitungssterben im Osten Deutschlands
überlebt haben.
Der Theuberger Verlag, der Ihnen möglicherweise
bereits als Verlag für Amateurfunkliteratur be-
kannt ist, sieht seine Aufgabe nicht nur darin,
die Zeitschrift mit der bewährten thematischen Vielfalt weiterzuführen, son-
dern beabsichtigt auch, sie noch lesenswerter zu machen.
Dabei wird sich der FUNKAMATEUR auch in Zukunft an den breitgefächerten
Interessen seiner Leser orientieren. Eines der vorrangigen Ziele besteht darin,
Sie vielseitig und aktuell über die rasant voranschreitende technische Entwick-
lung zu informieren. Dazu wird noch in diesem Jahr der Zeitraum zwischen Re-
daktionsschluß und Auslieferung erheblich verkürzt.
Für Anregungen zur Neugestaltung und zum künftigen Profil der Zeit-
schrift ist die Redaktion dankbar.
Die neue Postanschrift
Redaktion FUNKAMATEUR, Postfach 73, 0-1020 Berlin
Das Redaktionsbüro befindet sich ab 1. Februar 1993 im
Bürohaus Oberwasserstraße 12, 0-1080 Berlin-Mitte
Telefon 030/2082261, Fax 030/2071258
Für die bisher übermittelten guten Wünsche
bedankt sich herzlich
Ihr
Knut Theurich
DGOZB, ex Y24HO, ex DM3WHL
Herausgeber
Identitätsverlust
Sie alle- ob Funkamateur, CB-Skipper oder Garnichtfunker − kennen das
mindestens aus Ihrem privaten Kreis: Eine Heirat hat in aller Regel einen
Namenswechsel − traditionell meist der Braut- zur Folge. Das ist mit
aufwendigen Nachwirkungen verbunden: Alle Freunde, Kollegen und
Bekannten müssen informiert, Ausweise, Paß, Führerschein … geändert
werden. Die Ämter sind auf solche Fälle dergestalt vorbereitet, daß For-
mulare spezielle Rubriken für einen Namenswechsel haben. Trotz aller so
eingeschliffenen Bürokratie: Die Sache macht Probleme. Und außerdem
dauert es selbst in diesem privaten, ziemlich genau begrenzbaren Umfeld
geraume Zeit, bis sich der neue Name' rumgesprochen hat, bis jeder mit
dieserneuen Identität die Person verbindet, die er ja schon lange kennt.
Und dann gibt es ja gar so manche(n), der dieses freiwillige "Bäumchen
wechsle dich"-Spiel gleich mehrmals im Leben drauf hat, trotz allem.
Für Funkamateure ist ein Wechsel der Identität ungleich folgen reicher.
Die OMs, YLs, XYLs und SWLs kennen sich zumeist "nur" aus den Funk-
kontakten − für sie prägen sich Rufzeichen oder die SWL-Nummer noch
eher ein als der im Amateurfunkverkehr gebräuchliche Vorname. Wenn
sich dieses namensersetzende Rufzeichen ändert, ist die Identität futsch,
zumindest außerhalb des Bereichs der Bodenwelle.
Und nun sogar eine amateurfunkmäßige "Massenhochzeit" der neuen
mit den alten Bundesländern. Silvester 1992 ist Ultimo dafür. Am Neu-
jahrstag 1993 haben auch die letzten der annähernd etwa 5000 ehemali-
gen Y2-Funkamateure ihr neues DL-, DH- oder DG-Rufzeichen und damit
zeitweise ihre Identität verloren, wobei es doch ganz erfreulich ist, daß
einige OMs mittels der Option, sich aus dem jeweiligen Rufzeichenkontin-
gent ein noch verfügbares aussuchen zu können, Bestandteile ihres alten
Suffixes in das neue Rufzeichen herüberretten konnten, die Anfangsbuch-
staben ihres bürgerlichen Namens einbringen oder ganz einfach ein gut
"klingendes" zu wählen vermochten. Aber es ist eben nicht nur der ein-
zelne betroffen von dem zeitweisen ldentitätsverlust, sondern, viel
schlimmer, kaum einer kennt noch den anderen, das gesamte Funkama-
teurumfeld weiß nicht mehr, wer wer ist. Ein gründlicher Schnitt, aber der
ist in den neuen Bundesländern ja auch auffast allen anderen Lebensge-
bieten erfolgt.
Für die neuen DLs heißt das, sich ihr Image in der weiten Amateurfunkwelt
neu zu erobern. Distante Stationen stellen nämlich selbst dann kaum eine
Beziehung zum alten Rufzeichen her, wenn es auf der nun ja auch neu zu
druckenden OSL-Karte als "ex-… " vermerkt steht.
Das Pikante dieses massenhaften Rufzeichenwechsels liegt in der Ge-
schichte. Im Zuge der Anerkennungspolitik der ehemaligen DDR war es
den Politikern im Jahre 1979 gelungen, bei der ITU für die nunmehr
" hoffähige" DDR einen eigenen Rufzeichenblock durchzusetzen, um von
der bis dato unumgänglichen gemeinsamen Nutzung des dem Nach-
kriegsdeutschfand zugewiesenen Blocks DAA bis DTZ wegzukommen
(das betraf übrigens sämtliche Funkstellen der DDR mit ITU-gemäßen
Rufzeichen, u. a. alle Luft- und Wasserfahrzeuge). So wurden ab dem
1. 1. 1980 aus den ehemaligen DM-Rufzeichen mit einem für Eingeweihte
noch durchschaubaren System solche aus dem Block Y2 … bis Y9 … Die
allgemeine Verdrossenheit milderte sich ein wenig dadurch, daß dieser
neue Rufzeichenblock weltweit neu und demzufolge auf den Bändern
anfangs sehr gefragt war. Es brauchte so an die fünf Jahre, bis man nicht
mehr die Rufzeichen "zurückrechnete", um jemand zu identifizieren und
noch ein paar mehr, bis einem die neuen wirklich vertraut waren. Diese
Umstellung war naturgemäß für viele Funkamateure mit substantiellen
Verlusten verbunden.
Nach, historisch gesehen, "nur" 13 Jahren sind diejenigen OMs, YLs,
XYLs, SWLs, die damals schon aktiv waren, ein zweites Mal von einer
solchen Umstellung betroffen- also im Vergleich eine massenhafte
unfreiwillige Zweithochzeit auf internationalem Parkett. Schade, daß
man sich beim BAPT nicht entschließen konnte, den Oldtimern aus dem
Osten Deutschlands auf Wunsch ihre alten Mädchennamen, sprich DM-
Rufzeichen, zu reaktivieren.
Daß wir uns trotzdem alle bald wiedererkennen, wünscht uns
B. Petermann, DL7UUU,ex Y22TO, ex DM2BTO
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Angst vor der eigenen Courage?
Die Nummer Zwei der deutschen Amateurfunkmessen, die Interradio in
Hannover, fiel in eine Zeit vergleichsweise erheblicher Turbulenzen im
Amateurfunk in Deutschland. Am 24. Oktober war der Vorstand des bei
weitem größten deutschen Amateurfunkverbandes DARC zurückgetreten,
u. a., weil bei der Bewältigung der amateurfunkspezifischen Belange der
Elektromagnetischen Umweltverträglichkeit (EMVU) und dem Entwurf einer
neuen Durchführungsanordnung zum Amateurfunkgesetz Unzulänglichkeiten
zutage getreten waren. Beide Problemkreise haben auf die Entwicklung
des Amateurfunks hierzulande in den nächsten Jahren ganz sicher
großen Einfluß. Dagegen sind die Störungen im Zusammenhang mit dem
Kabelkanal S 6 anscheinend schon ein wenig in den Hintergrund getreten.
Im Vortragsprogramm der Interradio reflektierte sich auch das Thema
EMVU. Die Gesprächsrunden mit (Interims-) Vorstand und Geschäftsführer
des DARC sowie mit Vertretern des Bundesministeriums für Post und
Telekommunikation (BMPT) liefen unverständlicherweise zur gleichen
Zeit.
Ich hatte das außerordentliche Vergnügen, in der BMPT-Runde dabeizu-
sein. Regierungsdirektor Ralf Peter Jankowiak informierte freimütig über
den aktuellen Stand bei gesetzgeberischen, den Amateurfunk betreffenden
Vorstellungen. Was sich schon andeutete, hat nun bereits rechtfeste Kontu-
ren angenommen: Das BMPT ist (nur) für die Durchführung des Amateur-
funkgesetzes verantwortlich. Zur Koordinierung von Amateurfunk-Baken,
-Digipeatern, -Mai/boxen, -Relaisfunkstellen usw. findet sich das entspre-
chende Bundesamt BAPT nur dann bereit, wenn sie in mit anderen Funk-
diensten geteilten Frequenzbändern arbeiten sollen. Gleiches gilt für Band-
pläne. In Bändern, auf denen die Funkamateure unter sich sind, müssen sie
schon selbst für Ordnung sorgen. Alles auch eine finanzielle Frage, denn
nach der Poststrukturreform muß das BAPT kostendeckend arbeiten. Bei
Amateurfunkgenehmigungen gilt das Individualrecht. Jeder Funkamateur
wird zusätzliche Kennungen für obige Sonderanwendungen erhalten können,
eine Gruppenbindung ist ausgeschlossen.
In der Diskussion zeigte sich sehr deutlich das Unbehagen der Funkama-
teure, womöglich niemanden mehr zu haben, der in einer Reihe sehr wichti-
ger Dinge anweist, kontrolliert und gegebenenfalls gar auch bestraft. Dieses
Unbehagen dokumentiert eine Einstellung, die man gemeinhin nur den Be-
wohnern der neuen Bundesländer nachsagt. Sicher ist es nicht einfach, mit
den Interessen anderer klarzukommen, noch schwerer, mit schwarzen Schafen
und dem einen oder anderen krassen Außenseiter. Es gibt aber Funkama-
teure, die steif und fest behaupten, daß so etwas beispielsweise in den
USA funktioniert, ohne daß Chaos herrscht. Also doch noch jede Menge
Obrigkeitsgläubigkeit im neuen Gesamtdeutschland? Oder zuwenig Toleranz
und Zweifel, ob nicht Freiheit zur Ellenbogenfreiheit verkommt?
Es scheint, daß die Nagelprobe bevorsteht, wenn- auch in folge der umfang-
reichen Einarbeitung der EMVI EMVU in die D V- nun erst die Jahresmitte
1993 ihr Inkrafttreten markiert. Es wird nicht ohne konstruktive Gespräche
und ständiges Engagement aller Interessengruppen gehen, die auch ihre Öf-
fentlichkeit haben müssen, um so in ihren Entscheidungen Akzeptanz bei
möglichst allen Funkamateuren zu finden. Nur dann werden sie bereit sein,
sich danach zu richten und die Regelungen zu ihrer eigenen Sache zu machen.
Nur offensiv, sachkundig, geschickt, schnell und dabei kompromißbereit
operierende Vereinigungen, vielleicht auch ein Dach verband, können einen
akzeptablen Interessenausgleich, sowohl untereinander als auch gegenüber
dem BMPT sichern. Insofern kommt der für den 13. Dezember geplanten
Neuwahl des DARC-Vorstandes ebenso wie dem Handeln des aus den
DARC-Distrikts.vorsitzenden bestehenden Amateurrats besondere Bedeu-
tung zu.
Beste 73!
B. Petermann, Y22TO
Rufmord
Wußten Sie, daß Rasierapparate, Toaster und Kaffeemaschinen krank ma-
chen? Nein, ich meine damil nicht die Ausfälle dieser Geräte, über die man
sich grün und blau ärgern könnte, sondern die elektromagnetischen Felder,
die von ihnen ausgehen − auf Neudeutsch: der Elektrosmog. Kaum eine
Fernsehanstalt, die nicht schon darüber berichtete, kaum ein Journalist,
der sich nicht wichtig tun wollte.
In der ARD-Frühstückssendung vom 23. 9. d. J. war das Thema wieder
dran. Hier erfuhr der Zuschauer Schauriges über die Gefährlichkeit elektro-
magnetischer Felder anhand gar grausiger Beispiele, s. o. Aber was der gute
Experte dort als letzten Satz von sich gab, ließ mir die Barthaare zu Berge ste-
hen: "Schaden richten diese elektrischen Felder mit Sicherheit an, obwohl sie
im allgemeinen ziemlich schwach sind. Besonders gefährdet sind allerdings
Menschen, die als Nachbarn Funkamateure haben. "Nun, man denke sich
seinen Teil angesichts dieses Rufmordes. Könnte ja sein, daß dieser arme
Mensch eine Schwiegermutter hat, die unser schönes Hobby betreibt. Oder
ist er etwa gerade durch die fach liche Prüfung gefallen? Ich hatte schon Vi-
sionen, wie Bürgerinitiative gegen Funkamateure; herunter mit den Funk-
antennen, rtieder mit dem Amateurfunk!
Fast hundert Jahre lang funken die Menschen schon, und nachweislich ist
noch kein OM daran gestorben, außer er berührte den einen oder anderen
Teil seiner Furikanlage. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, daß die uns
normalerweise umgebenden elektrischen Felder schädlicher sind als Autoab-
gase, passives Rauchen, Chemiemüll, der ständig ins Abwasser geleilet
wird, uns ständig begleitender Lärm. Oder man lese einmal die Inhaltsstoffe
der Nahrungsmittel nach. Vielleicht möchte irgendwer von heikleren Themen
ablenken. Kommt ja auch gut an, den Leuten mal etwas Neues aufzutischen,
warum nicht auch ein wenig Elektrosmog. Findet sich in jedem Haushalt,
geht von jedem Toaster, Rasierapparat und Radioweck er aus und kann
− man liest und sieht es ja täglich- zu Leukämie führen. Sicher beschäftigen
uns in letzter Zeit die Probleme der Elektromagnetischen Umweltverträg-
lichkeit. Daß Radaranlagen mit ihren hohen Frequenzen und Leistungen
th ermisch bedingte Schäden hervorrufen können, ist bekannt. Aber haben
Sie den Eindruck, daß die vielen Menschen, die in unmittelbarer Nähe von
Fernsehtürmen und Rundfunksendern mir ihren vielen Kilowatt Sendeleistun-
gen wohnen, auffällige Krankheitssymptome zeigen? Noch gibt es jedenfalls
meines Wissens keine medizinische Studie, die das belegt. Trotzdem
soll nicht bagatellisiert werden.
So ist der Minister für Post und Telekommunikation durch den § 2a des Fern-
meldeanlagengesetzes zum Schutze von Personen in elektromagnetischen
Feldern verpflichtet. Deshalb verlangt er vom Errichterund Belreiber eines
Senders einen Nachweis, daß von der neu zu errichtenden Funkanlage keine
Schäden oder Gefahren für Personen ausgehen.
Durchführende Instanz für diese Kontrollen ist das BAPT, das unter Berück-
sichtigung der am Ort bereits durch andere Funksendeanlagen vorhandenen
Feldstärken einen Schutzabstand festlegt, damit Personen auch bei dauern-
dem Aufenthalt weder geschädigt noch gefährdet werden. Das BAPT fordert
bereits die Einhaltung der (entsprechend neuester Erkenntnisse der Wissen-
schaft in dem Normenentwurf 10191 der DINIV DE 0848 Teil2) empfohlenen
und wesentlich verschärften Grenzwerte. Dies gilt auch für Anbieter von Funk-
telefonen und anderen mobilen Funkstellen.
Diese neue Verfahrensweise gilt als Veröffentlichung im Amtsblatt des Bun-
desministers für Post und Telekommunikation für alle Festfunkstellen größer
10 W. Der genaue Wortlaut und das Durchführungsverfahren kann dem
Amtsblatt Nr. 12192 vom 1. 7. 92 entnommen werden. Beziehen kann man
es bei: Vertrieb amtlicher Blätter beim Postamt I, Postfach 10900I, W-5000
Köln 1. Lassen wir uns vom gesunden Verstand leiten und nichtein X für ein
U vormachen, auch nicht von einem Nachbarn, der vielleicht gerade auf
"Umwelttrip" ist.
Jörg, DL7UJW
Zweite Runde
Vor vier Monaten ging es an dieser Stelle um den "rohen Entwurf"
der neuen Durchführungsverordnung zum Amateurfunkgesetz,
dem Dokument, das den Rahmen für die Tätigkeit der Funkama-
teure absteckt. Ein Sturm der Entrüstung bewegte darob die OMs.
Am 24. Juli unterbreitete das BMPT acht Amateurfunkverbänden
den zweiten Entwurf, an dessen Ausarbeitung nun auch wieder die
Projektgruppe beteiligt war und den DJ2NL recht treffend als die
Wende bezeichnete, obwohl er sich vom ersten vielleicht nicht wie
Tag und Nacht unterscheidet. Man hat alle Dinge fallenlassen, die
keinen Bezug zum Amateurfunkgesetz haben bzw. die in anderen
Rechtsvorschriften geregelt sind, so daß der neue Entwurf weit kür-
zer ausfiel und etwa wie die gültige DV-AFuG abgegrenzt ist.
Der schon im Rohentwurf deutliche Wille zur Liberalisierung, der
sich inzwischen auch in der Freigabe der Scanner dokumentierte
(wir kommen im nächsten Heft darauf zurück), zeigt sich im zwei-
ten Entwurf noch wesentlich klarer, so daß die Verbände im ganzen
erst einmal recht zufrieden waren. Wichtigste Neuerungen: nur
noch zwei Lizenzklassen (weiter Telegrafie), keine Altersbegren-
zung (Kann-Bestimmung), Ausbildungsfunkbetrieb für alle, außer
im Störungsfall keine Logbuchpflicht mehr, Genehmigung gilt
ohne Rufzeichenzusätze für beliebige Standorte, Rufzeichennen-
nung nur noch zu Beginn und Ende eines QSOs, Verbindung mit
öffentlichen Telekommunikationsnetzen (außer für Sprache) zu-
gelassen.
Die Liberalisierung ist jetzt so deutlich, daß der eine oder andere
schon wieder etwas kalte Füße bekommt. Das BAPT zieht sich
nämlich mit seinen Außenstellen weitgehend von der Szene zurück
und überläßt das Feld den Funkamateuren bzw. ihren Verbänden.
Selbstregulierung heißt das Zauberwort. In den USA gibt es diesen
Terminus schon länger, und vielleicht hilft bei der Beurteilung der
Lage auch der Blick dorthin.
Von Staats wegen gibt es dann im wesentlichen die neue DV-AFuG
als gesetzliche Grundlage; die Außenstellen der Genehmigungs-
behörde BAPT stellen die Genehmigungen aus, behalten sich eine
Kontrolle über den Gang der Prüfungen vor. Als arbeitsintensiver
Teil wird auch die Bearbeitung von Störfällen in der Kompetenz der
Genehmigungsbehörde bleiben. Alles andere regeln die Amateure
selbst, vom Löwenanteil an der Prüfungsdurchführung (samt Gebüh-
renfestlegung) über die Genehmigung von Klubstationen, Relais-
funkstellen, Digipeatern, Links, Mailboxen, Clustern usw., von
Bandplänen und dergleichen ganz abgesehen.
Das funktioniert nur, wenn es gelingt, Interessenkonflikte verschie-
dener Gruppen beizulegen, Kompromisse zu finden und durchzuset-
zen sowie das Miteinander der sehr unterschiedlich großen Verbände
zu organisieren. Dazu gilt es, über den eigenen Gartenzaun zu schau-
en, Entwicklungen zu erkennen, nicht nur die eigenen Wünsche als
berechtigt anzuerkennen, Toleranz zu üben. Auch mehr Öffentlichkeit
als zur Zeit üblich täte not. Nur in Fällen, in denen das Amateurfunk-
gesetz einschließlich Durchführungsverordnung oder andere gesetz-
liche Regelungen verletzt werden, greift eine übergeordnete Stelle ein,
auf der Ebene der Selbstregulierung dagegen sind Repressalien weit-
gehend unmöglich. Mehr Freiheit bedeutet mehr Verantwortung.
Unmittelbar nach der Interradio im November soll nach dem gegen-
wärtigen Zeitplan die Endfassung der DV-AFuG entstehen, am
Neujahrstag soll sie bereits gelten; nur noch wenig Zeit, sich an
einige neue Freiheiten zu gewöhnen. Packen wir es an!
Beste 73
B. Petermann, Y22TO
Computer extern
Campwer extern ist das Leitmotiv dieses FA-Heftes . Will heißen, im dop-
pelten Sinne extern. Denn wenn es nicht gerade ein Laptop, Notebook oder
Palmtop ist, hängen an des Computers vielen Buchsen ja von vornherein
verschiedene externe Funktionsgruppen: Tastatur, Monitor, Maus, Drukker,
vielleicht noch ein Scanner und anderes. Aber die Verbindung kann viel
weiter reichen − wenn man will, um die ganze Weit. Wem nicht immer noch
das Telefon versagt blieb, ist potentiell dabei.
Dem Telefonkunden stehen u. a. Bildschirmtext (Btx) und der weltweile Da-
tenaustausch mit Einzelpartnern zur Wahl, er kann sich in Mailboxsysteme
mit ihren umfangreichen Möglichkeiten einklinken, vielleicht möchte er den
Computer auch nur als Faxgerät nutzen.
In manchem noch besser sind die Funkamateure dran, die eine ganze Reihe
computergestützter Übertragungsverfahren einsetzen können. Sogar kosten-
los, was die Übertragung als solche betrifft, dafür aber zu Lasten des er-
laubten Nachrichteninhalts, denn der Amatew funk ist ein nichtkommerzieller
Funkdienst, und auch Mitteilungen an Dritte sind nur äußerst eingeschränkt
erlaubt. Funkfernschreiben in der herkömmlichen Form als RTTYund weiter-
entwickelt als AM TOR und PA CTOR, das sich besonders starkem Interesse
erfreuende Packet Radio sowie Farb-Schmalbandfernsehen (SSTV)
und Fax-Bildübertragung gehören heute schon zum Standard. Und die dem-
nächst zu erwartende Modifizierung der deutschen Amateurfunkregulative
düifle mit großer Wahrscheinlichkeit beachtliche Freiräume zur Erprobung
neuer Übertragungsve1Jahren öffnen.
Guter Grund für einen Computerfreak, über eine Amateurfunkprüfung
nachzudenken, aber auch ein Funkamateur könnte an den inhaltlich kaum
eingeschränkten Möglichkeiten per Telefon Gefallen finden. Draht und
drahtlos haben hier viele Gemeinsamkeiten.
Bleibt anzumerken, daß sich der Funkweg fre ilich auch passiv nutzen läßt:
Wellerfax-Empfang (s. auch Ausgabe 7192) verschiedener Couleur wird
vielstimmig propagiert, BC-DXer erweitern ihre Sphäre durch Zusatzgeräte
zur Dekodierung aller denkbaren Sendearten oder einen voll computerge-
steuerten Empfänger, und dem Softwaresammler bringt der Satellitenkanal
PRO 7 huckepack auch Digitales ins Haus.
Drei Dinge braucht der Mann aber zu allen diesen Außer-Haus-Connections:
Erstens irgendein (meist schwarzes) Kästchen, seltenereine Steckkarte
− Modem, Codec, Konverter, Umsetzer, Terminal, Controller, Dekoder,
Transverter oder noch anders genannt (was heißt denn nun fachgerecht
wirklich wie?) −, das des Computers Daten in eine für die Übertragung ge-
eignete Fasson bringt und/oder umgekehrt. A lles möglichst prozessorge-
stützt mit einer Fehlerrate von Null, wozu es dann zweitens natürlich auch
der passenden Software bedarf. Und last but not least: Der Operator muß
dann den ganzen Kram auch installieren und bedienen lernen.
Hard- wie Software bietet der Markt für alle genannten Anwendungen in
Fülle, so daß Punkt drei sich dann manchmal schnell zur eigentlichen Hürde
mausert. Selbst wenn das Handbuch einmal erste Sahne und nicht etwa in
Englisch sein sollte- es gibt immer noch Murphy und die klitzekleinen peri-
pheren Problemchen, Fehler oder Unterlassungen, die so oft und lange jede
ordentliche Funktion unterbinden. Wohl dem, der einen Insider k ennt, der
die wichtige Mini-Info hat oder den Groschen im Kopf des Newcomers zum
Fallen bringt. Besagter Newcomer tut im Sinne seines Erfolgserlebnisses ver-
mutlich auch gut daran, nicht gleich das teuerste, beste und damit kompli-
zierteste Set zu kaufen (ein Parameter versehentlich verändert und nichts
geht mehr).
Trotzdem: Ein neues Metier ist immer eine Herausforderung. Wir wollen in
diesem Heft Anregungen für die Beschäftigung damit und die eine oder an-
dere Hilfestellung fiir künftige weiterreichende Kontakte geben.
Viel Spaß und Erfolg!
B. Petermann, Y22TO
Friedrichshafen
Zur dreitägigen HAM RADIO '92 nach Friedrichshafen am Bodensee kamen
Funkamateure aus aller Welt- der höchste jemals bei einer Messe in
Friedrichshafen gezählte Anteil ausländischer Gäste; er betrug rund 25%.
Die 17. Internationale Amateurfunk-Ausstellung, die HAM RADIO, war in
diesem Jahr von einem beachtlichen "Wachstumsschub" gekennzeichnet:
50% mehr Elektronik-Aussteller, 206 Ausstelleraus 17 Ländern, 25% mehr
Fläche in fünf Hallen und Freigelände, erstmalige Verleihung eines Ama-
teurfunktechnikpreises, knapp 20 000 (plus 6%) Besucher.
Einer der großen Anziehungspunkte war der in Halle 7 neu eingerichtete
"Schwerpunkt EDV"; der Computer drängt sich immer näher an die tradi-
tionellen Funkgeräte des Funkamateurs. Beeindruckend große, farbige
Bildschirme mit SSTV, A TV, Zonen-, Land- und Wetterkarten, Fax, Packet
Radio und anderem. So konnte man das sprichwörtliche "Schnäppchen"
(nicht nur auf dem Flohmarkt) machen. Tenor des Aussteller-Fazits: Alle
Erwartungen wurden übertroffen. Das gilt genauso aus Sicht der Besucher:
Sagenhaftes Bodensee- (Urlauber-) Sommerwetter, erträgliche Temperaturen
in den Hallen, gutes Durchkommen in den hinreichend breit gehaltenen
Gängen zwischen den Ständen, breites, überschaubares Angebot.
Den vom DAR C neugeschaffenen, mit 5000 DM dotierten H orkheimerpreis
bekamen zwei junge Funkamateure (Jahrgang 1965 und 1967): Florian
Radlherr, DLBMBT, aus München und Johannes Kneip, DG3RBU, aus Regens-
burg. Es wurden damit ihre Versuche zur digitalen Sprachübertragung sowie
die Entwicklung der Sprachmailbox ausgezeichnet. Der Deutschlandfunk
berichtete am Eröffnungstag der HAM RADIO in seiner Nachmittagssen-
dung "Technik aktuell" darüber, sprach auch mit den jungen Preisträgern
und sendete einige Beispiele zur Digitalisierung der Sprache.
"Der Harn-Spirit läßt sich nicht digitalisieren ", so nahm der Präsident des
Osterreichischen Versuchssenderverbandes, Dr. Ronald Eisenwagner,
OE3REB, in seinem Grußwort zur Eröffnung die Preisverleihung zum
Anlaß seines Appells, den moralischen Kodex im Amateurfunk nicht weiter
in den Hintergrund treten zu lassen. Der HAM RADIO in Friedrichshafen
wünschte er, weiter Garant für das persönliche Kennenlernen der Funkama-
teure rund um den Globus zu bleiben und damit eine Renaissance des Ham-
Spirits einzuleiten.
Ich gebe das deshalb so ausführlich wieder, weil damit angesprochen wurde,
was häufig zu hören war, wenn sich Funkamateure nach jahrelangen Ge-
sprächen perFunk beim Bodenseetreffen erstmals persönlich gegenüber-
standen. Herzerfreuend sind die durch Grenzöffnungen möglichen Begeg-
nungen. Ich lernte im vergangenen Jahr auf der HAM RADIO das Magazin
FUNKAMATEUR und seine Redaktion kennen. Meine Begeisterung über
die Arbeit, die darin schon viele Jahre für Funkamateure geleistet wird,
führte zu einer Beteiligung an dieser Arbeit und nun hier zu diesen Zeilen.
Bei jedem neuerlichen Besuch der HAM RADIO berühren mich solche Erleb-
nisse, werden Erinnerungen wach, drängen sich Vergleiche zu Bodensee-
treffen und Ausstellungen vergangener Jahre auf. So mußte ich an Konstanz
als vorhergehendem Ort der Geschehen denken, an meine Erlebnisse und
Begegnungen als Operator an einer Leitstation (DLOIM), als Besucher frühe-
rer Treffen auf der Insel Reichenau, dem Ursprung und Ausgangspunkt
des ersten Bodenseetreffens überhaupt.
Bei solchen Erinnerungen fällt der stärkere Trend zur Kommerzialisierung
auf. − Ausstellungen und Treffen bekommen unterschiedliche Gewichte. Ein
Zug der Zeit? Automatisiert durch das enorm wachsende Angebot technischer
Möglichkeiten und die steigende Zahl der Besucher?
Deshalb möchte ich hervorheben, was kaum beachtet wird: So mancher
Aussteller macht seine Arbeiten im Bereich Amateurfunk tatsächlich als
Funkamateur, also nicht hauptberuflich. Ausgeprägt ist auch nach wie vor
der freiwillige, persönliche Einsatz einer Gruppe von Funkamateuren und
deren Familienmitgliedern bei allen Vorbereitungen, Arbeiten, Ausbauten
und organisatorischen Dingen, die ein solches (Bodensee-) Treffen nun ein-
mal erfordert (Antennen für Tagungsstation, Einweisungen, Funkbetrieb,
QSL-Vermittlung, Treffen der YLs, DX-Freunde, 1nteressentengruppen,
HAM-Fest…).
Daran ändert sich nichts- die HAM RADIO '93 und das 44. Bodenseetreffen
finden vom 25. bis 27. Juni 1993 statt.
Heinz Prange, DKBGH
Stiefkind Kurzwelle
Viele Rundfunkhörer wissen es gar nicht mehr: Zu Zeiten, als der
UKW-Rundfunk noch in den Kinderschuhen steckte, also zu Beginn
der 50er Jahre, wollten viele einen Wellenbereich ihres Emp-
fängers nicht missen − die Kurzwelle. Unter den Jugendlichen war
es damals "in", Radio Luxemburg auf 6090 kHz zu hören, und ob-
wohl die Samstags-Hitparade nur mit Schwund und Störungen ins
Haus kam, war sie einfach ein Muß für jeden. Und heute? Wie es
scheint, gehört die Kurzwelle (und alle anderen AM-Bereiche) nur
noch den echten Insidern, A uslandsurlaubern, die auf ihre Heimat-
programme nicht verzichten wollen und den Afrikanern, die das
Tropenband in den Stand des Regionalrundfunks erhoben haben.
Oder kennen Sie ein Lieschen Müller, das während des Hausputzes
irgendeine KW-Station hört? Die Langdrahtantenne ist out, es lebe
der Teleskopstab. Warum auch nicht, hat doch der UKW-Rundfunk
von Anfang an einen gewaltigen Qualitätssprung gebracht,
der sich dann mit weiteren Verbesserungen-Stereo, RDS und Digi-
talisierung − immer mehr fortsetzte.
Warum allerdings jahrzehntelang der kurzwellige Bereich aus den
meisten Empfängern verbannt wurde, bleibt vielen ein Rätsel, zumal
fast alle mit Langwelle ausgerüstet waren- der Grund bleibtein
Geheimnis der Industrie, denn auf dieser Welle härte ohnehin
kaum einer. Oder kennt jemand von Ihnen die Erklärung?
Aber alles wird anders, wie die WARC 92 beschloß (wir informierten
darüber). Weltweit ab dem Jahr 2007 bekommt der kurzwellige
Rundfunk 790kHz dazu. Nach dem normalen Standard können
etwa 158 neue Sender ihre Frequenzen bekommen und bei Einseiten-
bandtechnik etliche mehr. Letztere soll (nach WARC-Empfehlung)
für alle KW-Sender die Norm werden − und hier liegt schon der Hase
im Pfeffer. Sicherlich kann bis zum endgültigen Termin (etwa im
Jahr 2015 oder später?) die Industrie geeignete Empfänger liefern,
die SSB-Empfang für alle Kurzwellen-Interessierten zu fairen Preisen
ermöglichen. Aber ob es sich alle Länder finanziell erlauben können,
die gesamten KW-Sender daraufhin umzurüsten, liegt eigentlich außer-
halb der Wahrscheinlichkeit. Die meisten von ihnen klagen heute
schon über Geldmangel, und immer mehr Stationen machen dicht
oder stellen ihren Auslandsdienst ein. Warum also solch ein Gerangel
um neue KW-Frequenzen?
Das Argument, daß die Kurzwelle wieder boomt, ist richtig. Mal
abgesehen von den BC-DXern: Auf keinem anderen Wellenbereich
können so viele internationale Stationen gehört werden, und daß
das Interesse groß ist, bewies unter anderem der Golfkrieg. Nie zuvor
war die Nachfrage an Weltempfängern so groß. Hinzu kommt,
daß es in sehr vielen Ländern Sender gibt, die deutschsprachige
Auslandsdienste unterhalten.
Ein weiterer Aspekt: Immer mehr interessieren sich für den Empfang
anderer Funkdienste. Obwohl der Empfang verboten ist, gibt es jede
Menge Zubehör und Software, um Fax, RTTY, Telegrafie und Wetter-
bilder zu empfangen. Das reizt den technisch interessierten (nicht nur)
Laien, denn mittlerweile kann jeder Weltempfänger bedienen, da
der Komfort ständig steigt- auch ein Grund, öfter mal in die Kurzwelle
hineinzuhören.
Ihr
J. Wernicke
Nur ein roher Entwurf
Der Rohentwurf der neuen DV-AFuG, wie im schönen Post/Telekom-Kürzel-
system die "Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Amateur-
funk" (AFuG- von 1949) heißt, läßt seit reichlich einem Monat die Wellen
bei den Funkamateuren hochschlagen. Und Anlaß dazu gab es genug.
Fühlte man sich doch durch dieses Dokument, dessen Endfassung die Mög-
lichkeiten, Rechte und Pflichten der etwa 70000 deutschen Genehmigungs-
inhaber für längere Zeit bestimmen wird, auf verschiedenen Gebieten teils
substantiell bedroht. Darüber trösteten auch beachtliche Verbesserungen
fürs erste nicht hinweg − schließlich beurteilt man ja so etwas in erster Linie
kritisch, sucht Schwachpunkte.
Positiv: z. B. erweiterte Möglichkeiten mit neuen Betriebsarten, Ausbil-
dungsfunkbetrieb, auf 160 m IARU-Bandplan-Konformität möglich, Ama-
teurfunkbetrieb ab 14 Jahren erlaubt, Verbindung mit öffentlichen Kommu-
nikationsnetzen (eingeschränkt) zulässig, 750 W auch für Klasse 2 (ex C),
es muß kein Logbuch mehr geführt werden…
Negativ: u. a. feh lt der Begriff Amateurfunkdienst, bei EMV-Problemen
könnten die Funkamateure oft den Schwarzen Peter haben, vom exklusiven
Status einiger Bänder kein Wort, dafür Zugriff anderer Dienste, laufende
Gebühren monatlich 16 DM (statt 3 DM), Prüfungsgebühr 170 DM bzw.
190 DM (der Bundesfinanzminister fordert kostendeckendes Arbeiten des
BAPT!)…
Am 9. April erhielten die Amateurfunkverbände etwas überraschend diesen
neu aufgebauten Rohentwurf. Schon am 24. April sollten die schriftlichen
Stellungnahmen vorliegen. Kaum Zeit für eine gründliche Durchsicht und
die Erarbeitung von durchdachten Änderungsvorschlägen. Der DARC
übermittelte zwar recht fix jedem Ortsverbandsvorsitzenden ein Exemplar;
als Mitglied hatte ich so aber trotzdem keine Chance, mich mit dem Inhalt
genauer vertraut zu machen, und in der Berliner Packet-Radio-Mailbox stand
der Text auch erst am 2. Mai. Obwohl das Hearing zur DV-AFuG, an dem
dann zwei Dutzend Verbände mit den Verantwortlichen an einem Tisch saßen,
"erst" am 4. Mai stattfand, kaum noch Zeit, sich aufzuregen oder zu
freuen . Denn danach stellte sich der Entwurf eigentlich schon nicht mehr als
Diskussionsgegenstand dar. Er sei eine Version, in der alle Gedanken zusam-
mengeschrieben seien, um sie nicht zu verlieren. Von vornherein stand
fest, daß sie überdies noch nicht juristisch ab geprüft war. Der DARC legte
zum Hearing eine 63seitige vorläufige Stellungnahme vor (die wiederum bei
den OVs einzusehen, aber nicht in der Mailbox zu finden ist), und auch die
anderen Verbände kritisierten massiv eine Vielzahl von Details. Die Behörde
fühlte sich dagegen in ihrem Willen zur Liberalisierung und Vereinfachung
mißverstanden.
Schon an den beidenfolgenden Tagen kam die zwar im Vorfeld bis Mitte vori-
gen Jahres, nicht mehr jedoch bei der Abfassung des ungeliebten Entwurfs
beteiligte "Projektgruppe Amateurfunk" (ProgAfu) zu einer Arbeitssitzung
zusammen, in der auch Experten des DARC vertreten sind. Sie überarbeitete
dabei unter Berücksichtigung von Änderungsvorschlägen und vorteilhafter
Regelungen des Rohentwurfs die geltende DV-AFuG und wird unter Hinzuzie-
hung anderer Amateurfunkverbände in Unterarbeitsgruppen die Anlagen
des DV-AFuG erarbeiten. Zur HAM RADIO trifft man sich, um die Arbeit
fortzusetzen. Acht Wochen vor dem abschließenden Hearing am 7. September
(das wäre der 13. Juli) soll dann der neue vorläufige Entwurfder Offentlichkeit
zugänglich gemacht werden. Dann sollte die Zeit ausreichen, sich auch als
"Funker von der Straße" Gehör zu verschaffen − sei es über die Linie DARC
oder direkt an das Referat 314a des BMPT (Postfach 8001, W-5300 Bonn).
Eine interessante Lehre noch für den demokratieungewohnten Ossi: Nach
Art. 80, Abs. 1 des Grundgesetzes ist die Exekutive beim Erlaß einer Rechts-
verordnung in keiner Weise gehalten, die dadurch betroffenen Personenkreise
auch nur zu hören, geschweige denn zu beteiligen. Freuen wir uns also
über die hier praktizierte rühmliche Ausnahme und nutzen wir die Chance
zur sachlichen, kompetenten und konstruktiven Mitarbeit. Sie dürfte zum
beiderseitigen Nutzen geraten.
Beste73!
Bernd Petermann, Y22TO
Öfter mal was Neues?
Sicherlich gehört es zum Vorrecht unserer modernen Zeit, daß die
Entwicklung der Maschinen immer rasanter vonstatten geht. Was
heute mega-in ist, ist morgen schon längst mega-out. Besonders am
Beispiel der Computer ist diese Tatsache zu beobachten. Für viele
sogar zu schnell, wassich aufdieser Ebene tut: Diskettenmit40MB
Speicherkapazität, Rechner, die mit VHF-Frequenzen getaktet werden
und fantastische Multivisionsfähigkeiten, die einen aus dem
Staunen nicht mehr herauskommen lassen (siehe Beitrag CeBIT).
Was müssen denn denjenigen, der sich heute stolz einen 386er auf
den Schreibtisch stellt, angesichts der Tatsache, daß morgen schon
der 586er im Laden steht, für blanke Ängste treffen? Und das ist
noch gar nichts gegenüber den gewaltigen Sprüngen, die die Software
macht. Wann kommt denn nun DR DOS 7.0 in die Läden?
Morgen oder übermorgen? Wenn nicht, aber spätestens nächste
Woche!
Nichts für ungut, aber betrachten wir die Angelegenheit einmal
nüchtern. Die Schreie nach den neuesten Softwareprodukten sind
heutzutage nicht mehr so laut wie zur Anfangszeit des 8088. Das
liegt gewiß an der Tatsache, daß damalige Verbesserungen beispiels-
weise an einem Textverarbeitungsprogramm noch wichtige
Features beeinhalteten, die die Arbeit wesentlich erleichterten. Ich
denke da an integrierte Lexika oder Synonym-Wörterbücher.
Heute sind Ward 5 und Wordperfect schon so ausgereizt, daß man
kaum alle Funktionen der Programme kennt und viele auch nie
braucht. Auch die Einarbeitung in eine neue Version kann durchaus
viel Zeit verschlingen, da sich Version A.0 wesentlich von der
B.0er unterscheidet.
Bei der Hardware sieht die Sache etwas anders aus. Schnelligkeit
und Speichervolumen sind schon ein wichtiges Argument, um sich
nach einer gewissen Zeit ein neues Modell zuzulegen. Dabei steht
die Frage, ob sich das eigene Modell aufrüsten läßt. Demgegenüber
ist aber letztendlich ein neuer Rechner preiswerter − eine Kompromiß-
lösung fordert finanzielle Tribute und ist irgendwann sowieso
erschöpft. Fazit: Man bleibt erst einmal bei seinem "alten" Modell
und schafft sich erst dann einen neuen Rechner an, wenn die vorhan-
denen Programme eine Neuanschaffung im Hinblick auf Grafik,
Schnelligkeit und Speicher fordern.
Daß dies geht, beweisen uns noch viele User, die mit einem C 64
oder anderen 8-Bitern arbeiten und nicht müde werden, deren Fähig-
keiten bis zur Ekstase auszureizen. Warum versuchen es nicht
auch AT-User? Oder verbrauchen sie vielleicht zuviel Energie, um
nach Neuigkeiten Ausschau zu halten bzw. sich in umfangreiche
Software immer wieder neu einzuarbeiten?
Sei es, wie es sei − jeder sollte versuchen, etwas aus seinem Computer
zu machen, ganz gleich, ob er ihn nur als bessere Schreibmaschine
nutzt, damit ernsthaft programmiert oder sich vielleicht mit
Hardware-Selbstbauprojekten beschäftigt. Auch, wenn die Industrie
will, daß die Kassen klingeln. Lassen wir sie erst die Kriege zu
Ende führen, die um Betriebssysteme, wie z. B. Windows 3.0 oder
OS/2, geführt werden. Vielleicht können wir dann sicher sein anwender-
freundliche Software zu bekommen und nicht irgendeine Version,
die Macken zeigt. Nur dann, so denke ich, kann man auch mal über
eine Neuanschaffung nachdenken.
Ihr
J. Wernicke
Man kommt sich näher in Berlin
Im Februarheft konnten Sie an dieser Stelle einen Z weijahresrückblick aus
der Sicht eines CE-Funkers lesen. Wohin hat sich nach den Turbulenzen des
Jahres 1990 und der Stabilisierungsphase des vergangenen Jahres nun der
Amateurfunk im Osten entwickelt? Einige Fragen beantwortet unser Inter-
view mit dem Distriktsvorsitzenden von Sachsen, OM Eike Barthels, DL2DUL,
auf Seite 188.
Berlin nimmt beim Zusammenwachsen (nicht nur auf dem Gebiet des Ama-
teurfunks) eine Sonderstellung ein, denn es gibt nicht wie in den anderen ost-
deutschen Bundesländern eine irgendwie autonome Neuorientierung, sondern
das Einfügen in Westberliner Strukturen und Maßstäbe geschieht direkter
und schneller: Zum bestehenden DARC- Distrikt mit 14 Ortsverbänden
gesellten sich nach dem Ende des RSV e. V. nur eben 9 neue Ostberliner, wobei
die neuen OVs (noch etwas dadurch zugespitzt, daß einige neue Mitglieder
sich alten OVs angeschlossen haben) sogar nur etwa ein Sechstel der Gesamt-
mitgliederzahl stellen. Auch hier blieb die langfristig zu erwartende Verdrei-
fachung der Zahl der Funkamateure bisher aus. An Funktionen. im Distrikts-
rahmen brauchte es so keine Veränderung.
Aber damit kann und muß man leben. Der Distriktsvorsitzende oder sein
Stellvertreter kamen zumindest einmal in jeden der neuen OVs, und das
frischgebackene DARC-Mitglied konnte so seine Sorgen zu Gehör bringen.
Und ein symphatischer Zug der Integration − es gab bei dieser Gelegenheit
Urkunden und Ehrennadeln für langjährige Mitgliedschaft im DARC, DDR-
Lizenzzeit mitgezählt.
Natürlich kommt man sich auch im kleinen. näher. Es gab einen Berlin-Bran-
denburg-Contest. Die einen Funkpeiler freuen. sich über ein. größeres
Wettbewerbsan.gebot, die anderen noch mehr über viel neues Gelände. Beim
DX-Meeting und auf dem DX-(UKW-)Kanal trifft sich eine Gemeinde.
Flohmärkte öffnen. ungeahnte Möglichkeiten. Und, und, und…
Der Zusammenhalt zwischen. den Noch- und Ex-Y2ern Berlins allerdings
war schon. einmal besser, gab es doch früher eine Monatsversammlung mit
meist weit über hundert Teilnehmern. Damit hatte es bald ein Ende, und
heute sind Treffen über den OV-Rahmen hinaus eher selten. Es ist dem DV
wohl zu glauben: Die Raummiete für ein Gesamtberliner Meeting mit noch
mehr Teilnehmern. kann keiner (mehr) aufbringen. Handikap Nummer 2:
Auch die Lizenzumstellung drückte Bekannte in die Anonymität, denn das
Rufzeichen. ist nun einmal des Funkamateurs Name. Beim ebenso ungeliebten
Wechsel von DM auf Y2 ließ es sich bei den DM2ern, die den größten Teil
der aktiven Funker ausmachten, noch umrechnen DM2A = Y21, DM2B = Y22 usw.
Mancher hat nun dafür die Initialen. im Call, hier und da wenigstens ein Fin-
gerzeig. Einige stört es auch, daß Ost und West durch DL7U../DL7V.. bzw.
DL7../DL7A.. weiter unterschieden blieben. Ein ironischer Lacher am Rande:
Im Februar hatten. die BAPT-Außenstellen nach weit über einem Jahr
immer noch keine neuen Genehmigungsurkunden. Die Prüfungen laufen aber,
und so tut es eben solange die behelfsmäßige Bescheinigung.
Fazit: Es geht voran, einige weitere Schritte aufeinander zu, auch über In-
teressengruppen hinaus, könnten aber nicht schaden. Beklagte doch der Dis-
triktschef etliche Wochen nach Bekanntgabe über den. Rundspruch, daß
noch keine Ostberliner Anmeldung für die Mondscheinfahrt Anfang Mai
vorläge. Aber es kommen bestimmt noch welche, ist ja noch Zeit.
In diesem Sinne- auch über Berliner Grenzen hinaus: beste 73 de
B. Petermann, Y22TO
Vertrieb neu organisiert
An dieser Stelle der Ausgabe 12/91 hatte ich Ihnen angekündigt,
daß unser Verlag die Weichen stellt, um zu Beginn des zweiten
Quartals I992 den Vertrieb der Zeitschrift FUNKAMATEUR einer
privaten Firma zu übertragen und damit alle Probleme, die es bisher
im Vertrieb der Zeitschrift so gab, mit einem Schlag aus der Welt
zu haben.
Diese Umstellung auf Eigenvertrieb mit einem soliden, potenten
Partner mit modernem Know-how auch für die Verwaltung der
Abonnentenangaben, ist jetzt perfekt.
Das wird ab der Ausgabe 4/92 wirksam. Die Vorteile liegen aufder
Hand: Gleich, ob sie irgendwann einmal ihr Abo beim Postzeitungs-
vertrieb abgeschlossen hatten oder über unseren Verlag bzw.
die Herforder Anschrift − jetzt erfolgt die Auslieferung direkt aus
Berlin. Wenn Sie also ab sofort Bestellungen, Nachfragen, Wünsche
zum Vertrieb des FUNKAMATEUR haben, richten Sie sie bitte aus-
schließlich an diese Anschrift: Brandenburgisches Verlagshaus,
Vertrieb, Storkower Str.I58, O-I055 Berlin.
Für Sie werden diese Umstellungen "nur" durch pünktliche, zuver-
lässige Belieferung spürbar sein, denn ansonsten ändert sich für Sie
nichts.
Zwei Klippen zu umschiffen, ist allerdings bei dieser Umstellung
unumgänglich. Die Zustellung der Zeitschriftenexemplare erfolgt
über den Postdienst, und Sie wissen aus eigener Erfahrung, daß
dessen Laufzeiten zwischen Saßnitz und Klingenthai noch nicht
jene zwischen Flensburg und Koblenz sind! Und: Alle FUNKAMATEUR-
Leser, die ihr Abo beim defacto in Auflösungbefindlichen Post-
zeitungsvertrieb abgeschlossen hatten, kennen ja sicher den Zu-
stellaufkleber: Hier sind Angaben in einem nur territorial verständ-
lichem Kode enthalten. Die Straßennamen zu entschlüsseln,
muß nicht in jedem der 25 000 Fälle (soviele Abonnenten haben
wir allein bei der "Post") gelingen, zumalsich seit dem 3. Oktober
I990 auch viele Straßennamen geändert haben. Aber bleiben
Sie zunächst cool und vertrauen Sie den Kodeknackern. Wenn jedoch
dieser oder jener Bezieher seine Ausgabe 4192 nicht spätestens
Mitte April erhalten hat, schreiben Sie bitte an die oben angegebene
Anschrift. Wir werden dann zusammen mit der neuen Partnerfirma
umgehend Sorge tragen, daß Sie Ihr persönliches FUNKAMATEUR-
Exemplar bekommen.
Übrigens wird sich diese Umstellung auch für die Käufer im Zeitschrif-
tenhandel positiv auswirken. Der neue Vertreiber übernimmt auch je-
nen Teil der Auflage aus unserer Druckerei, der über die Zeitschriften-
Grosso-Betriebe an die Verkaufsstellen gelangt. Damit dürfte eine
weitere Schwachstelle im Vertrieb der Vergangenheit angehören − jetzt
ist alles in einer Hand zusammengeführt. Wenn die Zeitschrift nun
nicht am Kiosk zu sehen und/oder zu bekommen ist, wenden Sie sich
ruhig auch an die oben angegebene Anschrift wir setzen uns dann
mit dem Grossisten in Verbindung. Dazu brauchen wir natürlich auch
die Angabe Ihres bevorzugten Zeitungshändlers ganz in Ihrer Nähe.
Ich will den Ausstieg aus dem Postzeitungsvertrieb aber nicht ohne
einen Dank an die vielen Frauen und Männer machen, die den
FUNKAMATEUR bis dato an den Kunden brachten.
Ihr
H. Radke
Zwei Jahre CB-Funk im Osten
Erinnert sich der eine oder andere an den Januar 1990? Sicher wer-
den die CE-Funker dieses Datum noch im Gedächtnis haben und
vielleicht an eine damalige Zeitungsmeldung denken: "Bürger der
DDR können ab sofort Genehmigungen zum Betreiben von Funkge-
räten des 27-MHz-Bereiches gemäß CE-Standard auf Antrag erhalten…"
Diese Meldung schlug zu jener Zeit wie eine Bombe ein, denn bei
vielen war der Wunsch nach CE-Funk schon lange vorhanden.
Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten (der Zoll wußte davon noch
nichts) mehrten sich die Anträge bei den Postdirektionen, und
in den Städten waren die zuständigen Mitarbeiter total überlastet.
Irgendwie aber kam der Interessierte dann doch zu seiner Geneh-
migung, und die 5 Mark Gebühr, die monatlich gezahlt werden
sollten, aber nie eingezogen wurden, störten keinen, der schnell
sein erstes QSO fahren wollte.
Und heute? Vorbei die Euphorie der ersten Stunden, vorbei die er-
sten Gehversuche mit den höflichen Funkverbindungen und den
heiß erwarteten Funkertreffs. Stattdessen: Routinierte QSOs, die
oft ins Triviale gehen, überfüllte Kanäle in den Ballungsgebieten
und Postverstöße en gros. Fachgeschäfte erfreuen sich auch noch
heute großer Umsatzzahlen − besonders beim "Ella"-Zubehör und
verschiedenen anderen Schnickschnacks wie Echomikrofonen und
Richtantennen.
In der Tendenz ist der Umgang untereinander grob und unpersönlich
(Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel) − viele CBer betätigen
sich als Stammkanal-Wachhund und lassen unter dem Motto:
"Auf die Dauer hilft nur Power" keine andere Station herein und
sind dann auch noch tödlich beleidigt, wenn diese sich dann auch
mit Träger-Stellen revanchiert. Ähnliche Vorfälle und Beispiele
sind besonders in Ballungszentren täglich zu beobachten. Da be-
dauern viele "postalische" Funker, daß sich der gelbe Konzern
nicht auf die "Wattriesen" stürzt und ihnen den Garaus macht.
Vielleicht denkt auch mancher CE-Funker noch mit Wehmut an die
"alte" Zeit zurück und möchte vielleicht sogar seine Kiste verkau-
fen, weil die CB-Funkerei "auf den Hund" gekommen ist. Sollte
man nicht stattdessen nach Alternativen Ausschau halten? Mehr
Höflichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme vielleicht- und einmal
versuchen, ob es nicht auch ohne Sendeverstärker geht. Das
wäre ein nützlicher Anfang- und es würde dazu beitragen, daß die
Newcomer nicht gleich resignieren und das Handtuch werfen, zumal
es vorerst bei den nur 40 Kanälen bleiben wird.
Mir liegt es fern, Moral zu predigen, aberangesichtsvieler CE-Funker,
die schon jetzt den Wunsch hegen, einmal Funkamateure zu werden,
kann ich nur dazu raten, einmal in diese Bänder hineinzuhören.
Selbst bei starkem Contestgerangel ist der größte Teil höflich und
diszipliniert − geht ja auch nicht anders, angesichts der oftmals
hohen Leistungen. Ehemalige CBer unter den Lizenzierten werden
mir das bestätigen können. Das ist einer von den großen Unterschie-
den zwischen dem Jedermann- und dem Amateurfunk.
J. Wernicke
Solar in polar(en) Zeiten
Unser Titelbild soll die Bastler unter Ihnen nicht auf die falsche
Fährte lenken. Es ist draußen Winter, aber dennoch ist da Licht-
hinter das wollen wir Sie nicht führen. Sie werden weder eine Bau-
anleitung für den Hausbau noch eine für die Stromversorgungs- oder
für die Brauchwasseraufbereitungsanlage per Solartechnik in dieser
Ausgabe finden. Uns war das Prinzip Solartechnik wichtig, dafür
halten wir Tips und Wissen parat. Weil aber eine einzelne Solarzelle
im besten Falle soviel Strom zu erzeugen vermag, wie ein Taschen-
radio braucht, sind auch für den Selbstbaupraktiker Solarmodule
und Solargeneratoren interessant, natürlich nicht in der Größen-
ordnung wie auf dem Titel.
Gerade für den Elektronik-Praktiker bietet die Energieerzeugung
mittels Solarzellen viele Einsatzgebiete: Spielzeuge aller Art, die fast
dem perpetuum mobile gleichen, Ladegeräte für Akkus verschiedener
Größe, mobile Meßgeräte, Energieerzeuger für Alarmanlagen oder
Bewegungsmelder … Empfehlenswert: "Das Solarzellen-Bastelbuch"
(ISBN 3-922964-29-X, 14,80 DM, Ökobuch Verlags GmbH Staufen).
Auch für viele Funker dürfte diese Technik interessant sein, denn
die Stromversorgung der "Funke" bei mobilen Einsätzen − gleich ob
auf einem Wasser- oder einem Landfahrzeug − ist mit Hilfe
von Solarenergieanlagen günstig zu gestalten. Die Industrie
bietet für fast jeden Bedarf Passendes an.
Sie wissen es ja − das Licht ist ein unerschöpflicher Energievorrat.
Die Protonen setzen Elektronen in Bewegung, wenn sie auf bestimmte
Stoffe treffen. Solarenergieerzeugungsanlagen auf Fotoelementebasis −
die Industrie hat hierfür den Begriff Photovoltaik geprägt − sind
aus Siliziumscheiben gefertigt, deren eine Seite durch Elektronen-
überschuß negativ, deren andere durch Elektronenmangel positiv ge
laden ist. Das Licht fällt auf die Zellenoberfläche − hierbei ist der
Neigungswinkel ein wichtiger Faktor − und bewegt die Elektronen
in den unterschiedlich geladenen Schichten. Äußere Verbindungen
schließen den Stromkreis; über die Kontakte fließt der Strom.
Bei unseren Recherchen stießen wir auf eine Berliner Firma, die
sich neben Verkauf (auch mit Bastlerangeboten bis hin zu Meßgerä-
ten, Spannungswandlern, Vorschaltgeräten, Solarradios, Literatur)
und Beratung auch der Schulung widmet. Themen der drei- bis vier-
stündigen Einführungsveranstaltung nach Feierabend sind Nutzungs-
möglichkeiten der Solartechnik, solarthermische Systeme, solar-
elektrische Systeme (nächste Termine /3. 1. , 4. 2., 2. 3., 31 . 3. −
Voranmeldung unter Telefon 030 − 24 94 33). Natürlich gibt es
weitergehende Veranstaltungen, die bis zum Solarauto reichen
(was selbstzubauen Sie doch schon immer reizte?). Und wer nun
wirklich titelbildgemäß einen Teil seines Stroms selbst erzeugen
möchte (übrigens mit hohen Zuschüssen für die Errichtung und der
bezahlten Abgabe von Überschüssen ans öffentliche Netz) oder die
Wochenendgrundstücks-Warmwasserversorgung solar betreiben
möchte, f indet in dieser FUNKAMATEUR-Ausgabe sicher erste
Anregungen und kann nach unseren kleineren Anleitungen seine
Gesellenstücke schon mal beginnen. Ich wünsche viel Spaß.
Ihr
H. Radke
Heft: 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Jubiläum ohne Feier
Nun liegt er hoffentlich komplett vor Ihnen, der Jahrgang 1991 des FUNK-
AMATEUR (Restbestände einzelner Ausgaben haben wir noch vorrälig!).
Sicher ist kaum aufgefallen, daß wir damit den 40. Jahrgang des FUNK-
AMATEUR vollenden − solcherart Jubiläen sind wohl nur nochfür Nostalgi-
ker interessant, und selbst in der Redaklion kann sich keine rechle Freu-
de über diese Tatsache einstellen.
Dazu waren die Probleme mit dem Vertrieb der Zeitschrift im zweiten Halb-
jahr zu groß (und im Vertrieb gerade keine Probleme zu haben, entschei-
det). Zum einen war die Umstellung des Verlagsversands aus unserem Hau-
se nach Herford nicht unbemerkt für einige Abonnenten erfolgt, zum ander-
en hat der traditionelle ostdeutsche Postzeitungsvertrieb immer mehr an
Zuverlässigkeil und Qualität verloren. Der Postzeitungs vertrieb will diese
Situation mit Beginn des Jahres I992 ändern und erhöht deshalb (?) die Prei-
se für seine Dienstleistung. Hoffentlich mehren sich dann nicht mehr wie
bisher − selbst in der Redaktion − Beschwerden, Nachfragen, Nachforderun-
gen, Abbestellungen. Ich muß hier auf eine Besonderheit aufmerksam ma-
chen: Wer sein Abonnement irgendwann einmal beim Postzeitungsvertrieb
abgeschlossen hatte, hat diesen vorerst noch weiter als Parlner für alle Fra-
gen zum Bezug der Zeitschrift. Wer bereits − das war seit Beginn des Jahres
1991 möglich − zum Verlagsabonnement übergegangen ist, wendet sich
bitte mit seinen Fragen zum Vertrieb an: Maximilian-Verlagsgruppe, Frau
Köhler, Steintorwall 17, W-4900 Herford, Telefon (05221) 59 9142, Fax
(05221) 599125.
Bedauerlicherweise ist auch die Situation im Postdienst in Ostdeutschland so
angespannt, daß viele Abonnenten ihren FUNKAMATEUR − gleich ob
Verlagsversand oder Postzeitungsvertrieb − bis zu vier Wochen nach dem
Auslieferungstermin ab Druckerei zugestellt bekommen. Eine Situation, die
zu verändern nicht in unserer Macht liegt.
Auch, wenn unser Verlag jetzt alle Weichen stell!, um zu Beginn des zweiten
Quartals 1992 den Vertrieb einer privaten Firma zu übertragen, bleibt die
Tatsache, daß Ihr Exemplar des FUNKAMATEUR per Postdienst zugestellt
werden muß.
Vor einem Jahr an dieser S1elle mußte ich Ihnen mitteilen, daß sich der Ver-
leger gezwungen sah, den FUNKAMATEUR-Preis (nur) beim Verkauf im
Zeitschriftenhandel zu erhöhen. Ob Abonnent oder Kioskkäufer − einJahr
lang konnten Sie den dichtgedrängten Inhalt, die th emalische Vielfalt, den
Informationsreichtum, die Bauanleilungen, die Qualität des FUNKAMATEUR
zu einem besonders günstigen Preis bekommen. Jetzt ist eine Freisanhebung
aus der (winschaftlichen) Sicht des Verlegers (der nicht über Springer-
oder Burda-Millionen verfügt) unumgänglich geworden, und in die
Rentabilitätsrechnung geht auch ein, was der Vertrieb gegenüber dem bis-
herigen mehr kostet. So werden ab der Ausgabe 1/92 die Abonnenten für ihr
FUNKAMATEUR-Exemplar 3,90 DM, die Käufer im Zeitschriftenhandel
4,50 DM berappen müssen. Auch im neuen Preis sind Versandkosten und
Mehrwertsteuer inklusive. (Bezugsbedingungen s. Ausgabe 1192 im Impres-
sum auf der letzten Innenseite.)
Eine Erhöhung in dieser Größenordnung ist ein herber Schnitt, aber bitte
vergleichen Sie die Leistung, die Sie dafür erhalten, mit Leistung und Preis
anderer Anbieter. Ich bin sicher, daß dieser Vergleich zu Gunsten des
FUNKAMATEUR ausfällt. Damit Sie − auch zu Ihrem Vorteil − Ihren Bekann-
ten und Freunden diesen ständigen Vergleich ein Jahr lang ermöglichen
können, bieten wir Ihnen in dieser Ausgabe die einmalige Gelegenheit eines
Geschenkabonnements. Und was im Leben selten ist: Der Schenker erhält
auch ein Geschenk − von uns. Bille sehen Sie in die Heftmittel
Ich verbleibe mit den besten Wünschen für persönliches Wohlergehen und
Erfolg im Jahre 1992, und: Auf Wiederlesen im 41. Jahrgang.
Ihr
H. Radke
Markt der Eitelkeiten?
Inzwischen liegt die Internationale Funkausstellung in Berlin schon
ein paar Wochen zurück, und ihr grelles Bild beginnt zu verblassen.
Nicht von den vielen beeindruckenden Exponaten soll hier die Rede
sein − wir berichten auch in dieser Ausgabe davon, sondern von den
Impressionen eines (historisch bedingten) IFA-Neulings.
Diese weltweit größte Messe der Unterhaltungselektronik: Eine
große Show, Hörrundfunk und Fernsehen, öffentlich-rechtlich wie
privat, suchten sich darzustellen, sich ebenso wie die großen und
kleinen Firmen der Unterhaltungselektronik den Rang abzulaufen,
nicht zu vergessen Mobilfunker, Amateurfunk usw. Video undAudio
total. Lärmend, teils kaum erträgliches Gedränge, diverse Werbe-
gags, irgendwie erschlägt es einen. Wie soll das Leben erst ein
Vierteljahrhundert später aussehen? Es besteht nur noch aus Sound
und Video, raumfüllend, ununterbrochen, in unendlicher, sich
trotzdem ständig wiederholender Programmvielfalt, ganztägig berie-
selnd oder gar alles andere verdrängend? Weltweite Kommunikation,
aktiv wie passiv, für jedermann − dabei aber zunehmende
Vereinsamung. Was haben die Leute eigentlich vor fünfzig Jahren
in oder aus ihrer Freizeit gemacht, als es manchmal noch die Groß-
familie gab?
Zugegeben, etwas übertrieben, aber mancher Besucher wird ob der
Reizüberflutung ähnliches empfunden haben. Und meine Absicht,
hier so ganz überzeugend den Vorteil des Bildformats 16:9 gegen-
über 4:3, den Qualitätsgewinn durch D2-MAC, PALplus und gar
die verschiedenen HDTV-Varianten zu erleben, erwies sich als
schwer realisierbar. Irgendwo war alles zu sehen, aber eine tech-
nisch saubere Gegenüberstellung, auch mit Testbildern und dgl.
habe ich vermißt. Jede Firma präsentierte sich halt selbst, und da
wurde aus einem herkömmlichen TV-Bild dann auch mal ein Breit-
wandbild gleichen Inhalts mit flachen Köpfen und dicken Bäuchen.
Um technischen Fortschritt überzeugend vorzuführen wäre manch-
mal mehr Gemeinsamkeit der Aussteller vielleicht für sie und die
Besucher besser gewesen.
Gigantomanie und Nützlichkeit nicht nur im Auto eng benachbart.
Kilowatt-Subwoofer und 50 Displayfunktionen im Cockpitcontra
Abstandswarnerund computergesteuerte Straßenkarte neben dem
Lenkrad. Mehr als der Inhalt können so nicht nur beim Statusbe-
wußten zu leicht Form, Farbe und Design gelten. Sicher, Schwarz
als Maß aller Unterhaltungsdinge scheint erfreulicherweise an Aus-
schließlichkeit zu verlieren. Aber bei High End staunt dann doch
der Laie, und der Fachmann wundert sich − Ästhetik einer gedruck-
ten Schaltung. Bezeichnende Aussage an umsatzorientierte Fach-
einzelhändler: "Was so ein neues Fernsehgerät alles mehr kann als
das alte, sieht man ihm leider kaum an, ein 16:9-Bildschirm dage-
gen bringt einen deutlichen Prestigegewinn, also endlich wieder ei-
nen deutlich en Kaufanreiz." Design erhält als Mittel der Profilie-
rung gegenüber dem Mitbewerber immer größeres Gewicht. Jeder
muß sich selbst seinen Vers drauf machen.
Schade, es fällt schwer, sich in dem Wust von teils sogar inhalts-
gleichen Termini zurechtzufinden, die die Leistungsfähigkeit eines
elektronischen Geräts bezeichnen, und die Nützlichkeit der einen
oder anderen Funktion für den eigenen Bedarf zu beurteilen, so daß
letztlich meist Äußerlichkeiten die Kaufentscheidung bestimmen.
Einiges konnte man bei genauerem Hinsehen auch bei der IFA er-
gründen, wenn man nicht der Show erlag. Mehr aufzuhellen, werden
auch wir weiter versuchen.
Ihr
Bernd Petermann
Umsteigen- Lust oder Frust?
Nicht gerade aus Anlaß des zehnjährigen Jubiläums des legendären
IBM-PCs entschloß ich mich zum Kau feiner 16/32-Bit-Maschine die
Technik geht ja nun mal ihren Weg, und den grauen Zellen schadet
es auf keinen Fall. Also das Haushaltsbudget überprüft, ein
günstiges Angebot ausgespäht, und schon fand ich mich in einem
Geschäft wieder.
Auf dem Ladentisch stand einer dieser Computer und war voll in
Aktion − fantastische Grafik, und was da an Sound zu hören war,
übertraf meine Vorstellungen. Da brauchte ich als Freak nicht mehr
lange zu überlegen. Die ersten Gehversuche mit dem Rechner ließen
den Stundenzeiger der Uhr im Minutentakt ablaufen. Die Einführung
durch das Handbuch war gut. Der erste Frust kam allerdings
auf, als ich das BASIC lud. Ich staunte nicht schlecht, als die erste
Meldung mir einen freien BASIC-Speicher von "satten" 25 KByte
anzeigte (bei freiem Systemspeicher von 701 KByte). Immerhin
bringt es der alte Rechner auf 42 KByte.
Aber nicht nur das. Das DOS-Handbuch ist dergestalt verfaßt, daß
DOS-Begriffe, wie Batchdatei, Pfade und Joker schon von vornherein
als bekannt vorausgesetzt werden.
Mal eben schnell einen Screen oder gar ein kleines BASIC-Programm
auf eine soeben formatierte Diskette abspeichern, das kann
man sich total abschminken. Und wenn man gar nur ein Laufwerk
besitzt, ist es mit der Kunst schnell vorbei. Dafür gibt es aber un-
zählige Profisoftware und etwa 6000 PD-Programme: Ich kann spie-
len, bis die Augen viereckig geworden sind und mich beruhigen:
Wahnsinn, was der Rechner kann, wenn erst eine Harddisk, ein
Flicker Fixer und ein Genlockinterface installiert sind. Aber zuvor
sollte ich mir noch brauchbare Literatur besorgen, um meinen
Rechner richtig kennenzulernen.
Ach, was soll der nostalgische Blick auf den treuen Alten, was der
Gedanke an die unzähligen Augenblicke, wo ich mich wie ein klei-
ner Schuljunge freute, als ein Programm lief, das ich geschrieben
hatte. Die neue Herausforderung steht jetzt auf dem Tisch − kom-
pakt, teuer und ungeheuer leistungsfähig − wenn, ja, wenn erst alles
da ist: Literatur, nötige Zusatzhardware und natürlich auch teure
Programme. Und weiter habe ich eine sinnvolle Beschäftigung für
die Freizeit, kann mir eine Programmiersprache aussuchen, in die
ich tief eindringen kann und mich so richtig schaffen, auch wenn die
Software die Finanzen etwas mehr anknabbert.
Trotzdemfällt es mir schwer, mich von meinem 8-Biter vollkommen
zu verabschieden. Ach was, ich werde ihn behalten, denn Geld bekäme
ich kaum noch dafür, aber vor allem um die viele brauchbare Software
wäre es schade. Schön, wenn es passende Konvertierungsprogramme
geben würde, die einem das Umsteigen erleichtern (vielleicht kennen
Sie welche und schreiben uns zu dem Thema?). Aber außer Software
noch der Haufen Hardware, der in den Jahren dazukam − kein Grund,
alles für immer in die Ecke zu stellen.
Das geht wohl auch vielen so, denn im Gegenteil zu unserer Absicht,
den 8-Bitern in der Zeitschriftade zu sagen, erreichen uns nach wie
vor Anfragen, Wünsche und Beiträge von Freaks aus dieser Ecke.
So, wie sie ihrer Techniktreu bleiben, wollen wir es einstweilen auch.
Ihr
Jörg Wernicke
Wieder mit Technikpremieren: die IFA Berlin '91
Als vor zwei Jahren die Internationale Funkausstellung Berlin − über deren
Geschichte informierten wir in der August-Ausgabe − ihre Pforten am 3.
September 1989 schloß, harte der Veranstalter 389106 zahlende Besucher
registriert. Sicher waren schon damals einige aus deutschen Landen zwi-
schen Eibe und Oder darunter, aber den meisten dieser Interessenten blieb
der Weg zum Berliner Ausstellungsgelände unter dem Funkturm versperrt.
Verständlich, daß der Veranstalter 1991 mit einem neuen Besucherrekord
rechnet. Den unterhaltungselektronisch Interessierten erwarten neben ei-
nem speziellen technisch-wissenschaftlichen Programm, neben der HDTV-
Demonstration von "Eureka 95", neben den "gläsernen Studios" der Fernseh-
und Rundfunksendeanstalten, den unübersehbaren Angeboten der mehr als
400 Aussteller aus aller Welt auch technische Premieren wie schon oft zu dieser
Gelegenheit. Angekündigt ist die Präsentation des PALplus-Femsehsystems,
mir dem die terrestrische Fernsehausstrahlung der qualitativ hochwertigen
Satellitenübertragung angepaßt werden soll. Sicher lohnt sich ein gründ-
licher Blick in den Demonstrationsraum, in dem man sich selbst davon
überzeugen kann, daß PALplus-Signale auf normalen PAL-Empfängern
in bester Qualität zu sehen sind.
Interessant sein dürfte auch das "Digital Audio Broadcasting" (DAB − digi-
tales Übertragungssystem für den terrestrischen Hörrundfunk). Versprochen
wird ein simulierter Vergleich zwischen UKW-FM und DAB, der klar zuguns-
ten des neuen Systems ausfallen soll, besonders beim Empfang im Kraft-
fahrzeug − ohne Störungen durch Feldstärkeschwankungen und Mehrweg-
empfang.
Bisher wohl nur vorwiegend in der Literatur konnte man sich auch als inte-
ressierter Laie mit der Glasfaser als Übertragungsmedium in der Breitband-
kommunikation beschäftigen − in Berlin zur IFA '91 kann man es anfaßnah
erleben. Einen speziellen Beitrag bietet das Heinrich-Hertz-Institut, das unter
dem Motto "Fiber to the Home", den Glasfaseranschluß für jedermann,
eine integrierte optoelektronische Schnittstelle praktisch für zu Hause oder
für das Büro präsentiert, die erst eine wirtschaftliche Verwertung sinnvoll
werden läßt. Am Stand des lnstituls kann man sich auch über die optisch ko-
härenten Vielkanalsysteme (Coherent Multi-Channel, CMC) informieren,
die höchste Übertragungskapazität und Flexibilität in der Anzahl der anbiet-
baren Fernsehprogramme haben. Wer in Zukunft über dieses System verfügt,
kann mit einem optischen Tuner (einem oplisch durchstimmbaren Überla-
gerungsempfänger) aus rund einhunderl Fernsehprogrammen wählen.
Außerdem ist zu sehen, wie über Mehrweg-Endgeräte eine Vielzahl von
Schmal- und Breitbanddiensten realisierl werden können.
ln zwei Bereichen des technisch-wissenschaftlichen Programms wird ganz
besonders das Auge der Zuschauer angesprochen. Einmal geht es um ein
Fernsehtrickzentrum, in dem Trickformen aller Art vorgeführt werden,
auch die Veränderung einzelner Bildpunkle und die Einzelbildanimation
(etwa am Beispiel einer neuen ARD-Wetterkarte mit Bewegtbildszenen),
zum anderen werden in einem der Säle des ICC unter dem Stichworl HDTV-
Cinema HDTV-Vorproduklionen gezeigt.
Sicher dürfte das neue hochauflösende Fernsehen Ende der 90er Jahre zum
Renner werden. Und statt der "Einbahnstraße" vom Salelliten zum Teilnehmer
wird es sicherlich bald via Parabolantenne auch zu einer weltweiten Kommu-
nikation kommen − das klingt noch wie Zukunflsvision, aber die IFA '91
hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, spannende Technik-Ausblicke
zu geben. Nehmen Sie Einblick!
H. Radke
Die ganze Welt des Amateurfunks
Mit diesem Motto hatte Friedrichshafen zur 16. HAM RADIO und
dem 42. Bodenseetreffen des DARC geladen. Wenn unser Bericht
auch erst im nächsten Heft erscheinen kann, läßt sich schon resü-
mieren, daß der Vorjahresrekord durch etwa 17 351 Besucher
(+5,1%) wiederum überboten wurde, die zu zwei Dritteln einen
Weg von 100 bis JOOOkm nicht scheuten. Am Veranstaltungskon-
zept hat sich nichts geändert, aber selbstverständlich gab es viele
Neuheiten, die zumindest in Europa, das erste Mal zu sehen waren.
Die ganze Welt des Amateurfunks − zumindest was das Angebot an
Geräten, Zubehör und Einzelteilen betrifft, war in Friedrichshafen
zu sehen und zu kaufen, teils direkt, teils über deutsche Distributo-
ren. Aber nicht nur Technik war erhältlich; es gab auch bedruckte
T-Shirts, QSL-Karten und Rufzeichenschilder… Unverkennbar
ist der Amateurfunk ein Wirtschaftsfaktor, hier tummeln sich vom
japanischen Konzern über mittelständische Betriebe bis zum quasi
privaten Amateurfunk-Softwareanbieter viele Geschäftsleute. Die
QSL-Pinnwand zeigte, daß nicht nur fast jedes europäische Land
vertreten, sondern auch mancher Funkamateur aus Übersee ange-
reist war.
Als drittes Kriterium der ganzen Welt des Amateurfunks kann die
Vielfalt seiner Spielarten gelten. Auch hier full house. Die verschie-
densten Sendearten kamen, z. T. unter dem Dach des DARC,
ebenso zu ihrem Recht wie YLs, DXer, Diplomjäger etc. Die Messe
beschränkt sich selbstverständlich nicht auf den reinen Amateurfunk.
Funkinteressierte und BC-DXer konnten hier Weltempfänger, Scanner,
Wetterbildempfangsgerät, Modems für praktisch jede Sendeart,
Aktivantennen und und und erwerben. Computer gehören ja überall
sowieso dazu.
1991 − das zweite Mal, daß Funkamateure ostwärts der Elbe dabei
sein konnten, das erste Mal, daß sie als Bürger der Bundesrepublik
an deren südliche Grenze reisten. Der FUNKAMATEUR stieg dabei
auch eine Sprosse höher. Nicht mehr nur als Beobachter, auch als
Aussteller waren wir dabei, präsentierten unser Magazin einem teil-
weise überraschten Publikum. Man blättert interessiert. Eine neue Zeit-
schrift…? als Standardfrage. Nun ja, ein paar Jahrzehnte gibt es uns be-
reits, allerdings der Sicht der meisten Altbundesbürger entzogen.
Trotzdem kannte eine merkliche Zahl von Funkamateuren aus dem Wes-
ten Deutschlands den FUNKAMATEUR doch schon. Man hatte ihn jahre-
lang von einem Bezieher in der DDR geschickt bekommen. Aber damit
war es vor einem Jahr dann meist vorbei. Und so nahm mancher gern
das Angebot an, den ersten halben Jahrgang '91 zum Vorzugspreis gleich
mitzunehmen und eine Abokarte auszufüllen. Aufschlußreich auch die Ge-
spräche an unserem Stand: Thematische Breite findet in der spezialisier-
ten Zeitschriftenlandschaft durchaus weiter Interesse, ebenso unsere
leserverbundene und allgemein verständliche Darstellungsweise.
Auch Tips zum Inhalt und differenzierte Meinungsäußerungen haben wir
mit großem Interesse aufgenommen. Vor allem unsere Leser werden da-
von profitieren, daß es auch Kontakte mit Autoren gab, was sich bald
im FA wiederspiegeln wird. In diesem Sinne beste 73 de
Bernd, Y22TO
Zum 5. Male: Treffpunkt Laa
Die Veranstalter des Amateurfunktreffens in Laa an der Thaya hiel-
ten sich − wohl typisch österreichisch − mit Superlativen zurück,
freuten sich aber merklich über den Ansturm von 7000 Besuchern
und Gästen, über die hohe internationale Beteiligung: Funkama-
teure aus Jugoslawien, der CSFR, Ungarn, Italien, Bulgarien,
Deutschland (die verzögerte Visaerteilung ließ die angekündigten
OMs aus der Sowjetunion außen vor bleiben) und natürlich aus
Osterreich trafen sich − meist erstmals − einander direkt, erkannten
sich am bekannten Rufzeichen. Ein Fest des weltweiten Amateur-
funkens, zugleich auch das Amateurfunktreffen in Österreich
selbst.
Die freundliche Grenzstadt Laa, 60 Kilometer nördlich Wiens,
kann für sich in A nspruch nehmen, seit 1979 dieses Amateurfunk-
treffen jeweils an dem dem Himmelfahrtstag folgenden Wochen-
ende auf die Beine zu stellen. Schon bevor sich 1989 die osteuro-
päischen Grenzen öffneten, konnten die Veranstalter auch Teilneh-
mer − meist Offizielle der Amateurfunkverbände − aus den beiden
östlichen Nachbarländern begrüßen.
In diesem Jahr wurden allein rund 3000 Besucher aus der CSFR
gezählt!
Natürlich ist die Funkausstellung Laa − so der offizielle Name −
auch ein Markt: Neben professionellen Anbietern von Geräten für
Amateur- und kommerziellen Funk, von Elektronikbauteilen und
-bausätzen und Computertechnik findet ein Flohmarkt statt, der so
manches Schnäppchen zu machen gestattete. Für mich war regis-
trierenswert, daß ein böhmischer Elektronikbastler mit seinem
Angebot von steinalten Spulen und Drehkos einen Stau an Interes-
senten verursachte − nur Nostalgie der Besucher aus dem Gast-
geberland?
Erstmals in diesem Jahr: Ein herrlich fröhliches HAM-Fest. Am
Grill: Der Präsident (!) des Österreichischen Versuchssenderver-
bandes, Dr. Ronald Eisenwagner, OE3REB, und, wie an diesem
Abend, so überall und an allen diesen Amateurfunktagen, wo im-
mer zupackende Hände nötig waren: OMs der ÖVSV-Ortsvereine
des Weinlands (die Gegend heißt wirklich so), deren YLs und auch
vielfach deren Kinder…
Ebenfalls in solch großer Runde erstmals: der Informationsaus-
tausch von Vertretern der Amateurfunkverbände aus Österreich,
Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, der CSFR etwa über Frequenz-
angelegenheiten, Notrufdefinition, CEPT-Einführung…
Nicht neu, doch für viele Besucher immer wieder oder erstmals in-
teressant: Vorführungen der Amateurfunkstation OE3XLA, Ama-
teurfunkfernsehen, Amateurfunkpeilen, Packet Radio, Oldtimer-
funkgeräteschau…
Geistige Väter dieser Funkausstellung sind Manfred Fass, OE3MFS,
und Kurt Künzl. Am Stammtisch entstand die Idee hier am Rand
Österreichs Leben in die Stadt zu bringen. Viele Förderer und Hel-
fer schlossen sich tatkräftig der Idee an, und- keine Superlative
− der Erfolg gibt den Initiatoren recht. Und unterdessen ist Laa
immer noch am Rande Österreichs, doch gleichzeitig plötzlich auch
in der Mitte Europas.
H. Radke
Das Elektroniker-Mekka
Das Mekka liegt mitten im Autobahnkreuz A1/A2/A 45 und A44,
heißt eigentlich Dortmund und war Anfang Mai wieder einmal An-
ziehungspunkt für mehr als 70000 Elektronik- und Computerfreaks:
die Hobbyfranie & Computerschau.
Eine Halle des Dortmunder Messezentrums beherbergte Elektronik-
anbieter aller Couleur, eine die Computerszene, wobei die Differen-
zierung schon stark verwischt war. Und wer behauptet, die Elektro-
nikbastlerei sei heute out, der möge sich einmal unauffällig in die
50-m-Schlange (dreireihig) vor dem Conrad-Pavillon einreihen
und den Gesprächen der nicht so sehr am Computer Interessierten
lauschen, den Andrang an Ständen mit Leuchtdioden, Elektronikrest-
posten und bei Werkzeuganbietern ansehen. Freilich, der Schwer-
punkt ist inzwischen in Richtung Computer gerutscht, aber gerade
die jüngere Generation (!) war unter den Elektronikfreaks anzutreffen.
Für die Hobbyfranie muß man Zeit mitbringen, denn außer dem Kom-
merz gibt es hier interessante Berufsberatung, Aktionszentren der
Amateurfunk- und BC-DX-Gilde, die rollende CE-Museumsrepräsentation
und mehrere interessante Fachausstellungen − so in diesem Jahr über
die historische Entwicklung des Autoradios, die der Bürotechnik sowie
eine electronic-art-Ausstellung, auf der Künstler ihr Verhältnis zum
Kommunikationszeitalter dokumentierten − von abgefahren bis nach-
denklich machend.
Ein interessantes Vortragsprogramm auf allen Gebieten, von MSDOS
bis zur Satellitenempfangspraxis, rundete das Programm der
Schau ab.
Erfreulich auch der im Gegensatz zu anderen Ausstellungen "volkstüm-
liche" Eintrittspreis von 10 DM. Klar, man zielt ja auch auf jüngere Aus-
stellungsbesucher. Die waren übrigens reichlich vertreten, gleich ganze
Schulklassen, eine Sache, die auch hierzulande nachahmenswert er-
scheint. Man wächst in einer Welt der Elektronik und der Computer auf,
und Anschauen und Anfassen sind immer noch die einprägsamsten Lern-
methoden.
Und zu begreifen (im doppeltem Sinn) gab es in Dortmund wahrlich eine
ganze Menge, besonders die Einkaufstaktik für Neu-Bundesbürger. Aber
das ist schon eine ganz andere Geschichte, die wir uns von einem Hobby-
tronic-Insider im Juli-Heft erzählen lassen wollen.
Beeindruckend ist solch eine Schau allemal, nirgendwo erlebt man die Spann-
weite zwischen verkauftem Elektronikschrott und 486ern, zwischen echter
Beratung aus eigener Erfahrung und blanker Anreißerei so hautnah, nir-
gendwo kann man so preiswert, aber auch so viel zu teuer einkaufen, und
nirgendwo hat man alle Anbieter so dicht beeinander; nirgendwo läßt sich
einmal so direkt vergleichen, wie in Dortmund.
In diesem Sinne, merken Sie sich doch Ihre Hobbytronic-Tour
nach Dortmund schon heute vor, für den 25. bis 29. März 1992!
Ihr
M. Schulz
Leipziger Frühlings-Gefühle
Etwas flau war mir schon zumute, als ich, die Meldung vom Fern-
bleiben von zwei Dritteln der Aussteller und die mit des Wirtschafts-
ministers Eingeständnis einer "Fehleinschätzung gewaltiger Dimen-
sion" des Wirtschaftspotentials Ostdeutschlands noch frisch im Ohr,
in den (keineswegs voll besetzten) Zug nach Leipzig stieg.
Im Frühjahr '91 hatte die Messe nicht nur einen neuen Chef, sondern
präsentierte sich auch erstmals in konsequenter Trennung als Kon-
sumgüter- (Innenstadt) und Technikschau (Messegelände). Zu letz-
terer zog es mich hin, herauszufinden, wie die Zukunftschancen
der Elektronikindustrie im Beitrittsgebiet stehen.
Die Kombinate sind zerlegt, ihre Einzelteile in einigen Fällen mit
westlichen Partnern fusioniert oder in Privatisierungs-Wartestellung.
Es wurde nicht nur radikal umstrukturiert, sondern auch umgedacht.
Die Pressebeauftragten wirkten z. T. recht optimistisch. Ich dachte
an die Rückstände zumindest im Ingenieursektor und die zusammen-
gebrochenen Ostmärkte, daher waren meine Empfindungen eher ge-
mischt.
Die bedeutendsten Firmen hatten ihre Standfläche wesentlich vergrö-
ßert. Ihr Investitionsengagement in die Neubundesländer reicht von
Vertrieb und Service (z. B. Rohde & Schwarz, Honeywell) über Betriebs-
übernahme (z. B. Philips) bis zur Schaffung zusätzlicher Standorte.
In diesem Punkt bietet Siemens ein hervorragendes Beispiel; an einer
Informationstafel zähle ich knapp 10 000 Stellen für Fertigung und
Vertrieb in den neuen Bundesländern zusammen.
Mit Abstand der größte Investor und Arbeitgeber ist jedoch Telekom:
1991 werden 6,9 Mrd. DM bereitgestellt, 1997 sollen es über 50 Mrd.
sein. Und bis 1993 ist mit rund 100 000 Arbeitsplätzen zu rechnen.
In Leipzig hat die Telekommunikationszukunft schon begonnen − es
gibt Cityruf und das leistungsfähige Bündelfunksystem Checker, und
man kann mit Karte telefonieren. Die begeisterten Messebesucher nut-
zen es weidlich, über digitale Vermittlungsstellen und Richtfunk "ganz
normal" in die Altbundesländer oder via Kopernikus 2 mit einem Part-
ner im Pavillon zu telefonieren. Das Programm "Telekom2000" ist der
bisher einzige vollständige Strukturplan der Wirtschaft. Er sieht vor,
über 7 Millionen Telefonanschlüsse, 68 000 Münz- und Kartentelefone,
360 000 Telefaxanschlüsse, 50 000 DATEX-P-Anschlüsse, 6 Millionen
Anschlüsse für Kabelfernsehen und 300 000 für Mobilfunk neu zu schaf-
fen. Es stimmt mich sehr zuversichtlich, erleben zu können, mit wie-
vielinitiative der Motor Telekommunikation, ohne den keine moderne
Volkswirtschaft läuft, angekurbelt wird.
Und so trete ich gut gelaunt die Heimreise an. Sicherlich ist das Messe-
konzept zu überdenken (reine Fachmesse), und die unverhältnismäßig
hohen Gebühren müssen verschwinden, damit osteuropäische Ausstel-
ler wieder eine Chance haben. Doch stimme ich − mit vielen Gesprächs-
partnern überein: Leipzig bleibt der historische deutsche Messeplatz
mit guten Aussichten für die Zukunft!
Ihr
F. Sichla
Die Jury hat gesprochen
Ungefähr 6 Wochen hatten Sie, verehrte Leser/Autoren, um bei unserem
Kreativwettbewerb aus einer Idee die nachbaufähige Lösung oder nutz-
bare Software zu machen. Nicht allzuviel Zeit, denn der Einsendeschluß
für die Arbeiten drückte (wobei ein solcher Zeitdruck auch positiv wirken
kann). Nicht anders erging es der Jury, bestehend aus den Redakteuren
des FUNKAMATEUR (beratend dabei auch unsere ständigen Mitarbeiter)
und den leitenden Mitarbeitern des Sponsors, um bis zum Redaktions-
schluß dieser Ausgabe unsere Entscheidung (der Rechtsweg ist ausge-
schlossen) präsentieren zu können.
Kein leichtes Unterfangen, war doch die thematische Breite mit Bedacht
von Elektronik-Projekten über Hard- bis zur Software festgelegt worden.
Und bei der Software ging es uns ganz selbstverständlich auch darum, sie
auf den entsprechenden Computern zu testen. Die Einsender hatten drei
Chancen: einen Preis, die Veröffentlichung ihrer Arbeit und deren Vermark-
tung. Eine gegenseitige Bedingtheit gibt es dabei nicht, denn einige Ein-
sendungen waren z. B. einfach zu umfangreich für eine Veröffentlichung −
wir werden aber versuchen, Ihnen trotzdem einen Zugriff zu ermöglichen.
Unser wichtigstes Kriterium: die Attraktivität für unsere Leser. Insofern
haben wir den Begriff Elektronik nicht so sehr eng gesehen und auch die
angrenzenden Bereiche unserer Thematik akzeptiert.
Insgesamt erreichten uns fast 50 Einsendungen, die die Bedingungen der
Ausschreibung (vgl. Ausgabe 1191, S. 6) einhielten. Etliche Autoren nutz-
ten die Möglichkeit, mehrere Beiträge zu offerieren, um ihre Chancen zu
optimieren. Besondere Schwerpunkte gab es eigentlich nicht, die ganze
Vielfalt, die die Ausschreibung erlaubte, spiegelte sich schließlich in den
eingegangenen Arbeiten wieder.
Hier nun erst einmal die Gewinner der Hauptpreise:
1. Preis (6-Tage-Busreise nach Paris für zwei Personen):
R. Gertner, 0-1140 Berlin: Videotext-Steuerplatine
2. Preis (1000-DM-Einkaufsgutschein):
M. Ebert, 0-1193 Berlin: SWR-Messer mit LED-Zeile
3. Preis (500-DM-Gutschein):
A. Köhler, 0-4500 Dessau: Z 1013 mit V.24
Beim 4. bis 10. Preis haben wir aufgestockt und durchgehend 100-DM
Gutscheine vergeben. Ohne differenzierte Wertung die Gewinner in
alphabetischer Reihenfolge:
W. Caspar, 0-8601 Semmichau: Wechselstromladegerät
L. Elßner, 0-8210 Freital: Logikanalysator
R. Hübl, 0-8010 Dresden: C 64 Extended Graphie
B. Jahn, 0-1136 Berlin: Logikanalysator
H.-U. Küster, 0-7970 Doberlug-Kirchhain: Debugger
G. Reinhöfer, 0-7400 Altenburg: Schrittmotoransteuerung
H. G. Thierfelder, 0-7050 Leipzig: Wühlmaus-Scheuche
Sonderpreis für den jüngsten Teilnehmer (100-DM-Gutschein):
A. Caspar, 0-4502 Dessau (15 Jahre): Personenzählender Lichtschalter
Die Gewinner der weiteren Preise veröffentlichen wir im folgenden Heft
auf der POSTBOX-Seite. Sie wurden inzwischen von uns schriftlich be-
nachrichtigt und erhalten ihre Gutscheine zusammen mit einer aktuellen
Angebotsliste direkt vom Sponsor. Das gleiche gilt für eine mögliche kom-
merzielle Nutzung. Der Sponsor setzt sich gegebenenfalls mit Ihnen in Ver-
bindung.
Abschließend allen Teilnehmern am Wettbewerb herzlichen Dank, ganz be-
sonders im Namen unserer anderen Leser. So bleiben wir unserem Prinzip
treu: Leser für Leser, mit Gewinn. Der Siegerbeitrag soll Ihnen nicht lange
vorenthalten bleiben − Sie können ihn im nächsten Heft lesen!
Herzlichst, Ihr
Bernd Petermann (Stellvertretender Chefredakteur)
Neubelebter schwarzer Kanal?
Ich erinnere mich noch an Zeiten in den 60ern, als in unseren östlichen Län-
gen hinter dem "Stella" oder "Dürer" eine Brotbüchse stand, in der sich −
von findigen Bastlern und/oder Geschäftemachern gebaut- UHF-Konverter
befanden, die dem Nutzer eine Fernsehprogrammerweiterung mit relativ
geringem Kostenaufwand brachten.
Längst vergessen?
Im "Tal der Ahnungslosen" wurden noch vor rund zwei Jahren Staßfurt-Fern-
sehempfänger angeboten, die gegen einen kleinen Preisvorteil nur für
die SECAM-Norm ausgelegt waren. Seitdem aber kurz vor dem jüngsten
Jahreswechsel klammheimlich in den DFF-Studios und in den Fernsehsen-
dern der Deutschen Post die PAL-Umschaltung erfolgte, können viele Zu-
schauer nur noch schwarz (weiß) sehen. Da stehen PAL-Dekoder aus der
Eigenbauschmiede oder von ausgedienten Geräten wieder hoch im Kurs,
denn nicht immer gestattet das Haushaltbudget sofort die Anschaffung eines
neuen und dann gleich technisch bestausgerüsteten Fernsehempfängers.
Übrigens scheint mir, daß selbst in den Chefetagen des Bundesministeriums
für Post- und Telekommunikation in Bann von dieser Nacht- und Nebelum-
stellung niemand gewußt hat oder wissen wollte − bei meiner Befragung des
Ministers Anfang Dezember lautete die Auskunft zu diesem Problem noch:
"Die Umstellung der DDR-Sender von SECAM auf PAL wird bis Mitte 1991
abgeschlossen sein." (vergl. FUNKAMATEUR 1/9I, S. 8)
Die Veränderung der Fernsehlandschaft in Ostdeutschland hat für viele Ge-
bührenzahler in süd-und nordöstlichen Regionen sowohl (noch) keine flächen-
deckende Versorgung mit dem ZDF-Programm gebracht, als auch gleicher-
maßen die technische Qualität der Versorgung mit dem Programm der DFF-
Länderkette vielerorts verschlechtert. Und wer nochfür viel altes Geld einen
Farbfernsehempfänger ohne PAL-Standard erwarb, sieht jetzt neuerdings
auf allen Bereichen einen neuen schwarzen Kanal.
Geschäftemacher und Fernsehwerkstätten reiben sich wieder einmal die
Hände- wie fast vor 20 Jahren, als man bekanntlich nur reine SECAM-Geräte
verkaufte und der PAL-Dekoderbau einen regelrechten Boom erlebte.
Manche glauben, mit einer Satelliten- TV-Empfangsanlage die Versorgungs-
engpässe ausgleichen zu können. Trotz der Kosten für die Anschaffung (die
Installation ist seit 1. Februar endlich nicht mehr postanmelde- und gebüh-
renpflichtig; die Geräte müssen aber nach wie vor eine ZZF-Nummer besit-
zen) und der Laufereien nach der Zustimmung vom Vermieter hat er weder
Farbempfang noch die terrestrisch ausgestrahlten Programme im Wohn-
zimmer.
FUNKAMATEUR-Leser wissen eine andere Lösung. Sie können sich mit ihrem
Wissen und Können bei Verwandten und Bekannten beliebt machen. Unser
Beitrag auf Seite 162 dieser Ausgabe bietet Hilfestellung und Unterstützung
für diejenigen, die PA L-Dekoder aus ausgedienten Geräten nutzen wollen,
um sie in Nur-SECAM-Geräte einzubauen. Noch ein Tip: Wer via Kabel von
einer Gemeinschaftsantennenanlage terrestrische Programme ins Haus be-
kommt, kann seinen SECAM/PAL-tüchtigen Videorecorder (neben der Mög-
lichkeit, auch Kabelkanäle zu empfangen) indirekt als "PALDekoder" nutzen.
Aufmerksame Leser werden wissen, daß die SCARTBuchse die RGB-Signale
zur Verfügung stellt (vergl. FUNKAMATEUR 9190, S. 450). Durch fachgerech-
ten Einbau einer solchen Buchse kann eine PAL-Dekoderumrüstung entfallen.
Gleichzeitig wird man mit besserer Farbwiedergabe belohnt.
Mit besten Wünschen für gutes Gelingen
Ihr
H. Radke, Chefredakteur
Hobbyelektronik − der reine Selbstzweck?
Diese Frage stellt so mancher, der die Schwemme fertiger elektronischer
Konsumgüter in den Schaufenstern sieht. "Und nun noch eine Spezialmes-
se für Hobbyelektronik?", wird so manche geplagte Bastler-Ehefrau im
November aufgeschrien haben, als er sich auf den Weg nach Stuttgart
zur alljährlich stattfindenden "Hobby + Elektronik" machte − auf Schnäpp-
chenjagd. "Es ist doch ganz klar, daß für Menschen, die im Hochtechnolo-
giebereich arbeiten, das Hobby oft Ausgangspunkt für eine erfolgreiche
Karriere war. Der Nachwuchs hat es heute ein bißeben schwerer.
Das gewaltige Überangebot vorgefertigten elektronischen Konsumguts
macht Hobbybasteln fast zur skurrilen Beschäftigung. Außerdem weht
der Wind des Zeitgeistes "naivem technischem" Hobby aus Umweltschutz-
gründeo oft ins Gesicht. Erfolgreiche Zucht von Biogemüse schlägt in wei-
ten Kreisen das selbstgebaute Elektronikgerät aus dem Feld.
Dennoch gibt es viele Unentwegte, vor allem Jugendliche, die aus Lust an
der Technik und aus Wissensdrang die Elektronik als Hobby ergreifen und
betreiben. Zwar basteln sie nur noch selten Radios- die kann man billiger
und besser kaufen, auch sind die Funkamateure nicht mehr die Elite des
technischen Fortschritts, aber mit ebensolcher Energie und Freude wie die
Hobbyisten der guten alten Zeit widmen sich diese engagierten Amateure
dem jüngsten Kind der modernen Elektronik, dem Computer.
Hobbyelektronik ist heute zum großen Teil Computerhobby − aber es gibt
auch noch viele Elektronikenthusiasten … Das Florieren solcher Versender
(der Elektronik, Sz) zeigt, daß das elektronische Hobbyturn bei weitem
nicht ausgestorben ist … Computer aber bestimmen das Geschehen."
Dieses lange Zitat habe ich dankbar einer Rede von Ulrich Rohde entnom-
men, einem, der weiß, wovon er spricht, denn er ist Chefredakteur der
Zeitschrift "mc". Einer Rede, die er zum Auftakt der "Hobby + Elektronik
90" hielt.
Was sagt uns das? Nichts weiter, als daß unsere Philosophie von der unge-
brochenen Bedeutung der Hobbyelektronik richtig ist, auch, wenn Unken-
rufer vor allem östlich der Eibe etwas ganz anderes behaupten. Sollen sie
sich doch rekeln vor ihrer sauteuer bezahlten Heimelektronik, der Tag
kommt bestimmt, daß der sonst Lästernde bei seinem Bastler-Bekannten
vor der Tür steht: "Du-du hast doch Ahnung…". Und das setzt sich im
Beruf fort. Wer einst in der DDR mit dem AC 1 begann, sitzt heute viel
lockerer vor dem neuen 386er, schimpft nicht laufend auf "die Kiste", weil
er nämlich von Beginn an im Stoff stand − dank des Hobbys. Ach, was
schleppen sie mir alle ins Haus, die Verwandten und Bekannten- dies zu
reparieren, das zu ändern. Aber wenn ich mal das Gespräch auf meinen
ganzen Stolz, nämlich mein derzeit in Arbeit befindliches Objekt bringe:
"Dein Mist!" Geht es schizophrener?
Und wer heutzutage noch einen Computer, auch wenn er nur 8Bit hat, als
ausschließliches Kinder-"Spielzeug" abtut, ja, der muß sich fragen lassen,
wann er denn nun etwas für seine gesicherte eigene Zukunft zu tun ge-
denkt? Und meine Kinder kennen inzwischen gleich mehrere "Kisten" ganz
gut, tasten sich per Malprogramm sogar an WINDOWS heran, die Tochter
ist stolz auf ihren selbstgebauten Stromkreis mit Glühlampe und Batterie,
der Sohn erforscht mit hebelndem Schraubenzieher seine Fernsteuerautos −
ob ihnen das in Zukunft weh tun wird?
Ihr
M. Schulz
Selbstbau contra Fertiggerät?
Sicher wird sich der eine oder andere über die Überschrift wundern, zumal
der FUNKAMATEUR auch eine Zeitschrift für den Elektronik-Bastler ist.
Trotzdem. Heutzutage gibt es eine Fülle preiswerter Fertiggeräte und -bau-
gruppen, ein äquivalenter Selbstbau wird Jetztendlich teurer und beansprucht
auch noch eine Menge Freizeit; so ist die Frage nach dem Selbstbau
durchaus gerechtfertigt.
Was ist es, das viele Elektroniker heute noch veranlaßt, nach dem Lötkol-
ben zu greifen, obwohl ihre "Projekte" schon fertig und preiswert im Laden
stehen? Da gibt es mehr als ein Motiv: An erster Stelle stehen wohl der Wille,
ein Gerät entstehen zu sehen, das man bis aufs kleinste Bauelement kennt
und − der Stolz, daß es auch spielt. Hinzu gesellt sich der Wunsch, beim
Selbstbau zu lernen und die Funktionsweise der Schaltung zu erforschen.
Daraus folgt, daß man im Laufe seines Bastlerdaseins immer kritischer
wird, die Angebote auf domMarktgründlich prüft und vielleicht feststellt:
Ich hätte hier und da noch daran "gefeilt". Denn irgend etwas fehlt einem
bekanntlich immer.
Außerdem läßt ein Fertiggerät dem einzelnen nicht viel Kreativität, einem
der kostbarsten Bastlerschätze überhaupt. Hinzu kommt der Spaß am eige-
nen Produkt, der sich in drei verschiedenen Stufen ausdrückt. Der Anfänger
wird gewöhnlich zuerst zum Bausatz greifen, der es ihm ermöglicht, ein Ge-
rät schnell und sicher aufzubauen. Der Erfolg ist schnell erreicht. Trotzdem
kann er das Gehäuse selbst entwerfen und entscheiden, ob er das fertige
Stück noch vervollkommnet.
Irgendwann hat der Newcomer die nächste Ebene erklommen und möchte
Leiterplatten selbst entwickeln und ätzen. Der Ehrgeiz, alles kleiner und
besser machen zu wollen, wird zur Triebfeder seines Handelns. Dabei kommt
hinzu, daß das Elektronik-Basteln durch das Angebot an Bauelementen und
Zubehör leichter geworden ist, kleinere Bauelemente zur Verfügung stehen
und die früher notwendigen Improvisationen wegfallen. Schließlich gehört
der Elektroniker zu jenen, die sogar eigene Schaltungen entwerfen, die da-
ran interessiert sind, daß ihre Selbstbaugeräte tipptopp aussehen. Immer
im Streben nach Perfektion und ja − inzwischen so selbstbewußt, um seine
Kenntnisse auch irgendwie beruflich nutzen zu können. Heute hat gerade
dieser Aspekt an Bedeutung gewonnen, gilt es doch, den Abstand zwischen
Elektronik-Ost und Elektronik-West schnell zu eliminieren.
Wie es auch sei, Gründe für den Selbstbau gibt es viele. Wäre es auch, um
in die Reparaturpraxis einzusteigen oder einfach "nur", um Spaß an der Sache
zu haben. Mögen die Geräte auch immer billiger werden- die Idealvariante ist
längst nicht immer dabei, so daß der Reiz am Bauen bleibt und die Kreativität
gefördert wird. Dabei ist es völlig gleich, ob es sich um Computer-Hardware,
Musikelektronik oder Funktechnik handelt. Auf jedem dieser Gebiete ist der
Amateur engagiert und der FUNKAMATEUR daran interessiert, diesen Eifer zu
unterstützen.
Auch in Zukunft werden wir versuchen, in Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe
Leser, solche Interessen zu unterstützen, die Selbstbaupraxis zu dem zu ma-
chen, was sie ist − nämlich ein schönes und vielseitiges Hobby.
Herzlichst, Ihr
Jörg Wernicke, Redakteur für Elektronik
Heft: 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
Markttreiben
Der FUNKAMATEUR-Jahrgang 1990 ist sicher für unsere geringer gewor-
dene Schar von Stammlesern sowie für Sammler etwas Besonderes, belegt
er doch, wozu wir durch die großen Veränderungen in unserem Hauptver-
breitungsgebiet in der Lage waren, was wir aus den neuen Bedingungen
zu machen verstanden. Auch am größeren Umfang dieses Jahresbandes
ist das zu spüren.
Hier ist − neben den besten Wünschen für alle Leser für das bevorstehende
Jahr 1991 − ein Dank an die noch rund 40 000 Abonnenten des FUNKAMA-
TEUR angebracht, die uns die Treue hielten und uns auch in die Pflicht neh-
men, dieses Vertrauen jeden Monat neu zu erwerben. Es ist uns auch ge-
lungen, so manchen Leser neu für uns zu gewinnen, und das ist angesichts
der gut gemachten, hoch spezialisierten Zeitschriften auf unseren Themen-
gebieten erfreulich.
Das Jahr 1991 wird auch für den FUNKAMATEUR weitere Schritte nach vorn
bringen. Zunächst solche, die uns unsere Druckerei dankenswerterweise er-
möglicht. Der FUNKAMATEUR erscheint ab Januar jeweils zum Monatsanfang
− die Käufer beim Zeitschriftenhandel seien besonders darauf hingewiesen.
Außerdem wird die Herstellungszeit auf die Hälfte verkürzt, so daß wir jetzt
auch besser reagieren und so manchen Beitrag oder so manches Anzeigen-
vorhaben schneller realisieren können. Das sollte im Zusammenhang mit
weiter auf Ihre Wünsche abgestimmten Inhalten seitens der redaktionellen
Arbeit unsere Marktchancen verbessern. Auch äußerlich werden wir uns ab
Januar etwas neu gestylt präsentieren. Fragen Sie also am Kiosk nach dem
FUNKAMATEUR, wenn der nicht gleich in der ersten Reihe zu finden oder gar
− aus anderen Motiven als früher − unterm Ladentisch versteckt ist. Wobei
ich Ihnen aber rate, zu einem − natürlich jederzeit kündbaren − Abonnement
überzugehen. Denn das bringt Ihnen einen finanziellen Vorteil. Und Sie kön-
nen beruhigt sein: Den Abonnementspreis von 2,50 DM pro Ausgabe können
wir weiterhin halten.
Sie wissen selbst, daß ab Januar 1991 Preisveränderungen für Porto, Energie
und viele andere lebenswichtige Dinge ins Haus stehen. Für den Zeitschrif-
tenvertrieb kommt noch ein weiterer Kostenfaktor hinzu: Der Freiverkauf
beim Zeitschriftenhandel hat seinen Preis. Um weiterhin kostendeckend pro-
duzieren zu können, sind wir nach langen Beratungen einschließlich Varianten-
berechnungen gezwungen, den Preis im Freiverkauf zu erhöhen. Bei Redak-
tionsschluß lag noch keine endgültige Festlegung zu diesem Preis vor − so
also noch einmal mein Rat − siehe oben: Nehmen Sie die Möglichkeit wahr,
Ihren FUNKAMATEUR frei Haus weiterhin für den alten Preis zu beziehen.
Ich muß das sicher nicht großartig kommentieren. Sie wissen, daß in der
Marktwirtschaft − so nicht subventioniert wird − Preis und Kosten einen
grundsätzlichen Zusammenhang haben. Eine Tatsache, die jahrelang in
unserem Verbreitungsgebiet verbogen wurde, sowohl in die eine wie auch
in die andere Richtung. Und nun kommt − trotzschärfster Kalkulation in
Druckerei und Verlag − an den Tag, daß uns noch Voraussetzungen für eine
kostengünstigere Produktion fehlen.
Nun hoffe ich, daß Sie sich beim Vergleich des Preises mit der Leistung
dennoch weiter für den FUNKAMATEUR entscheiden können. Wir sehen
uns also auch 1991. Ich wünsche Ihnen ein glückliches neues Jahr, so
kompliziert es sich auch anlassen mag.
Ihr
H. Radke, Chefredakteur
Vorsicht, Falle, oder: cool in den Weihnachtseinkauf
Weihnachten steht vor der Tür, spätestens jetzt macht man sich Gedan-
ken über die Geschenke. Renner in diesem 1 ahr wird ganz sicher die
Heimelektronik sein. Ich war für Sie beim Verbraucherschutz − danke an
dieser Stelle Herrn Backasch für seine bereitwilligen Auskünfte − und habe
mich erkundigt, was man beim Kauf beachten sollte.
Machen Sie Preisvergleiche, gehen Sie zu den Verbraucherschutzzentralen,
informieren Sie sich dort aus den verschiedensten Publikationen über
Preise, Angebote, Daten , um so gezielt ei nkaufen zu gehen, ohne sich
von der Vielfalt des Angebots erschlagen zu lassen. Vor dem Kauf infor-
mieren Sie sich über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Ge
währleistungsbedingungen unterscheiden sich oft erheblich. Die Regel sieht
bei Reklamationen zunächst eine zweimalige Nachbesserung vor, bevor ge-
tauscht oder zurückgezahlt wird. Alles andere läuft unter Kulanz, ebenso
wie eine ausführliche Vorführung des Kaufgegenstands, die Sie eher beim
guten Fachhändler als im Kaufhaus erwarten können. Dieser Fachhändler
muß durchaus nicht in der City beheimatet sein, an der Peripherie der Stadt
ist es bei gleich gutem Service oft billiger.
Bei Reklamationen ist per Gesetz allein der Händler zuständig, und zwar
meist der, bei dem Sie gekauft haben. Es sei denn, der Händler an Ihrem
Urlaubsort gibt Ihnen eine schriftliche Aufstellung von Servicepartnern, so
wie es in der ehemaligen DDR üblich war. Dies gilt besonders bei Käufen
im Ausland. Einige Händler und Hersteller fordern im Reklamationsfall
ausdrücklich die Originalverpackung des Geräts zurück und weisen jede
Beanstandung ohne diese von sich. Jene Praxis ist unrechtens, auch wenn
sie in den AGB verankert ist. Dennoch sollte man zumindest in der Garan-
tiezeit zum sachgerechten Transport die Verpackung aufbewahren.
Ausdrücklich zu warnen ist vor dem an den Kauf gebundenen Abschluß ei-
nes sog. Servicevertrags. Hier wird man zur Zahlung eines monatlichen
Beitrags verpflichtet und darf dann den Service der Firma für zumeist fünf
Jahre kostenlos in Anspruch nehmen. Dagegen spricht, daß bei den 10 bis
12 DM, die monatlich gefordert werden, in fünf Jahren ein Betrag aufläuft,
für den man sich oft bequem ein neues Gerät hätte leisten können. Ande-
rerseits sagt die Praxis, daß moderne Heimelektronik aufgrund ihrer hohen
Zuverlässigkeit kaum nach der Garantiezeit ausfällt, die monatliche Zah-
lung also für die Katz ist. Apropos monatliche Zahlung: Hände weg von pri-
vatem Leasing von Heirnelektronik, teurer geht's im Endeffekt nicht!
Manche Allbieter verschleiern den Begriff Leasing auch mit dem einge-
deutschten "Mietkauf". Beim Teilzahlungskauf hilft auch ein sorgfältiger
Vergleich der Händlerkonditionen mit denen der eigenen Bank oder gar
denen der Familie. Barkauf ist letztendlich immer billiger! Überschlafen Sie
verlockende Angebote, lassen Sie sich nicht von bunten Skalen zum Kauf
verleiten, und überlegen Sie einmal, ob Sie tatsächlich das Fernsehgerät
mit 100 Kanälen brauchen, wenn es das zwar moralisch leicht angegraute,
aber preisgünstigere Vorgängergerät mit 30 Kanälen genauso gut macht.
Reine Modernität ist etwas für die Schickeria, nicht für den, der sein Geld
mit Arbeit verdient!
Fast zum Schluß noch eine Warnung vor Second-Hand- und Straßenhändlern,
die keine Gewährleistung bieten und den Kunden nach dem Kauf im Regen
stehen lassen. Ein leeres Computergehäuse ist kein netter Anblick, beson-
ders dann nicht, wenn der Händler über alle Berge ist.
Ganz zum Schluß noch der Hinweis auf die Adressen der Verbraucherschutz-
zentren der Länder. Hier erfahren Sie auch, ob ein Verbraucherschutzzentrum
ganz in Ihrer Nähe existiert. Die Adressen finden Sie komplett in unserer Ru-
brik Postbox auf S. 534.
Ich wünsche Ihnen einen harmonischen und erfolgreichen Weihnachtseinkauf
und verbleibe mit freundlichem Gruß
M. Schulz, Redakteur für Computertechnik
Praktische Elektronik hier und heute
Unsere Umfrage-Ergebnisse weisen aus: Die Selbstbaupraxis gibt es noch.
Es überwiegt mit leichtem Vorsprung der Teil von Umfrageteilnehmern,
die dem individuellen Aufbau mit Bauelementen den Vorzug geben gegen-
über jenen, denen Bausätze lieber sind. Zwei Drittel zieht den Kauf in
Fachgeschäften traditionell vor, während ein Drittel auf den Versandhan-
del schwört. Sicher ist hier noch nicht der letzte Stand eingeflossen, weil
auch für den Großstädter der Versandhandel einige Vorteile bietet. Fast
die Waage halten sich in der Umfrage die Gruppen der Amateure, die auch
ihre Platinen noch zumeist selbst herstellen mit denen, die sie fertig kaufen.
Nun habe ich mich- kurz vor Redaktionsschluß − in Amateurfachgeschäften
im Ostteil Berlins umgesehen, um zu erfahren, ob sich dort bestätigt, daß
es die praktischen Elektroniker noch gibt, und wie sie sich dort versorgen
können. Die Eindrücke: Bauelemente, Bausätze sowie teilweise auch be-
stückte Platinen aus der Produktion der ehemaligen DDR-Wirtschaft sowie
ihrer osteuropäischen Partner gibt es in ungewohnter Breite und zu Schleu-
derpreisen. Bauelemente aus westlicher Produktion sind praktisch nicht im
Angebot. Wohl aberwestliche Fertiggeräte der höheren Preisklassen wie
Fernsehempfänger, Antennenanlagen, CD-Player, Stereorundfunkempfänger
usw. Doch Käufer sieht man kaum … So konnte ich bei diesen Stichproben
auch keine Bestätigung dafür finden, daß die Hobbyelektroniker den Run
auf unsere Bastlerläden begonnen hätten.
Auch die merklichen Angebotslücken in den Läden dürfte ein Grund sein,
daß Elektronikversandhäuser in der DDR stark auf den Markt drängen,
daß man- auch ungewollt- mit ihren Offerten überschüttet wird. Zugleich
haben sich viele Amateure auch Kataloge bekannter Versender besorgt.
Die Angebote sind beeindruckend - der Elektroniker hat die Qual der Wahl,
mit Hilfe von Bastler-Kits oder in althergebrachter Weise seinem Hobby
zu frönen.
Für den ungeübten Versandhandel-Kunden halten wir in dieser Ausgabe
einige Hinweise bereit (s. POSTBOX, S. 480).
FUNKAMATEUR hat sich immer als eine Zeitschrift von Lesern für Leser
verstanden. Insofern hat sich unser technischer Inhalt, haben sich un-
sere Bauanleitungen schon immer nach Angebot und Nachfrage reguliert.
Was einschließt, daß nach einer Veröffentlichung andere Leser eine ele
gantere Lösung anbieten. Also Anregungen für Kreativität auf zwei Ebenen:
einmal für eigene Projekte, zum anderen für eigene Veröffentlichungen.
Das sehen wir als eine Kombination an, die den FUNKAMATEUR auszeichnet.
Kann die Leere in einschlägigen Fachgeschäften aber auch die Ursache
haben, daß selbst eingefleischte Eigenbauer in innere Konflikte gebracht
sind: Lohnt das eigene Basteln sogar der schönsten Projekte noch, wenn
gleichartige industriell gefertigte Geräte preiswert und problemlos zu be-
kommen sind?
Die Lösung scheint zwingend. Solche Bauanleitungen anzubieten, die Un-
konventionelles bieten. Unsere Erfahrungen und unsere Umfrage geben
uns da recht. Und wenn Sie mitgehen, nicht nur "Verbraucher", sondern
auch "Erzeuger" sein wollen, sind Sie bei uns immer richtig. Ich freue mich
auf Ihre interessanten Beiträge und verbleibe in Erwartung Ihrer Post mit
herzlichen Grüßen als
Ihr
J. Wernicke, Redakteur für Elektronik
Die Geister, die wir riefen…
reagierten in Massen, und wir sind trotz dieses so nicht erwarteten An-
sturms und der für uns damit verbundenen zusätzlichen Arbeit rundum
zufrieden. Wir wollen die "Geister", die wir riefen, auch niemals loswer-
den, ganz im Gegenteil!
Sie verstehen schlecht? Na, aber, erinnern Sie sich bitte. Unserer Juni-
Ausgabe war ein Fragebogen beigeheftet Mehr als 8100 FUNKAMATEUR-
Leser ftillten die Bögen aus und schickten sie uns her. Allein das Öffnen
der Zuschriften zu unserer Umfrage erforderte Sonderschichten in der
Redaktion. Aber: Wir bedanken uns ausdrücklich für die Mühen, die Sie
uns mit Ihren zahlreichen Zuschriften bereiteten.
Nun sind wir in der Lage, repräsentative Aussagen über unsere Leser tref-
fen zu können. Jahrzehntelang waren solche Umfrageaktionen nicht möglich.
Auch, wenn einige Leser meinten, daß unsere Fragen nicht glücklich seien:
Schlüsse können wir ziehen. Bitte erwarten Sie aber nicht, daß wir jene
komplett veröffentlichen − das soll unser "Schatz" bleiben.
Aber in der Zeitschrift werden Sie wiederfinden, was Sie uns angekreuzt
haben − wenngleich: Auch nach dieser Aktion wird es uns nicht gelingen,
es allen recht zu machen.
Wir nehmen Ihre mehr als 8 000fache Meinungsäußerungen zu unserer
Umfrage als einen Beleg für Ihr fortwährendes Interesse am und für den
FUNKAMATEUR sowie gleichermaßen ftir uns als Verpflichtung für den
künftigen Inhalt, denn ich darf wohl sicher sein, daß es Ihnen gleich
uns vor allem darauf ankam − die Preise waren "nur" ein zusätzlicher
Anreiz.
Apropos Preise. Je ein Digitalvoltmeter geht an K. Uhlmann, Gornsdorf,
K.-R. Heinicke, Stahnsdorf, R. Hülse, Berlin, G. Franz, Ragösen,
R. Köhler, Leipzig, J. Altmann, Berlin, B. Jahn, Binz, K. Zöllner, Eilenburg,
T. Janke, Köthen, R. Schüller, Seebergen, W. Walter, Leipzig,
W. Aufforth, JenaWinzerla, M. Steppath, Rostock, H.-J. Margull, Marke,
Th. Büttner, Erfurt, H. Draeger, Strausberg, B. Michael, Tanneberg,
H. Alms, Klevenow, St. Fink, Oberrauschütz, D. Berger, Bernburg,
R. Drescher, Storkow, A. Ehle, Oranienburg, F.Th. Brauer, Erfurt,
J. Kröhnert, Wusterhausen, R. Michaelis, Berlin.
Seine Traumreise erfüllen kann sich im September unser Leser
Georg Kähne, Loburg, der gemeinsam mit seiner Frau für 4 Tage
nach Paris fährt. Ihn erwählte Fortuna, natürlich mit verbundenen
Augen und so unter Ausschluß des Rechtsweges.
Allerherzlichste Glückwünsche allen Gewinnern.
Mehr als 150 Einsendern genügte das Ankreuzen nicht. Aufbeigelegten
Schreiben teilten sie uns ihre Gedanken mit, um sich ihren FUNKAMATEUR
zu erhalten, auch gegenüber dem jetzt großen Angebot.
Nur in Ausnahmefällen sind uns individuelle Antworten möglich − mehr
würde unsere Kräfte überfordern. Denn Sie haben es sicher längst regis-
triert − Monat für Monat bekommen Sie einen auf 56 Seiten "ange-
schwollenen" FUNKAMATEUR, und das alles bewältigen wir mit dem
gleichgroßen Team. In dessen Namen mit
herzlichen Grüßen
H. Radke, Chefredakteur
Liebe YLs und OMs!
Die Ereignisse entwickeln sich weiter mit überaus hoher Geschwindigkeit.
Dabei machen sie selbstverständlich um den Amateurfunk keinen Bogen.
Der Name FUNKAMATEUR verdeutlicht den Ursprung dieser Zeitschrift.
Und den Belangen der Funkamateure fühlte sich die Redaktion immer
besonders verbunden. Das zeigte sich insbesondere darin, daß ihnen,
obwohl im Verhältnis zur gesamten Lesergemeinde nicht allzu zahlreich,
immer ein relativ großer Platzanteil zur Verfügung stand. Die Veröffent-
lichung von Bestenlisten und Contestergebnissen hat sicher viel zur Ak-
tivität der DDR-Funkamateure beigetragen. Die Wende brachte mit dem
Außerordentlichen Verbandstag des RSV, von dem wir berichteten, einen
eigenständigen RSV e. V. mit einem demokratisch gewählten Führungs-
gremium. Eine Übernahme der Herausgeberschart des FUNKAMATEUR
war dem RSV e. V. allerdings aus fmanziellen Gründen nicht möglich,
so daß weder eine administrative noch eine wirtschaftliche Klammer
zwischen beiden existiert. Trotzdem hat unsere Zeitschrift dem erneuer-
ten RSV Unterstützung zugesagt und gegeben. Den Funktionären des Ver-
bandes gelang es, die Mehrzahl der DDR-Funkamateure als Mitglieder zu
gewinnen. Die Verhandlungen des RSV-Vorstandes mit dem DARC brachten
den korporativen Beitritt des RSV in den DARC mit Wirkung vom 1. Juli
1990. Damit erhalten alle RSV-Mitglieder für ihren Mitgliedsbeitrag die
DARC-Verbandszeitschrift cq-DL. Die Präsidiumstagung des RSV vom
9.Juni dieses Jahres beschloß überdies, die cq-DL zur Verbandszeitschrift
des RSV zu machen.
Damit werden viele Themen unserer Amateurfunkpraxis-Seiten wegen
Dopplung mit der cq-DL weitestgehend unnötig: Contestausschreibungen,
DX-QTC, UKW-QTC, QSL-Info, Diplome. In der DDR vorausgewertete Con-
testergebnisse internationaler Conteste waren ohnehin durch die Möglich-
keit der direkten Logeinsendung nicht mehr repräsentativ. In diesem
Zusammenhang möchten wir an dieser Stelle allen unseren Kolumnisten,
gleich, ob sie nun ihre Tätigkeit für uns beenden oder weiter präsent
bleiben, herzlichen Dank für die langjährige Zusammenarbeit sagen.
Es gibt nun aber für uns keinen Grund, den Amateurfunk ganz über Bord
zu werfen. Was wir gerade jetzt wollen: Den vielen potentiellen Funk-
amateuren den Weg zu diesem auch heute noch faszinierenden Hobby
ebnen. Politische Restriktionen stehen einer Amateurfunkgenehmigung
nun ebensowenig wie Vorbehalte des Bürgers gegenüber einer vormili-
tärischen Organisation im Wege − aber die Prüfungen werden deshalb
nicht leichter. Doch es lohnt sich. Erweiterten sich doch die Möglichkeiten
eines lizenzierten Funkamateurs immer weiter. Relaisfunkstellen, Satel-
litenfunk, Amateurfemsehen, Packet-Radio-Netze wurden möglich, und
bestimmt gibt es bald weitere Attraktionen. Mehr als bislang wird aber
auch wieder echte Kommunikation weltweit wichtiges Element unserer
Tätigkeit sein. Das alles wollen wir propagieren und auch die Amateur-
funk-Technik nicht aus dem Auge verlieren. Den DDR-Funkamateuren
öffneten sich neue Horizonte, und gerade darin sehen wir auch weiter-
hin für den traditionsreichen FUNKAMATEUR und seine Leser eines un-
serer Themengebiete − natürlich anders als bisher. Gestalten Sie es
mit uns, machen Sie uns Angebote für zeitgemäße Beiträge!
Beste 73! Ihr
Bernd Petermann, Y22T0
Heimcomputer passe?
So mancher unserer !reuen Leser drückte diese je nach persönlichen Am-
bitionen bange oder hoffnungsvolle Frage in der Post an uns aus.
Sicher, die Frage hat eine gewisse Berechtigung, der PC erobert nun auch
bei uns den heimischen Schreibtisch, und bald wird auch CP/M dort kein
Thema mehr sein, zumindest nicht für den, der sich neu einrichtet. Aber:
Der Amiga 500 und der C 64 liegen konstant in den Verkaufscharts vorn.
Daran sind gerade DDR-Computerfreaks stark beteiligt. Und dann sind da
noch die vielen Eigenbau-, DDR-, und älteren "West"-Computer, die sicher
keiner der Besitzer, der sie unter großen finanziellen und moralischen An-
strengungen gebaut bzw. erworben hat, gleich in den Schrott wandern las-
sen wird. Für den Heimbereich und vor allem zur Heranbildung der Kinder
sind die "Alten" noch immer leistungsfähig genug, auch das entnahm ich
Ihrer zahlreichen Post, für die ich mich an dieser Stelle einmal recht herz-
lich bedanken möchte, auch wenn es mir unmöglich ist, alles sofort zu
beantworten.
Für mich heißt das, mich weiter intensiv gerade um die Heimcomputer-
freaks zu kümmern, die keinen Rückenwind durch etablierte Publikationen
haben. Aber − das heißt auch Anschluß an die Gegenwart, denn wir sehen
unsere Aufgabe ja auch darin, Ihnen Wissen zu vermitteln. Darum nun
auch der 8086-Programmierkurs, die 6510-Befehlstabelle, darum die FA-
XT-Bauanleitung, die bewußt einen tiefen Systemeinstieg in die Welt des
PC/XT und des MS-DOS bietet und "nebenbei" noch den Aufbau eines selbst
konfigurierbaren XT (perspektivisch auch zum AT aufrüstbar) beschreibt.
Sicher, es gibt Billig-XT-Angebote zuhauf auf dem Markt, aber der Reiz des
individuellen Systemausbaus, des Erfolgserlebnisses des Computer-Löters
und die Möglichkeit der totalen Anpassung an den eigenen Bedarf ist offen-
sichtlich trotz der vollen Schaufenster nicht verlorengegangen − auch das
entnahm ich Ihrer Post.
Der Hardware-Ausbau unserer Heimcomputer ist weitgehend abgeschlos-
sen, CP/M fast überall installiert, das Diskettenlaufwerk und der große
Speicher ebenfalls − was bleibt? Vieles!
Gute Software-Tips, Tools, Treiber und DOS-Varianten sind immer ein
Thema, ebenso die Peripherieanpassung - nun sind ein Drucker oder gar
ein kleiner Plotter kein Traum mehr. Und es muß ja nicht gleich der Super-
24-Nadler sein, wer etwas aufpaßt, kann so manches Schnäppchen zum
Billigtarif ftir seinen ganz persönlichen Bedarf machen, wie etwa mit dem
bei Völkner ftir nur 149,50 DM erhältlichen Atari-1027-Typenwalzendrucker,
der sicher manchem Freak, der nur gelegentlich ausschließliche Textaus-
gaben braucht, als erster Einstieg genügen könnte. Und so, wie wir unsere
Freaks kennen, haben die bald alle denkbaren Anpassungen eines solchen
oder ähnlichen Geräts "on Board", ähnlich wie bei der legendären S 3004.
Portabilität und Peripherie - das sehen wir als unser und unserer Autoren
Betätigungsfeld in der nächsten Zeit und in Ihrem Interesse. Wie passe
ich welchen Drucker wo an, wie an welche Textverarbeitung? Wie rette ich
meine Wordstar-Dateien in mein neues MS-DOS-System? Wie portiere ich
Textfiles und BASIC-Programme zwischen verschiedenen Rechnern, und wie
funktioniert die Datenübertragungper Modem praktisch? Was ist aus BASI-
CODE noch herauszuholen? Und, und, und…! Der offenen Probleme an un-
seren kleinen Rechnern sind noch viele, vom Amiga über AC 1, Z 1013,
PC/M, KC, C 64, Atari bis Spectrum und Schneider.
Die Frage dabei ftir uns bleibt: Was wollen Sie, liebe Leser? Wollen Sie auch
den von uns angestrebten Trend der Nutzung unserer Maschinen in der Elek-
tronik, im Amateurfunk, in der Musikelektronik und bei der eigenen Fortbil-
dung?
Schreiben Sie uns! Wir bleiben den Heimcomputern treu, solange Sie es wol-
len. PC-Magazine gibt es genug, aber wer kümmert sich um unsere "Kleinen"?
Wir! Wer sonst?
Ihr
M. Schulz, Redakteur flir Mikrorechentechnik
Vieles neu macht der Juni
Liebe Leser, wenn Sie in dieser Ausgabe des FUNKAMATEUR auch Ihren
Hit-Favoriten-Beitrag finden, war das unsere Absicht und würde uns freu-
en. Wir hatten ja nicht nur Ihre Wünsche erbeten, sondern gleichermaßen
versprochen, die Zeitschrift nach Leserwünschen zu gestalten. Das geht
auch gar nicht anders, wenn wir uns kaufmännisch auf sichere Füße stellen
müssen − eine Konsequenz der Zeit. Dem dient auch der nunmehr kosten-
deckende Preis. Aber: Sie sollen ftir Ihr gutes Geld auch gute Ware bekom-
men…
Wenn Sie diese Ausgabe des FUNKAMATEUR ..neugierig auf weitere macht,
empfehlen wir Ihnen ein Abonnement − das ist nie ausverkauft, sicherer für
alle Beteiligten und zudem bei der gegenwärtig etwas komplizierten Lage
im Postzeitungsvertrieb vernünftig. Empfehlen Sie uns ruhig weiter, auch
Ihren Freunden und Bekannten, selbst jenseits der Grenzen. Die Namen und
Anschriften westlicher Zeitschriftenhändler stehen in unserem Impressum.
Was vielleicht nicht auf den ersten Blick auffällt: Diese Ausgabe ist um acht
Druckseiten stärker, und wir möchten es künftig so halten, den Umfang je-
weils danach zu bestimmen, wie es erforderlich und vertretbar ist. Als Start
auf den zusätzlichen Seiten veröffentlichen wir die vollständige Befehlsbe-
schreibung des Mikroprozessors 6510 und bieten damit einen Nachschlage-
service für Heimcomputernutzer.
Damit, ebenso wie mit Beiträgen zum CB-Funk, zu BC-DX, zur Videotechnik
u. a. erweitern wir unser Themenangebot. Wie lange sich diese Breite in
einer Zeitschrift so vertreten läßt, hängt auch von Ihnen ab − wir haben uns
den spezialisierten Zeitschriftenmarkt in der Bundesrepublik gut angesehen.
Wir hoffen, einem großen Leserkreis auch mit unserem XT-Projekt eine
Freude zu machen. Damit wollen wir nicht nur dem, der seinen Computer
sehr billig selbst zusammenlöten und dabei "bis in den letzten Winkel" ken-
nenlernen will, den Einstieg in das MS-DOS und die hierfür erforderliche
Hardware bieten. Wer nicht löten, sondern "nur" zusammenstellen will,
dem unterbreiten. wir auch das Angebot, spezielle Baugruppen zu erwer-
ben und die Bauanleitung nur ftir das tiefere Systemverständnis zu nutzen.
Das heißt übrigens nicht, daß wir uns nun von der 8-Bit-Strecke abwenden-
sie hat nach wie vor ihren Platz im FUNKAMATEUR.
Mit einem weiteren besonderen Service beginnen wir auf der letzten Seite:
eine aktuelle Mitteilungsspalte. Klubs, Vereine, Veranstalter usw. haben
hier die Möglichkeit, kostenlos Informationen an den Mann zu bringen
(ohne kommerzielle Absichten!) −. Redaktionsschluß dafür ist jeweils
vier Wochen vor Erscheinen der Ausgabe.
Wir bleiben, dem Zeitschriftennamen getreu, auch ftir Funkamateure da.
Allerdings gibt es seit dem Verbandstag des RSV der DDR e. V. keine "ad-
ministrative oder finanzielle Klammer" zum FUNKAMATEUR mehr.
Auch dem Leiterplattenservice widmen wir verstärkte Anstrengungen,
nicht zuletzt im Sinne unserer Autoren, und wir denken, schon bald mit
einem Ergebnis aufwarten zu können: DKLs und Leiterplatten nach
Wunsch unmittelbar zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Zeitschrift in
die Hände bekommen.
Abschließend eine Personalie: Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte Karl-Heinz
Schubert, Y21XE, als Chefredakteur nen FUNKAMATEUR geprägt. Jetzt ist er
nach langer Krankheit aus der Redaktion ausgeschieden. Er hat sich verab-
schiedet mit der Absicht, in den beruflichen, nicht aber publizistischen Ru-
hestand zu gehen. In der Redaktion haben wir den Staffelstab von ihm über-
nommen, wollen ihn erfolgreich weitertragen − zum Leser.
Herzliehst Ihr
Harry Radke, Chefredakteur